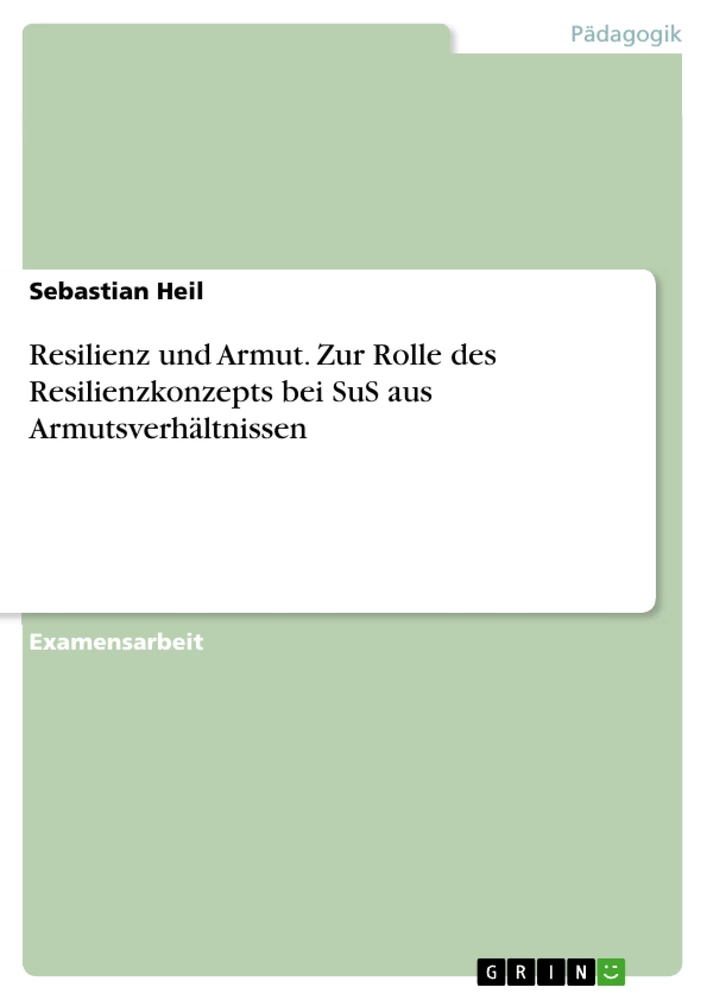Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Erde, in dem derzeit mehr als 1,6 Millionen Mädchen und Jungen unter 15 Jahren in Hartz IV-Familien beziehungsweise in „relativer Armut“ aufwachsen. Diese traurige Realität kann als „Skandal“ bezeichnet werden und zu ungläubigem Kopfschütteln, Wut oder Resignation anregen. Trotz allen negativen Emotionen und der Hoffnung darauf, dass gesellschaftspolitische Maßnahmen, im Sinne primärer Armutsprävention, schnell eine Armutsverhinderung einleiten, gilt es, insbesondere für Pädagoginnen und Pädagogen, Armut als real vorherrschendes Gesellschaftsphänomen in Deutschland anzunehmen und handlungsfähig zu werden. Nicht zuletzt deshalb, da wegen den sozialen Ausgangsbedingungen der Kinder die Wahrscheinlichkeit hoch ist, „dass sie als Jugendliche und Erwachsene erhebliche psychosoziale Probleme haben werden und sich in die Gesellschaft nicht einfügen“. Vor allem Lehrerinnen und Lehrer, die in ihrer täglichen Praxis in Kontakt zu Kindern aus Armutsverhältnissen stehen und verhältnismäßig viel Zeit mit ihnen verbringen, sollten sich herausgefordert fühlen, sich mit der belastenden Lebenslage dieser Schülerinnen und Schüler auseinanderzusetzen und adäquate pädagogische Interventionen einzuleiten. Mit dieser wissenschaftlichen Arbeit wird nicht davon ausgegangen, dass Pädagoginnen und Pädagogen Kinder aus ihrer schwerwiegenden Armutssituation heben können oder dass Armut ein Problem darstellt, das pädagogisch beseitigt werden kann. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist eher ein Konzept, das besagt, dass Kinder die Fähigkeit erwerben können, ihrer problematischen Lebenslage widerstandsfähig zu begegnen und dass jene Fähigkeit durch gezielte pädagogische Handlungen in ihrer Ausprägung mitbeeinflusst werden kann. Bildlich gesprochen, soll mit dieser wissenschaftlichen Arbeit erörtert werden, wie die Institution Schule Kindern aus Armutsverhältnissen dabei helfen kann, „Steh-auf-Männchen“ zu werden, die sich von den Widrigkeiten ihrer Lebenslage nicht dauerhaft umwerfen lassen, sondern immer wieder zäh und behaglich ihre stehende Haltung einnehmen. Abgezielt wird mit dieser Arbeit daher nicht auf Ideen zu einer pädagogischen Beseitigung von Armut, sondern eher auf die mit Armut einhergehenden psychosozialen Risiken für das Kind sowie darauf bezogene pädagogische Interventionen, die auf dem sogenannten Resilienzkonzept beruhen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen zum Resilienzkonzept
- 2.1 Zur Entstehung der Resilienzforschung
- 2.2 Begriffsbestimmun
- 2.3 Das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept
- 2.3.1 Das Risikofaktorenkonzept
- 2.3.1.1 Vulnerabilität
- 2.3.1.2 Risikofaktoren/Stressoren
- 2.3.2 Das Schutzfaktorenkonzept
- 2.3.1 Das Risikofaktorenkonzept
- 2.4 Der Wechselwirkungsprozess zwischen Risiko- und Schutzfaktoren
- 2.5 Ausgewählte Resilienzstudien
- 2.5.1 Die Kauai-Studie
- 2.5.2 Die Mannheimer Risikokinderstudie
- 3. Zum Armutsbegriff und zur Armutssituation in Deutschland
- 3.1 Relative Armut
- 3.2 Das Lebenslagekonzept
- 4. Kinderarmut unter Betrachtung des Risikofaktorenkonzepts
- 4.1 Kinderarmut als Kumulation von Risikobelastungen
- 4.1.1 Materielle Situation und damit verbundene Risikofaktoren für Kinder in chronischer Armut
- 4.1.2 Wohnsituation und Risikofaktoren
- 4.1.3 Kontakte zu Gleichaltrigen
- 4.1.4 Bildung – Zum eingeschränkten Lern- und Erfahrungsspielraum in Familie und Schule
- 4.1.4.1 Zur Bildungssituation in armen Familien
- 4.1.4.2 Kinder aus Armutsverhältnissen im Kontext der Schule
- 4.2 Zwischenfazit: Armut als komplexes Risiko für die gesunde Entwicklung des Kindes
- 4.1 Kinderarmut als Kumulation von Risikobelastungen
- 5. Wie die Schule zum Schutzfaktor für arme Kinder werden kann
- 5.1 Grundlegende Gedanken zur Rolle der Schule in der Resilienzförderung – Lehrer zwischen Wissensvermittlung und fürsorglicher Zuwendung
- 5.2 Schulische Resilienzförderung nach dem Mehrebenen-Ansatz
- 5.2.1 Resilienzförderung als ein gesamtschulisches Projekt
- 5.2.2 Resilienzförderung im Schulunterricht
- 5.2.2.1 Der kindzentrierte Ansatz nach Grotberg
- 5.2.2.2 Julius und Goetzes Programm „Resilienzförderung bei Risikokindern“
- 5.2.2.3 Grünkes Förderung rationaler Denkmuster mit Hilfe der „Unterrichtsreihe zur Resilienzförderung auf Basis der rational-emotiven Erziehung“
- 5.2.3 Elterneinbindung
- 5.2.3.1 Die ressourcenstärkenden Elterntrainings „Starke Eltern - Starke Kinder“ und „EFFEKT“ als schulische Möglichkeiten der Elternunterstützung
- 5.2.3.2 Lehrkräfte als Kursleiter im für Grundschulen adaptierten Elterntraining „Eltern stärken mit Kursen in Kitas“
- 5.2.3.3 Zur Rolle des Lehrers in beratend-unterstützender Funktion
- 5.2.4 Einzelne SchülerInnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Schulen Kindern aus Armutsverhältnissen helfen können, Resilienz zu entwickeln und widrigen Lebensumständen zu begegnen. Der Fokus liegt auf der Frage, welche Bedingungen Schulen erfüllen müssen, um zu Schutzfaktoren für diese Hochrisikogruppe zu werden. Dies geschieht unter Berücksichtigung des Resilienzkonzepts und der spezifischen Herausforderungen, die Kinderarmut mit sich bringt.
- Das Resilienzkonzept und seine Anwendung auf Kinder in Armut
- Armut als multifaktorielles Problem und seine Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung
- Die Rolle der Schule als Schutzfaktor
- Möglichkeiten der Resilienzförderung in der Schule (Mehrebenen-Ansatz)
- Die Bedeutung der Elterneinbindung bei der Resilienzförderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem der Kinderarmut in Deutschland dar und hebt die Bedeutung pädagogischer Interventionen hervor. Sie argumentiert, dass Schulen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Resilienz bei Kindern aus Armutsverhältnissen spielen können. Die Arbeit fokussiert sich nicht auf die Beseitigung von Armut, sondern auf die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Kinder gegenüber den Herausforderungen ihrer Lebenslage.
2. Theoretische Grundlagen zum Resilienzkonzept: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es erläutert das Resilienzkonzept, differenziert zwischen Risiko- und Schutzfaktoren und beschreibt verschiedene Forschungsansätze und Studien (Kauai-Studie und Mannheimer Risikokinderstudie), die die Bedeutung von Schutzfaktoren für die Entwicklung von Resilienz belegen. Es dient als Basis für die spätere Analyse der Rolle der Schule als Schutzfaktor.
3. Zum Armutsbegriff und zur Armutssituation in Deutschland: Dieses Kapitel definiert den Armutsbegriff und beleuchtet die Armutssituation in Deutschland. Es beschreibt relative Armut und das Lebenslagekonzept, welches die komplexen Zusammenhänge von Armut und deren Auswirkungen auf das Leben von Individuen betont. Dieses Kapitel liefert den Kontext für das Verständnis der spezifischen Herausforderungen, denen Kinder aus armen Familien gegenüberstehen.
4. Kinderarmut unter Betrachtung des Risikofaktorenkonzepts: Dieses Kapitel analysiert Kinderarmut als Kumulation von Risikofaktoren. Es untersucht verschiedene Bereiche, die durch Armut negativ beeinflusst werden, wie z.B. die materielle Situation, Wohnsituation, Kontakte zu Gleichaltrigen und die Bildungssituation. Es wird gezeigt, wie diese Faktoren die gesunde Entwicklung von Kindern gefährden und die Notwendigkeit von Schutzfaktoren unterstreichen.
5. Wie die Schule zum Schutzfaktor für arme Kinder werden kann: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie die Schule aktiv zur Förderung von Resilienz bei Kindern aus Armutsverhältnissen beitragen kann. Es diskutiert verschiedene Ansätze der Resilienzförderung auf verschiedenen Ebenen (Mehrebenen-Ansatz): gesamtschulisch, im Unterricht, durch Elterneinbindung und auf individueller Ebene. Verschiedene Programme und Strategien werden vorgestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Resilienz, Armut, Kinderarmut, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Schule, Resilienzförderung, Mehrebenen-Ansatz, Elterneinbindung, Lebenslagekonzept, pädagogische Interventionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Resilienzförderung bei Kindern aus Armutsverhältnissen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Schulen Kindern aus Armutsverhältnissen helfen können, Resilienz zu entwickeln und widrigen Lebensumständen zu begegnen. Der Fokus liegt auf der Rolle der Schule als Schutzfaktor für diese Hochrisikogruppe.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Resilienzkonzept, differenziert zwischen Risiko- und Schutzfaktoren und bezieht sich auf relevante Forschungsansätze und Studien wie die Kauai-Studie und die Mannheimer Risikokinderstudie. Der Wechselwirkungsprozess zwischen Risiko- und Schutzfaktoren wird ausführlich erläutert.
Wie wird Armut definiert und dargestellt?
Der Armutsbegriff wird definiert und die Armutssituation in Deutschland beleuchtet. Es wird zwischen relativer Armut und dem Lebenslagekonzept unterschieden, um die komplexen Zusammenhänge von Armut und deren Auswirkungen auf das Leben von Individuen zu verdeutlichen.
Welche Risikofaktoren werden im Zusammenhang mit Kinderarmut betrachtet?
Kinderarmut wird als Kumulation von Risikofaktoren analysiert. Betrachtet werden die materielle Situation, die Wohnsituation, Kontakte zu Gleichaltrigen und die Bildungssituation. Es wird gezeigt, wie diese Faktoren die gesunde Entwicklung von Kindern gefährden.
Wie kann die Schule zum Schutzfaktor werden?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze der Resilienzförderung in der Schule, basierend auf einem Mehrebenen-Ansatz: gesamtschulische Maßnahmen, Unterrichtsmethoden, Elterneinbindung und individuelle Unterstützung von Schülern. Konkrete Programme und Strategien werden vorgestellt und analysiert (z.B. „Starke Eltern - Starke Kinder“, „EFFEKT“, Grünkes Programm zur Förderung rationaler Denkmuster).
Welche konkreten Maßnahmen zur Resilienzförderung werden vorgeschlagen?
Es werden verschiedene Strategien auf unterschiedlichen Ebenen vorgestellt: gesamtschulische Projekte, Unterrichtsmethoden mit kindzentriertem Ansatz (Grotberg) oder Programmen wie dem von Julius und Goetze. Die Bedeutung von Elterntrainings und der beratend-unterstützenden Rolle von Lehrkräften wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die Elterneinbindung?
Die Elterneinbindung wird als essentieller Bestandteil der Resilienzförderung betrachtet. Es werden ressourcenstärkende Elterntrainings und die Rolle der Lehrkräfte in beratend-unterstützender Funktion diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Begriffe sind: Resilienz, Armut, Kinderarmut, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Schule, Resilienzförderung, Mehrebenen-Ansatz, Elterneinbindung, Lebenslagekonzept, pädagogische Interventionen.
Welche Studien werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf die Kauai-Studie und die Mannheimer Risikokinderstudie, um die Bedeutung von Schutzfaktoren für die Entwicklung von Resilienz zu belegen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie Schulen durch gezielte Maßnahmen und einen Mehrebenen-Ansatz als Schutzfaktoren für Kinder aus Armutsverhältnissen wirken und deren Resilienz fördern können. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Beseitigung von Armut, sondern auf der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Kinder.
- Arbeit zitieren
- Studienrat Sebastian Heil (Autor:in), 2014, Resilienz und Armut. Zur Rolle des Resilienzkonzepts bei SuS aus Armutsverhältnissen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388857