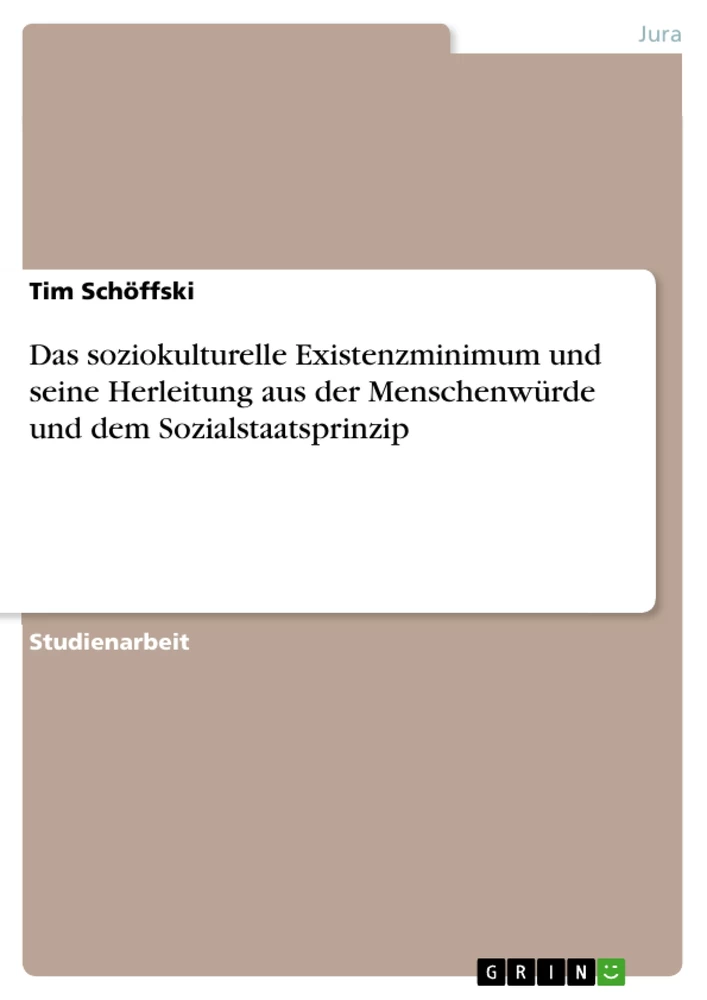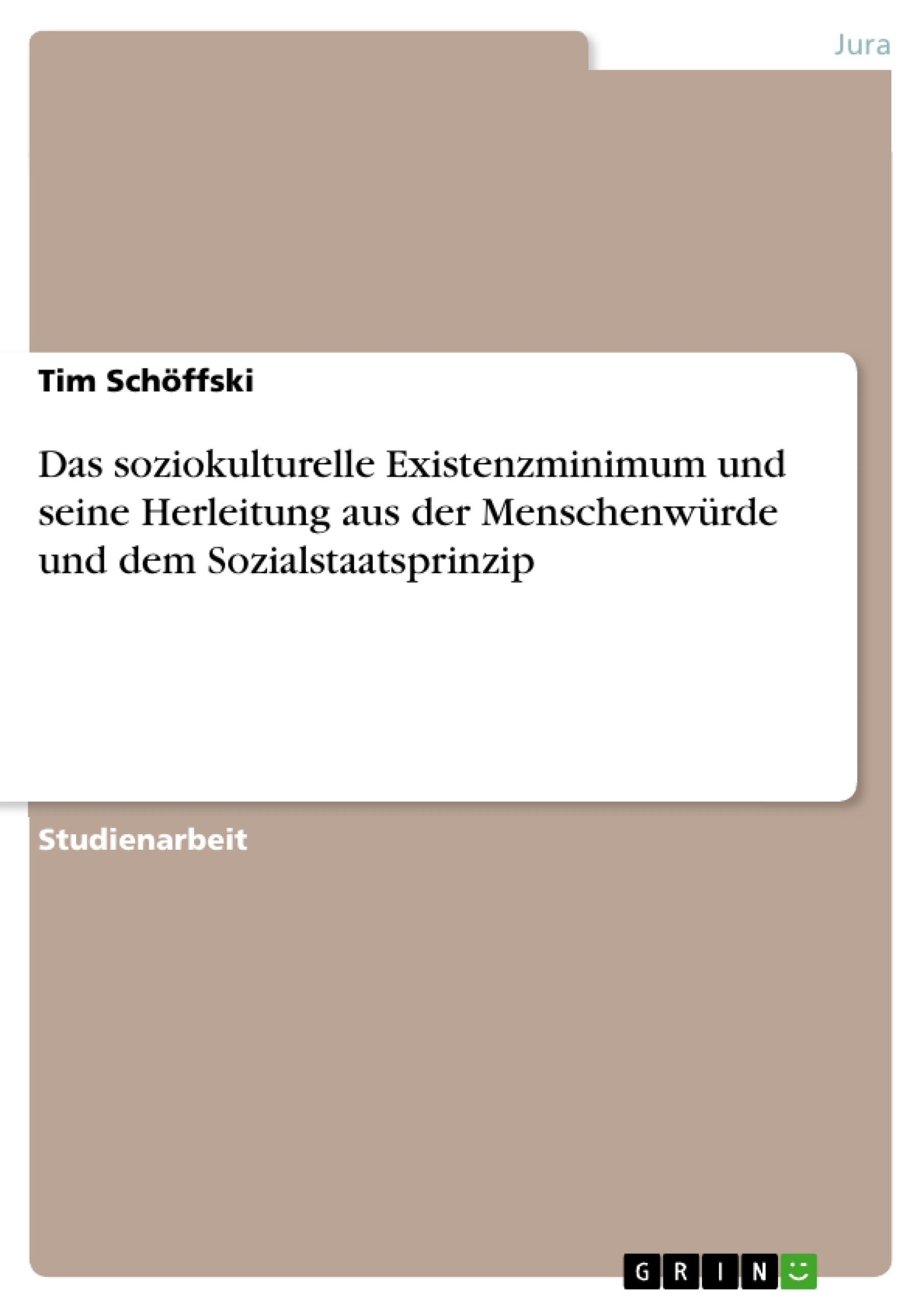"Der Mensch als Person existiert notwendig in sozialen Bezügen". Dieser prägnante Satz aus dem sog. "Hartz IV-Urteil" des Bundesverfassungsgerichts beschreibt sehr prägnant den Hintergrund der Thematik dieser Seminararbeit. Das Bundesverfassungsgericht hat im Rahmen der schon genannten Entscheidung und auch in seinem Urteil zum Asylbewerberleistungsgesetz das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums gem. Art. 1 I GG i.V.m. Art. 20 I GG herausgearbeitet.
Mit diesen Urteilen beendete das Gericht eine Diskussion, die man schon seit den Anfängen der BRD geführt hat, jedoch in dieser Deutlichkeit zuvor nicht thematisiert wurde. Die Bedeutung der Existenzsicherung des Einzelnen für das Funktionieren eines Staates wird auch daran deutlich, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem "Lissabon-Urteil" explizit darauf eingeht, dass die grundsätzlichen Entscheidungen der Sozialpolitik in der Gesetzgebungskompetenz der BRD verbleiben müssen und dabei speziell auf das Zusammenspiel von Art.1 I GG und Art. 20 I GG eingeht.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird nach einer Definition des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, eine kurze deskriptive Übersicht über die wichtigsten Entscheidungen in der Rechtsprechung zum Anspruch auf ein Existenzminimum gegeben werden. Dabei soll auch auf in der Literatur vertretene Ansichten eingegangen werden. Anschließend wird das in Frage stehende Grundrecht genauer analysiert, wobei eine Abgrenzung zwischen dem physischen und dem soziokulturellen Existenzminimum vorgenommen wird, um den genauen Schutzbereich des aus Art. 1 I GG i.V.m. Art. 20 I GG abgeleiteten Rechts zu bestimmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung in die Thematik...
- Definition des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums.
- Schutzbereich
- Verfassungsrechtliches Leistungsrecht
- Herleitung des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums in der Rechtsprechung und in der juristischen Literatur
- BVerfG, 1BvR 220/51, Beschluss vom 19.12.1951
- BVerwG V C 78/54, Urteil vom 24.06.1954.
- BVerfG, 1 BvL 4/74, Beschluss vom 18.06.1975.
- BVerfG, 1 BvL 20, 26, 184 und 4/86, Beschluss vom 29.05.1990
- BVerfG, 2 BvE 2/08, 2BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08, 2 BVR 182/09, Urteil vom 30.06.2009
- BVerfG, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, Urteil vom 09.02.2010.
- BVerfG, 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11, Urteil vom 18.07.2012
- Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums in der Literatur
- Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf Leben als Teil des Existenzminimums
- Gleichheitsrechtliche Aspekte des Existenzminimums.
- Abgrenzung des physischen Existenzminimums vom soziokulturellen Existenzminimum
- Physisches Existenzminimum.
- Soziokulturelles Existenzminimum
- Abhängigkeit von der „,sozialen Wirklichkeit“ in einer Gesellschaft und Ausgrenzungsverbot
- Individuelle Wahlfreiheit.
- Individualisierungsgrundsatz
- Subsidiarität des Existenzminimums
- Das soziokulturelle Existenzminimum als Sonderfall in der grundgesetzlichen Grundrechtsstruktur
- Grundrechte als Abwehrrechte gegenüber dem Staat
- Entstehungsgeschichtliche Gründe für das Fehlen von sozialen Grundrechten
- Grundrechtsstrukturelle Gründe für das Fehlen von sozialen Grundrechten
- Soziale Grundrechte im Grundgesetz
- Einfluss von internationalen und europäischen Verpflichtungen der BRD auf das soziokulturelle Existenzminimum
- EU-Grundrechtecharta (EU-GRCh)
- Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung (Art. 34 GRCh)
- Anwendungsbereich der Grundrechtecharta
- EMRK
- Soziale Grundrechte der EMRK
- Einfluss der EMRK-Wertungen auf die deutschen Grundrechte i.S.v. Art. 1-20 GG
- Europäische Sozialcharta (ESC)
- Bindungswirkung der ESC.
- Für das Existenzminimum relevante Garantien der ECS.
- Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR)
- Relevante Rechte des IPwskR
- Einfluss des IPwskR auf die Grundrechte des Grundgesetzes
- Kritische Würdigung der Herleitung des soziokulturellen Existenzminimums, mögliche Alternativen und Fazit
- Herleitung des soziokulturellen Existenzminimums.
- Mögliche Alternativen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem soziokulturellen Existenzminimum und seiner Herleitung aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip. Sie analysiert die rechtliche Begründung und die Kritik am soziokulturellen Existenzminimum im Kontext der deutschen Grundrechtsordnung und der internationalen Menschenrechtsstandards.
- Die Definition und der Schutzbereich des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums
- Die Herleitung des Grundrechts aus der Rechtsprechung und der juristischen Literatur
- Die Abgrenzung des physischen vom soziokulturellen Existenzminimum
- Die Stellung des soziokulturellen Existenzminimums im Rahmen der grundgesetzlichen Grundrechtsstruktur
- Der Einfluss internationaler und europäischer Verpflichtungen auf das soziokulturelle Existenzminimum
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung bietet einen Überblick über die Thematik und die Relevanz des soziokulturellen Existenzminimums in der heutigen Gesellschaft.
- Kapitel 2: Die Definition des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums und seine Bedeutung für den Schutzbereich des Einzelnen werden dargestellt.
- Kapitel 3: Die Herleitung des Grundrechts in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und in der juristischen Literatur wird beleuchtet.
- Kapitel 4: Die Abgrenzung des physischen vom soziokulturellen Existenzminimum wird anhand verschiedener Kriterien vorgenommen.
- Kapitel 5: Die Stellung des soziokulturellen Existenzminimums im Rahmen der grundgesetzlichen Grundrechtsstruktur wird untersucht, wobei die historischen und strukturellen Gründe für das Fehlen von sozialen Grundrechten im Grundgesetz berücksichtigt werden.
- Kapitel 6: Der Einfluss von internationalen und europäischen Verpflichtungen auf das soziokulturelle Existenzminimum wird analysiert, wobei die EU-Grundrechtecharta, die EMRK, die Europäische Sozialcharta und der IPwskR im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Menschenwürde, Sozialstaatsprinzip, Existenzminimum, Grundrechte, soziale Grundrechte, Abwehrrechte, Abgrenzung, physisches und soziokulturelles Existenzminimum, internationale Menschenrechtsstandards, EU-Grundrechtecharta, EMRK, Europäische Sozialcharta, IPwskR.
- Citar trabajo
- Tim Schöffski (Autor), 2014, Das soziokulturelle Existenzminimum und seine Herleitung aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387282