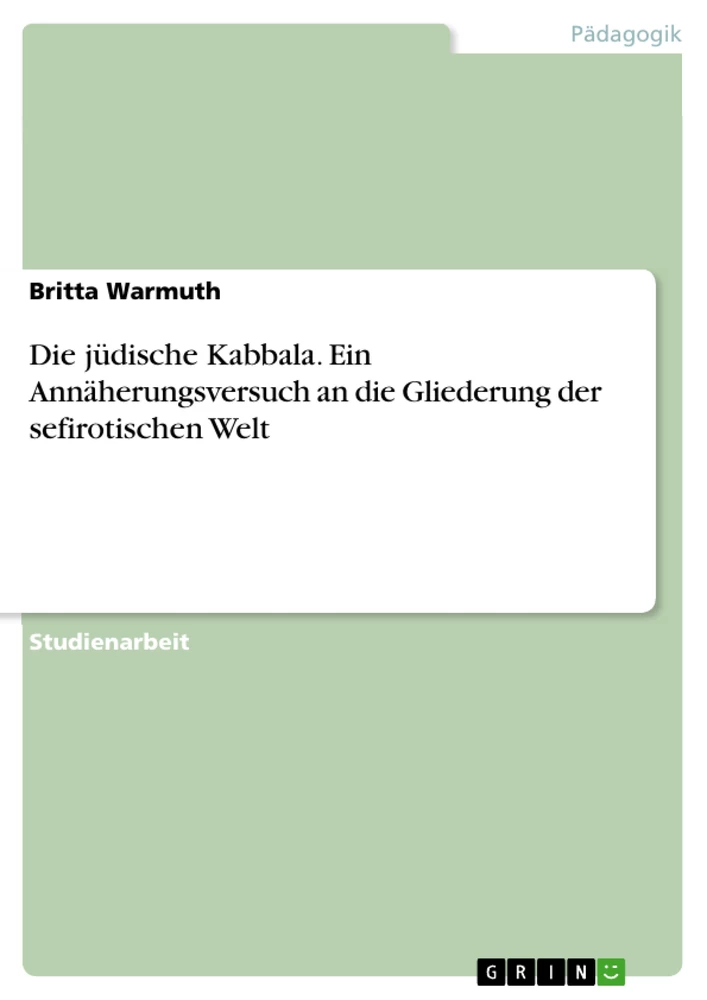Kabbala – aus dem hebräischen von "qabbada" = Empfangenes, Tradition – ist die klassische jüdische Mystik, wie sie sich ab dem 12. Jahrhundert aus antiken Wurzeln und unter dem Einfluss der neoplatonischen Emanationslehre in Spanien und der Provence entwickelte.
Parallel zu der jüdischen Mystik bildete sich im mittelalterlichen Judentum die jüdische Religionsphilosophie mit Rückgriff auf das aristotelische Denken heraus. "Dem Philosophen geht es darum, Gott zutreffend zur Sprache zu bringen, was letztlich darauf hinausläuft, ihn von allen menschlichen Zügen zu transzendieren. Dem Mystiker hingegen ist es darum zu tun, eine Begegnung (wenn nicht gar Vereinigung) zwischen Mensch und Gott zu denken, er muss also irgendeine Art von Immanenz Gottes begründen."
Die Anfänge der jüdischen Kabbala liegen im 12. Jahrhundert mit dem Buch Bahir, lange Zeit Hauptgrundlage der danach allmählich verschriftlichten kabbalistischen "Geheimlehre". Mystische Strömungen gab es schon davor und so greift auch das Buch Bahir dieses Denken auf und geht zurück auf ältere Formen (Merkaba, Hekhalotliteratur, Buch Ezechiel).
Dabei enthält dieses Buch nur streckenweise das Neue, also Aussagen über Symbole und Funktionen, welche die 10 göttlichen Wirkungskräfte betreffen. Erst mit dem Sohar, der als Hauptwerk der Kabbala gilt, wurde dies strukturell ergänzt und ein ziemlich fixiertes Grundschema konstruiert, quasi eine Leseschablone oder Deutungsfolie für kabbalistische Texte entwickelt
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die jüdische Kabbala
- Der Sohar, das Buch des Glanzes
- Ez Chajim – der kabbalistische Baum des Lebens
- Ejn-Sof
- Das System der 10 Sefirot
- Lurianische Kabbala
- Zusammenfassung
- Persönliche Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, die komplexe Denkweise der jüdischen Kabbala zu ordnen und verständlich zu machen, insbesondere die 10 Sefirot und ihre Bedeutung. Ziel ist es, ein besseres Verständnis der göttlichen Welt und ihrer Verbindung zur Schöpfung zu vermitteln und auf mögliche Fragen im Unterricht vorbereitet zu sein. Die Arbeit betrachtet die Kabbala nicht als esotherische Praxis, sondern als ein System zur Interpretation der göttlichen Wirklichkeit.
- Die Anfänge und Entwicklung der jüdischen Kabbala
- Der Sohar als zentrales Werk der Kabbala
- Das System der 10 Sefirot und ihre Bedeutung
- Der Gegensatz zwischen philosophischer und mystischer Gotteserkenntnis
- Die Interpretation biblischer Texte in der Kabbala
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den persönlichen Hintergrund der Arbeit und die Motivation, sich mit der Kabbala auseinanderzusetzen. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, die Kabbala für den Unterricht verständlich aufzubereiten, und dem Wunsch, das Verständnis der 10 Sefirot zu vertiefen. Die Arbeit betont den nicht-esotherischen Aspekt der Kabbala und ihr Streben nach einem Verständnis der göttlichen Welt.
Die jüdische Kabbala: Dieses Kapitel liefert einen kurzen Überblick über die Entstehung und Entwicklung der jüdischen Kabbala ab dem 12. Jahrhundert. Es wird der Unterschied zwischen der jüdischen Religionsphilosophie und der jüdischen Mystik herausgestellt, wobei die erstere Gott transzendiert, während letztere eine Begegnung mit Gott anstrebt. Die Anfänge der Kabbala werden im Buch Bahir verortet, dessen Bedeutung jedoch erst durch das spätere Hauptwerk, den Sohar, vollends entfaltet wird.
Der Sohar, das Buch des Glanzes: Dieses Kapitel behandelt den Sohar als das zentrale Werk der Kabbala, beschreibt seine Entstehungsgeschichte und Methodik (Midrasch-Methode). Es hebt hervor, dass der Sohar die Gottheit als einen dynamischen Fluss von Kräften beschreibt und dass die kabbalistische Auslegung der Bibel nicht den historischen Wortsinn, sondern eine weitergehende, symbolische Realität sucht. Die Interpretation der Schrift zielt darauf ab, verborgene Vorgänge in der Gottheit selbst zu entdecken.
Ez Chajim – der kabbalistische Baum des Lebens: Dieses Kapitel erklärt den Ez Chajim, den Baum des Lebens, als Struktur der 10 Sefirot und erläutert, wie dieses Modell die göttliche Schöpfung im Mikro- und Makrokosmos widerspiegelt. Es wird betont, dass die Sefirot rein geistige Welten darstellen, und dass die unterschiedlichen Erscheinungen in den 10 Sefirot letztendlich auf den einen Gott (Ejn Sof) zurückzuführen sind.
Ejn-Sof: Dieses Kapitel beschreibt den nicht-offenbarbaren Aspekt Gottes, Ejn Sof ("ohne Ende"), im Kontext der neoplatonischen Emanationslehre und der aristotelischen Philosophie. Ejn Sof transzendiert die allgemeine menschliche Erkenntnis und ist das unwandelbare Unendliche.
Schlüsselwörter
Jüdische Kabbala, Sohar, Sefirot, Ejn Sof, Mystik, Gotteserkenntnis, Bibelinterpretation, Ez Chajim, Emanationslehre, Midrasch-Methode.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Jüdische Kabbala
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über die jüdische Kabbala. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf die Erklärung der 10 Sefirot und deren Bedeutung im Kontext der göttlichen Schöpfung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung der jüdischen Kabbala, das zentrale Werk den Sohar, das System der 10 Sefirot (Ez Chajim – der kabbalistische Baum des Lebens), den Begriff Ejn Sof (das Unendliche), den Gegensatz zwischen philosophischer und mystischer Gotteserkenntnis und die kabbalistische Bibelinterpretation.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, die komplexe Denkweise der jüdischen Kabbala zu ordnen und verständlich zu machen. Sie möchte ein besseres Verständnis der göttlichen Welt und ihrer Verbindung zur Schöpfung vermitteln und auf mögliche Fragen im Unterricht vorbereiten. Der Fokus liegt auf einer nicht-esoterischen Interpretation der Kabbala als System zur Interpretation der göttlichen Wirklichkeit.
Welche Bedeutung hat der Sohar in der Seminararbeit?
Der Sohar, das „Buch des Glanzes“, wird als zentrales Werk der Kabbala behandelt. Die Arbeit beschreibt seine Entstehungsgeschichte und Methodik (Midrasch-Methode) und erklärt, wie der Sohar die Gottheit als dynamischen Fluss von Kräften beschreibt und die Bibel in symbolischer Weise interpretiert, um verborgene Vorgänge in der Gottheit selbst zu entdecken.
Was sind die 10 Sefirot und ihre Bedeutung?
Die 10 Sefirot werden im Kontext des „Baumes des Lebens“ (Ez Chajim) erläutert. Sie repräsentieren geistige Welten und spiegeln die göttliche Schöpfung im Mikro- und Makrokosmos wider. Die Arbeit betont, dass die unterschiedlichen Erscheinungen in den 10 Sefirot letztendlich auf den einen Gott (Ejn Sof) zurückzuführen sind.
Was ist Ejn Sof?
Ejn Sof („ohne Ende“) beschreibt den nicht-offenbarbaren Aspekt Gottes. Im Kontext der neoplatonischen Emanationslehre und der aristotelischen Philosophie wird Ejn Sof als das unwandelbare Unendliche dargestellt, das die allgemeine menschliche Erkenntnis transzendiert.
Welche Methode der Bibelinterpretation wird in der Kabbala verwendet?
Die Kabbala verwendet eine symbolische und nicht-historische Methode der Bibelinterpretation (Midrasch-Methode). Sie sucht nicht den historischen Wortsinn, sondern eine weitergehende, symbolische Realität, um verborgene Vorgänge in der Gottheit selbst zu entdecken.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Seminararbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Jüdische Kabbala, Sohar, Sefirot, Ejn Sof, Mystik, Gotteserkenntnis, Bibelinterpretation, Ez Chajim, Emanationslehre, Midrasch-Methode.
- Citar trabajo
- Britta Warmuth (Autor), 2009, Die jüdische Kabbala. Ein Annäherungsversuch an die Gliederung der sefirotischen Welt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386906