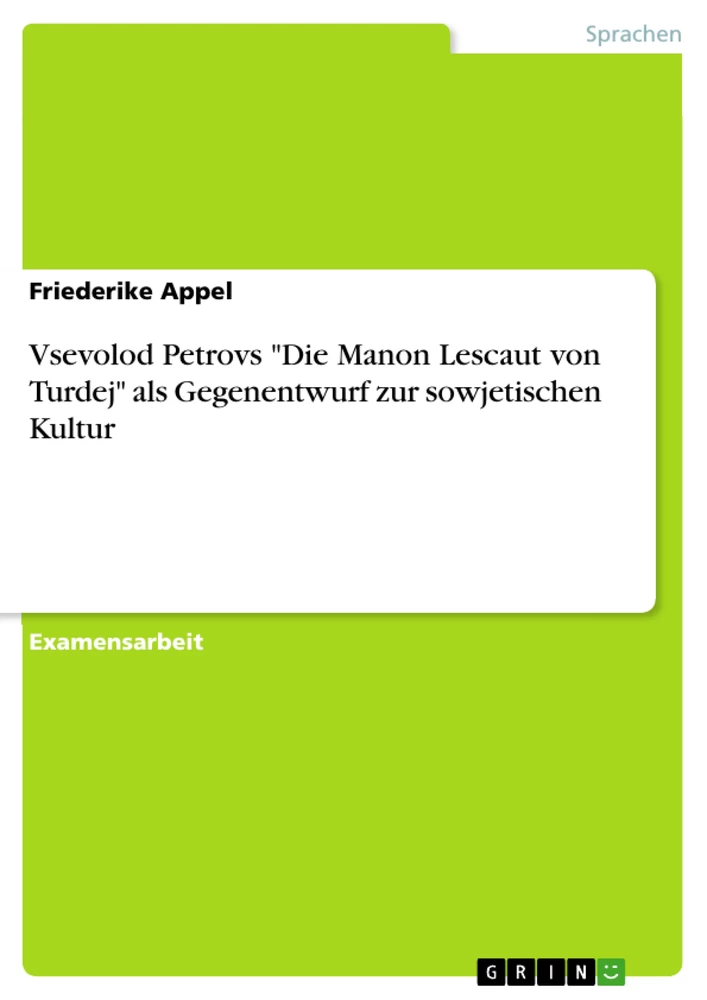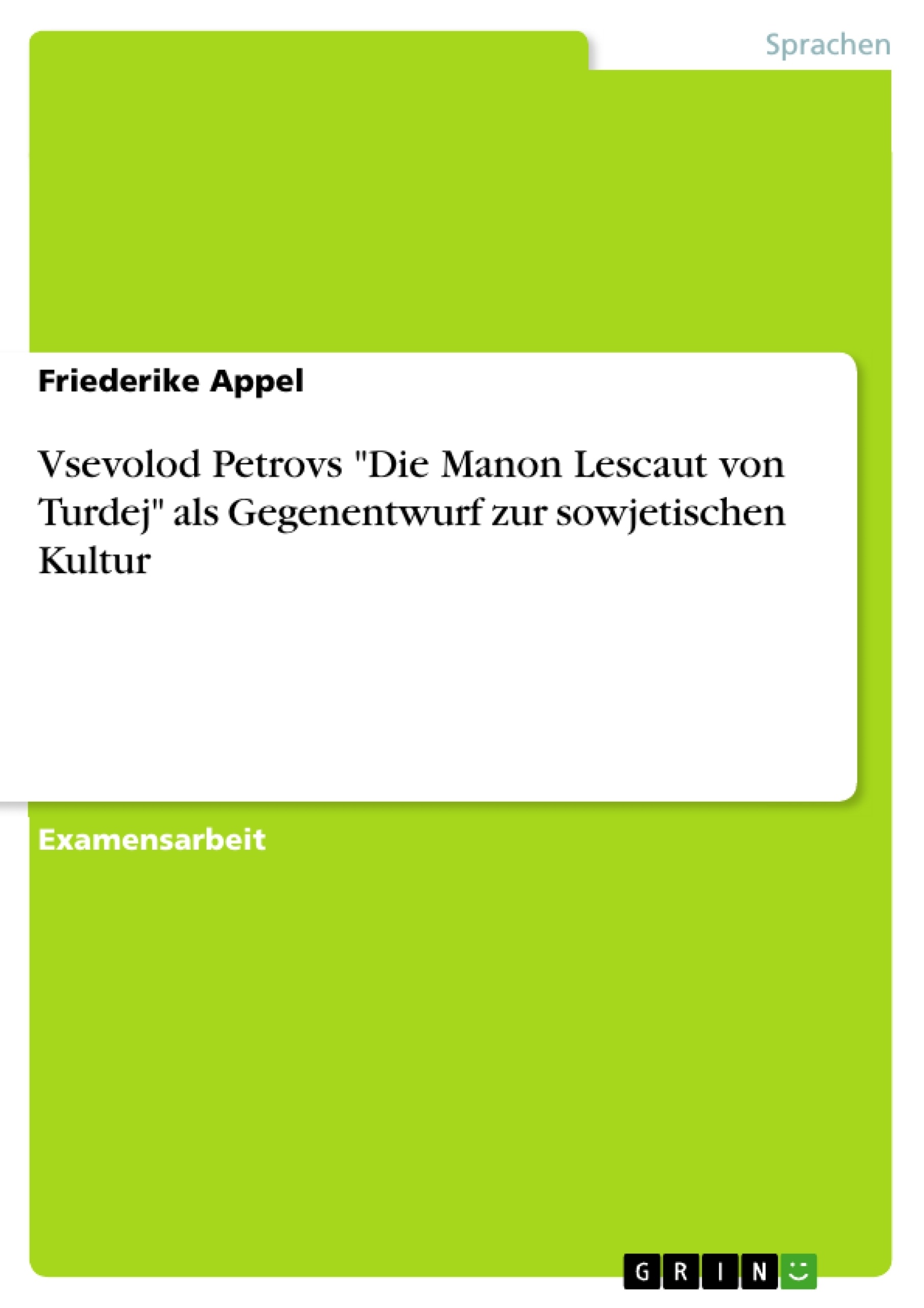Vesevolod Petrov veröffentlichte seine kurze Novelle "Die Manon Lescaut von Turdej" nie. Sie ist sein einziges literarisches Werk, denn eigentlich war er Kunsthistoriker. Er las sie nur ausgewählten Freunden an seinen Geburtstagen vor. Es hat seine Gründe, dass er gar nicht erst versuchte, den Text während der Sowjetzeit zu veröffentlichen: Obwohl man den Roman auf der Oberfläche als schöne, leicht lesbare Liebesgeschichte lesen kann, die zur Zeit des zweiten Weltkriegs in einem Lazarettzug spielt, ist er ein einziger Protest gegen die offizielle Kultur der Sowjetzeit. Zwischen den Zeilen kritisiert Petrov seine Zeit und nimmt stattdessen Bezug auf vergangene Autoren und Motive der russischen Literatur, so dass klar hervorgeht, was er für die eigentliche kulturelle Blüte Russlands hält.
Der Text erschien erst 2006 in einer russischen Literaturzeitung und löste sowohl in Russland als auch in deutscher Übersetzung eine Welle der Begeisterung aus. Damit gehört er einer Gruppe von Texten an, die zur Untergrundliteratur gehören, aber nicht im Ausland und nicht im Samisdat (also illegal kopiert und weitergegeben) veröffentlicht wurden und in den letzten Jahren bekannt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Veröffentlichungs- und Rezeptionsgeschichte
- 1.2. Analyse der intertextuellen Bezüge als Interpretationsgrundlage
- 2. Formale Struktur
- 2.1. Titel
- 2.2. Widmung
- 2.3. Motto
- 2.4. Gattungszugehörigkeit
- 2.5. Erzählperspektive
- 2.6. Raum- und Zeit
- 2.7. Zielpublikum
- 2.8. Stilistik
- 3. Identitätskonstruktionen
- 3.1. Der Ich-Erzähler
- 3.2. Typus des überflüssigen Menschen
- 3.3. Ich fremd in der Welt
- 3.4. Vera - Allegorie der Liebe
- 3.5. Nina Alekseevna als Korrektiv
- 4. Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus
- 4.1. Replik auf Vera Panovas „Weggenossen“
- 4.2. Ideologisch: Abwesenheit von Autoritäten
- 4.3. Menschenbild: Individualität statt Kollektiv
- 4.4. Geschlechterrollen: Gegen die Utopie der Gleichheit
- 4.5. Poetologisch: Geniekult gegen Dichterschulen
- 5. Metadiskurse über Kunst
- 5.1. Verhältnis von Realität und Fiktion
- 5.2. Das 18. Jahrhundert als ideales Zeitalter
- 5.3. Goethes Werther
- 5.4. Die Welt als Bühne
- 5.5. Die Welt als Verweissystem
- 5.6. Genietheorien
- 6. Existentielle Thematiken
- 6.1. Tod und Transzendenz
- 6.2. Leichtlebige und zugleich schwere Liebe
- 6.3. Russlandbild
- 7. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Vsevolod Petrovs Novelle „Die Manon Lescaut von Turdej“ als literarischen und ideologischen Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus. Die Analyse fokussiert auf die intertextuellen Bezüge und deren Bedeutung für das Verständnis des Textes. Ziel ist es, die zentralen Themen und die künstlerischen Mittel Petrovs aufzuzeigen und dessen Stellung innerhalb der russischen Literaturgeschichte zu beleuchten.
- Intertextualität und literarische Tradition
- Der Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus
- Identitätskonstruktionen im Kontext der sowjetischen Gesellschaft
- Existentielle Fragen nach Liebe, Tod und dem Sinn des Lebens
- Die Darstellung von Russland und die kulturelle Orientierung am Westen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Veröffentlichungs- und Rezeptionsgeschichte von Petrovs Novelle, beleuchtet deren Faszination für heutige Leser und führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: die Analyse der intertextuellen Bezüge als Interpretationsgrundlage. Der Kontext der Entstehung im Stalinismus und der spätere Erfolg in Russland werden hervorgehoben. Die Novelle wird als schlichte Liebesgeschichte beschrieben, die gleichzeitig einen vielschichtigen und kunstvollen Widerspruch zum sozialistischen Realismus darstellt.
2. Formale Struktur: Dieses Kapitel beschreibt die formalen Aspekte der Novelle, einschließlich Titel, Widmung, Motto, Gattung, Erzählperspektive, Raum und Zeit, Zielpublikum und Stilistik. Die Analyse dieser Elemente liefert wichtige Hinweise auf Petrovs Intentionen und die Einordnung seines Werkes in den literarischen Kontext.
3. Identitätskonstruktionen: Dieser Abschnitt untersucht die verschiedenen Identitäten im Werk, besonders die des Ich-Erzählers, seine Position als „überflüssiger Mensch“, seine Fremdheit in der Welt, und die Rolle von Vera als Allegorie der Liebe sowie Nina Alekseevna als Gegenpol. Die Analyse dieser Konstruktionen zeigt die Suche nach Identität und Zugehörigkeit im Kontext der sowjetischen Gesellschaft.
4. Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus: Dieses Kapitel analysiert die Novelle als expliziten Gegenentwurf zum sozialistischen Realismus, indem es die Abwesenheit von Autoritäten, die Betonung von Individualität statt Kollektiv, die kritische Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und die Betonung des Geniekults anstatt von Dichterschulen beleuchtet. Es werden die Unterschiede zu der sozialistischen Literatur herausgearbeitet.
5. Metadiskurse über Kunst: Dieses Kapitel befasst sich mit Petrovs Reflexionen über Kunst im Werk. Es untersucht das Verhältnis von Realität und Fiktion, die Idealsierung des 18. Jahrhunderts, die Verwendung von Werken wie Goethes Werther als Referenzpunkte sowie die Betrachtung der Welt als Bühne und Verweissystem. Die Genietheorien werden ebenfalls in die Diskussion einbezogen.
6. Existentielle Thematiken: Der letzte inhaltstragende Abschnitt beleuchtet existenzielle Themen wie Tod und Transzendenz, die komplexe Darstellung der Liebe und das Russlandbild der Novelle. Die Kapitel analysieren die Darstellung dieser Themen in Bezug auf den historischen Kontext und den literarischen Stil.
Schlüsselwörter
Vsevolod Petrov, Die Manon Lescaut von Turdej, Sozialistischer Realismus, Intertextualität, Identität, Liebe, Tod, Russlandbild, 18. Jahrhundert, Moderne, Symbolismus, Gegenkultur, Petersburger Intellektuelle, Westler.
Häufig gestellte Fragen zu Vsevolod Petrovs „Die Manon Lescaut von Turdej“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Vsevolod Petrovs Novelle „Die Manon Lescaut von Turdej“ als literarischen und ideologischen Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus. Der Fokus liegt auf den intertextuellen Bezügen und deren Bedeutung für das Verständnis des Textes. Ziel ist die Darstellung der zentralen Themen und künstlerischen Mittel Petrovs sowie die Beleuchtung seiner Stellung in der russischen Literaturgeschichte.
Welche Themen werden in der Novelle behandelt?
Die Novelle behandelt zentrale Themen wie Intertextualität und literarische Tradition, den Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus, Identitätskonstruktionen im Kontext der sowjetischen Gesellschaft, existenzielle Fragen nach Liebe, Tod und dem Sinn des Lebens sowie die Darstellung Russlands und die kulturelle Orientierung am Westen.
Welche Aspekte der formalen Struktur werden analysiert?
Die Analyse der formalen Struktur umfasst Titel, Widmung, Motto, Gattungszugehörigkeit, Erzählperspektive, Raum und Zeit, Zielpublikum und Stilistik der Novelle. Diese Elemente liefern Hinweise auf Petrovs Intentionen und die Einordnung seines Werkes in den literarischen Kontext.
Wie werden Identitätskonstruktionen dargestellt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Identitäten im Werk, insbesondere die des Ich-Erzählers als „überflüssiger Mensch“, seine Fremdheit in der Welt, Vera als Allegorie der Liebe und Nina Alekseevna als Gegenpol. Die Analyse zeigt die Suche nach Identität und Zugehörigkeit im Kontext der sowjetischen Gesellschaft.
Inwiefern stellt die Novelle einen Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus dar?
Die Novelle wird als expliziter Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus analysiert, indem die Abwesenheit von Autoritäten, die Betonung von Individualität statt Kollektiv, die kritische Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und der Geniekult anstatt von Dichterschulen beleuchtet werden. Die Unterschiede zur sozialistischen Literatur werden herausgearbeitet.
Welche Metadiskurse über Kunst werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Petrovs Reflexionen über Kunst, untersucht das Verhältnis von Realität und Fiktion, die Idealsierung des 18. Jahrhunderts, die Verwendung von Werken wie Goethes Werther als Referenzpunkte sowie die Betrachtung der Welt als Bühne und Verweissystem. Genietheorien werden ebenfalls diskutiert.
Welche existentiellen Thematiken werden in der Novelle behandelt?
Die Novelle beleuchtet existenzielle Themen wie Tod und Transzendenz, die komplexe Darstellung der Liebe und das Russlandbild. Die Darstellung dieser Themen wird in Bezug auf den historischen Kontext und den literarischen Stil analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vsevolod Petrov, Die Manon Lescaut von Turdej, Sozialistischer Realismus, Intertextualität, Identität, Liebe, Tod, Russlandbild, 18. Jahrhundert, Moderne, Symbolismus, Gegenkultur, Petersburger Intellektuelle, Westler.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur formalen Struktur, Identitätskonstruktionen, dem Gegenentwurf zum Sozialistischen Realismus, Metadiskursen über Kunst, existentiellen Thematiken und einen Schluss.
Wo finde ich weitere Informationen zur Veröffentlichungs- und Rezeptionsgeschichte?
Die Einleitung der Arbeit präsentiert die Veröffentlichungs- und Rezeptionsgeschichte von Petrovs Novelle, beleuchtet deren Faszination für heutige Leser und führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein.
- Quote paper
- Friederike Appel (Author), 2016, Vsevolod Petrovs "Die Manon Lescaut von Turdej" als Gegenentwurf zur sowjetischen Kultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386098