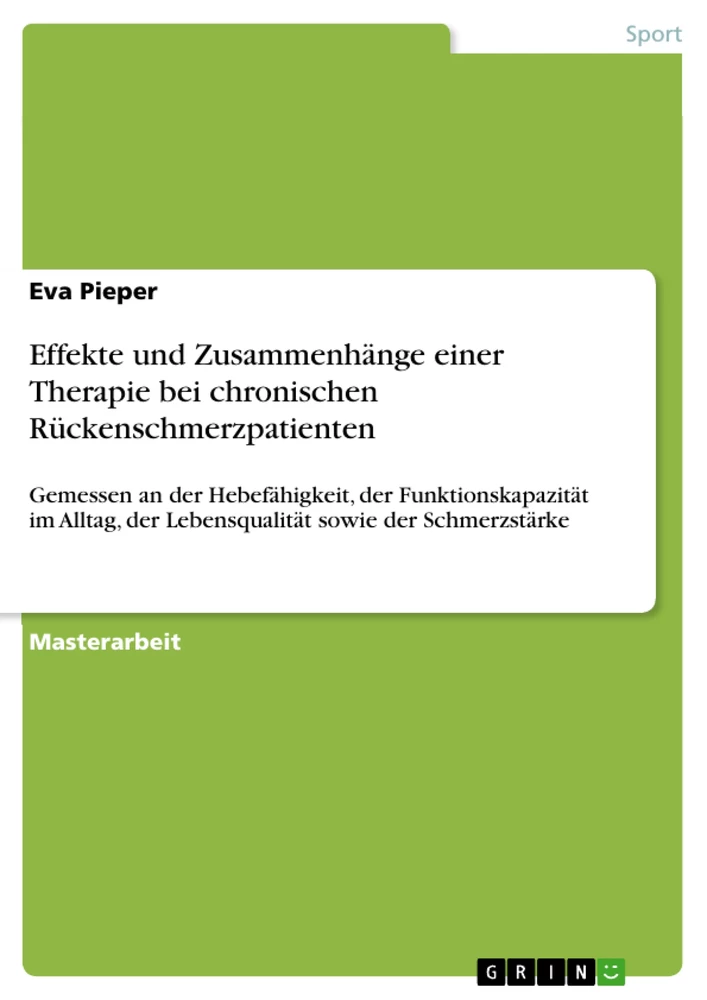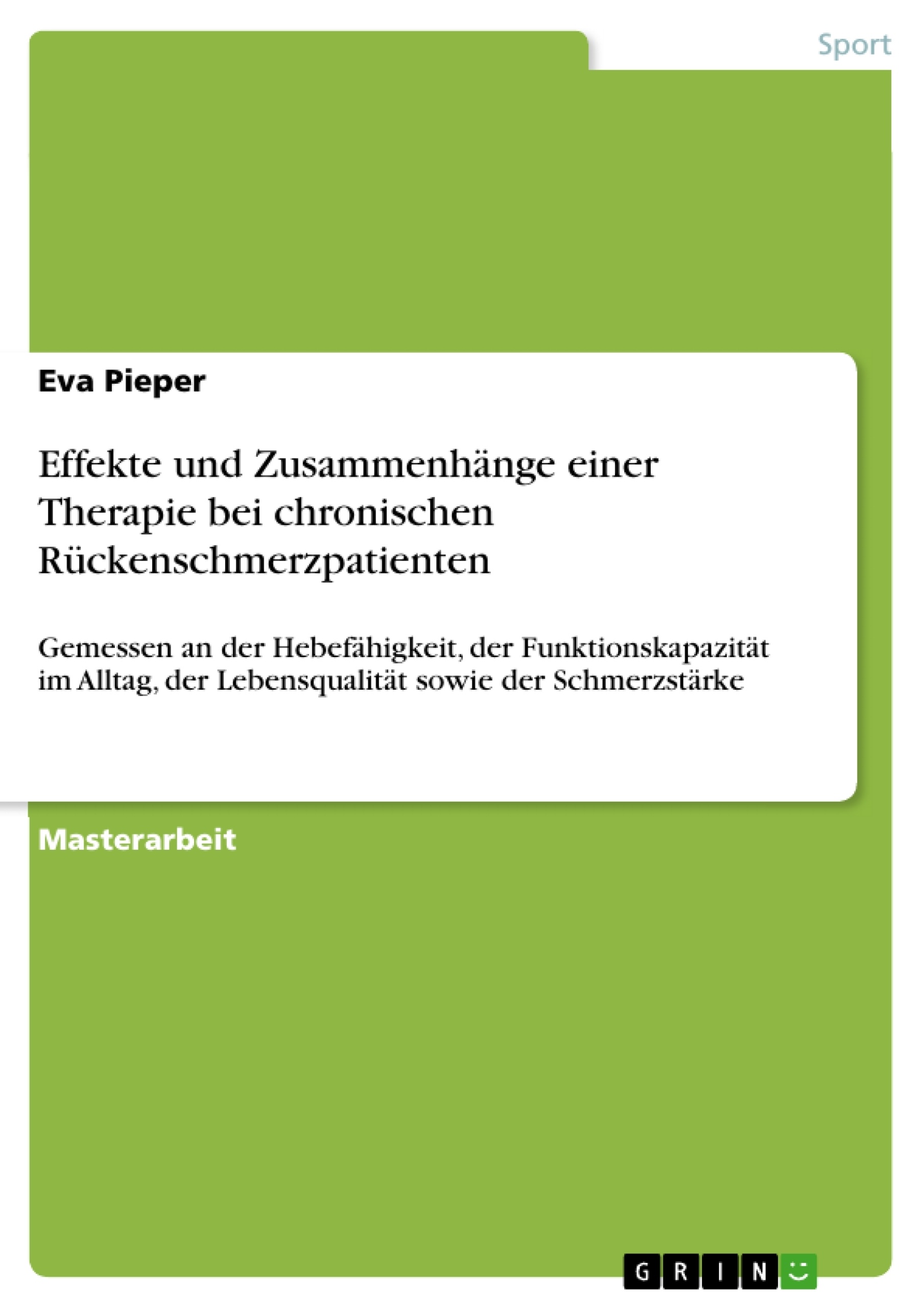Rückenschmerzen im unteren Rücken spielen heutzutage bei der deutschen Bevölkerung eine zunehmend große Rolle. Nachdem im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wenig über Rückenschmerzen dokumentiert wurde, gaben bis zu 85 % der Teilnehmer der deutschen Rückenschmerzstudie im Jahr 2003 an, mindestens einmal im Leben an Schmerzen des Rückens gelitten zu haben. Während des vorangegangenen Jahres litten alleine 56 % der Männer und 66 % der befragten Frauen bei einer Umfrage des Robert- Koch-Instituts an Rückenscherzen. 30-40 % aller Erwachsenen in Deutschland leiden aktuell unter Rückenschmerzen von mittlerer Intensität und 10 % dieser Bevölkerung leiden an schweren, chronischen und behandlungsbedürftigen Rückenschmerzen. Davon betreffen 2/3 aller Fälle die Lendenwirbelsäule und etwa 1/3 die Halswirbelsäule. Schmerzen in der Brustwirbelsäule machen nur etwas 2% aus. Neben anderen, weit verbreiteten Krankheiten wie Bluthochdruck, Fehlsichtigkeit und Stoffwechselstörungen ist der Rückenschmerz die häufigste Diagnose. Knapp 30 % aller Rückenschmerzen chronifizieren. Dies wird in der Literatur als „chronic low back pain“ bezeichnet. Laut aktueller Literatur kann man ab rund 3 Monaten des regelmäßigen Schmerzes von chronischen Schmerz sprechen. Trotz vielseitigem Bemühen seitens der Wissenschaft bleiben die meisten Fragen bezüglich Ursache, Risiko und Prognose offen. Die Pathophysiologie wird in nur wenigen Bereichen verstanden. Bei circa 80 % der Rückenschmerzpatienten ist die Ursache der Schmerzen unklar. Es besteht jedoch Konsens darüber, dass meist eine komplexe Problematik vorliegt. Diese besteht aus einem Mix von physiologisch- organischen Quellen, kognitiven und emotionalen sowie sozialen und verhaltensbedingten Faktoren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Grundlegende Theorie und Definitionen
- 2.1.1 Rückenschmerzen
- 2.1.2 Sportwissenschaftliche Grundlagen
- 2.1.3 Rückenschmerzen und mögliche physiologische Zusammenhänge
- 2.2 Therapieansatz bei chronischen Rückenschmerzen
- 2.2.1 Multimodale Interdisziplinäre Schmerztherapie
- 2.2.2 Ziele einer multimodalen, interdisziplinären Schmerztherapie
- 2.2.3 Evidenz multidisziplinärer Therapien
- 2.4 Multimodale interdisziplinäre Therapie als Intervention
- 2.4.1 Intervention
- 2.4.2 Work-Hardening
- 2.5 Zur Fragestellung
- 2.5.1 Forschungsstand und Erkenntnisse der untersuchten Parameter
- 2.5.2 Fragestellungen
- 3 Methoden
- 3.1 Hypothesen, Studiendesign und Untersuchungsplanung
- 3.1.1 Hypothesen
- 3.1.2 Studiendesign
- 3.1.3 Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien
- 3.1.4 Variablen
- 3.1.5 Zeitplan
- 3.1.6 Setting
- 3.2 Parameter und Testverfahren
- 3.2.1 Progressive Isoinertial Lifting Evaluation (PILE)
- 3.2.2 Funktionsfragebogen Hannover (FFbH-R)
- 3.2.3 Short Form-36 (SF-36)
- 3.2.4 Schmerzstärke: Numerische Rating-Skala (NRS)
- 3.3 Datengewinnung
- 3.3.1 Erhebung
- 3.3.2 Aufbereitung
- 3.3.3 Auswertung
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Stichprobe
- 4.2 Erhebungszeitraum 1
- 4.2.1 Deskriptive Statistik
- 4.2.2 Schließende Statistik: Korrelationen
- 4.3 Erhebungszeitraum 2
- 4.3.1 Deskriptive Statistik
- 4.3.2 Schließende Statistik: Korrelationen
- 4.4 Veränderungen vom 1. zum 2. Erhebungszeitraum
- 4.4.1 Deskriptive Statistik
- 4.4.2 Schließende Statistik: Mittelwertunterschiede
- 4.5 Zusätzliche Auswertungen
- 5 Diskussion
- 5.1 Einordnung der Ergebnisse in die aktuelle Forschung: Zusammenhänge der Parameter
- 5.2 Einordnung der Ergebnisse in die aktuelle Forschung: Veränderungen der Parameter
- 5.3 Weitere Schlussfolgerungen
- 5.4 Mögliche Erklärungsansätze
- 5.5 Methodenkritik
- 5.6 Ausblick
- 6 Zusammenfassung
- Zusammenhänge zwischen multimodaler, interdisziplinärer Therapie und den untersuchten Parametern
- Veränderungen der Parameter im Laufe der Therapie
- Mögliche Erklärungsansätze für die beobachteten Ergebnisse
- Methodische Aspekte der Studie und deren Limitationen
- Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Auswirkungen einer multimodalen, interdisziplinären Therapie auf verschiedene Parameter bei chronischen Rückenschmerzpatienten. Die Arbeit zielt darauf ab, die Effekte der Therapie auf die Hebefähigkeit, die Funktionskapazität im Alltag, die Lebensqualität und die Schmerzstärke zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Problematik von chronischen Rückenschmerzen und die Bedeutung einer effektiven Therapie dar. Kapitel 2 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen und Definitionen von Rückenschmerzen, den sportwissenschaftlichen Grundlagen und möglichen physiologischen Zusammenhängen. Es erläutert den Ansatz der multimodalen, interdisziplinären Schmerztherapie und deren Ziele, sowie die Evidenz multidisziplinärer Therapien. Kapitel 3 beschreibt die Methoden der Studie, einschließlich der Hypothesen, des Studiendesigns, der Variablen, der Parameter und Testverfahren sowie der Datengewinnung. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Studie, unterteilt in deskriptive und schließende Statistiken für beide Erhebungszeiträume, sowie die Veränderungen zwischen den Zeiträumen. Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Studie, ordnet sie in den aktuellen Forschungsstand ein, zieht weitere Schlussfolgerungen, beleuchtet mögliche Erklärungsansätze und kritisiert die Methoden der Studie. Schließlich gibt Kapitel 5 einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Chronische Rückenschmerzen, multimodale, interdisziplinäre Therapie, Hebefähigkeit, Funktionskapazität, Lebensqualität, Schmerzstärke, PILE, FFbH, SF-36, NRS, Forschungsstand, Evidenz, Methodenkritik, Ausblick.
- Citar trabajo
- Eva Pieper (Autor), 2017, Effekte und Zusammenhänge einer Therapie bei chronischen Rückenschmerzpatienten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386054