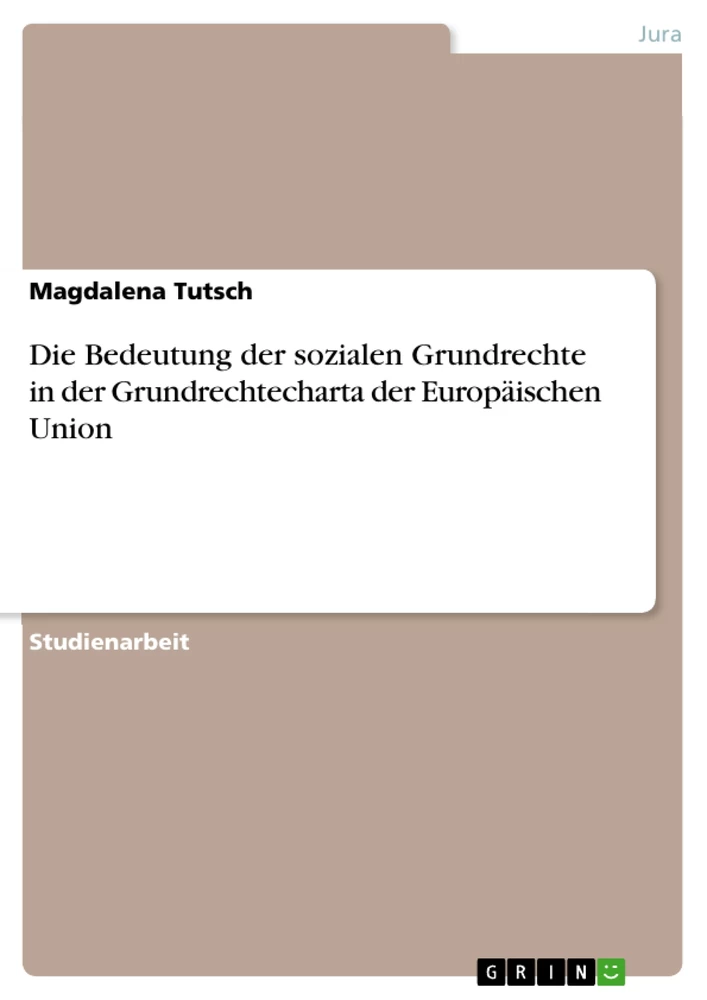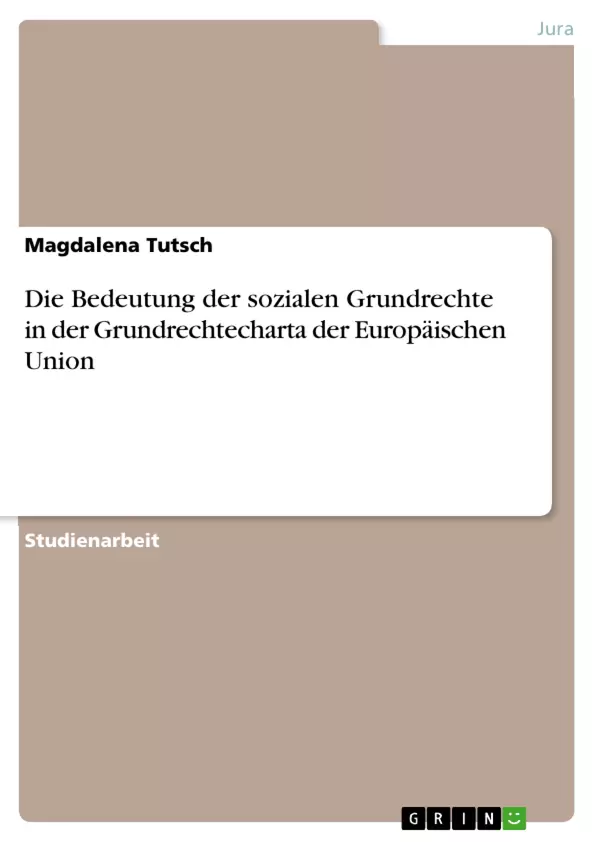Die Europäische Union muss sich derzeit vielen außen- und innenpolitischen Herausforderungen stellen: Flüchtlingskrise, Bedrohung durch den IS, der Austritt Großbritanniens aus der Union, Wahlerfolge europafeindlicher Parteien in den Mitgliedsstaaten usw. Dies macht es unerlässlich, sich für die Vertiefung der Europäischen Union als Wertegemeinschaft einzusetzen.
Daraufhin zielte auch die Aussage des Europäischen Rats im Juni 1999 in Köln, wonach es für die Union erforderlich ist, eine Charta der Grundrechte zu erstellen, um die überragende Bedeutung der Grundrechte und ihre Tragweite für die Unionsbürger sichtbar zu verankern. Diese Charta wurde am 7. Dezember 2000 auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs verkündet und mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 durch Art. 6 Abs. 1 EUV in das Primärrecht der Union aufgenommen. Sie soll eine bedeutungsvolle Grundlage der Werteorientierung des zusammengehörigen Europas sein und auch den Ängsten und Fragen der Unionsbürger begegnen können.
Die Aufnahme von sozialen Rechten und Gewährleistungen sozialen Inhalts in einen einheitlichen Text zusammen mit den klassischen Grundrechten auf ganz unterschiedlichen Ebenen stellt eine Prämiere dar. Eine Positionierung in sozialer Hinsicht ist bei der immer größer werdenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten unerlässlich.
Im Vergleich zu anderen Grundrechten sorgen die sozialen Rechte in Wissenschaft und Politik immer wieder für Diskussionen, weswegen auch eine Aufnahme der Rechte erkämpft werden musste. Es wurde erkannt, dass um ein "würdiges" Leben führen zu können, die Sicherung vor dem Staat durch Freiheitsrechte nicht ausreichend ist. Es braucht vielmehr zusätzlich eine Sicherung durch und vor dem Staat, damit der Mensch seine sozialen Grundbedürfnisse decken kann.
Diese Arbeit soll im Folgenden erklären, was unter dem Begriff "soziales Grundrecht" zu verstehen ist, wie die Aufnahme der sozialen Rechte in die Charta ablief und wie sie inhaltlich in der Charta ausgestaltet wurden. Hierbei soll auch auf die Kritik an den sozialen Grundrechten eine Antwort gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Begriffsbestimmung „Soziale Grundrechte“
- 1
- 2
- C. Die Aufnahme sozialer Rechte in die Grundrechtecharta
- I. Vorgaben des Europäischen Rats
- II. Die Diskussion im Konvent
- 1. Gegenargumente und ihre Entkräftung
- 2. Notwendigkeit und Ziele einer Aufnahme von sozialen Rechten
- III. Der Kompromiss: Verankerung nach dem 3-Säulen-Modell
- 1. Präambel
- 2. Titel „Solidarität“ und weitere Artikel außerhalb
- 3. Querschnittsklausel Art. 53
- D. Die inhaltliche Ausgestaltung der sozialen Rechte in der Charta
- I. Wirkschichten der sozialen Rechte
- 1. Freiheitsrechte mit sozialrechtlichem Bezug
- 2. Sozialrechtliche Schutzpflichten
- 3. Leistungs- und Teilhaberechte
- 4. Unionszielbestimmungen / Grundsätze
- II. Umfang und Reichweite des Grundrechtsschutzes
- 1. Anwendungsbereich am Bsp. Arbeitsrecht
- 2. Protokoll (Nr. 30) über die Anwendung der Charta der Grundrechte
- 3. Die Schrankenregelungen
- a) Allgemeine Schranken und Schranken-Schranken
- b) Der Verweis auf die „einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten“
- I. Wirkschichten der sozialen Rechte
- E. Rückblick und Perspektiven für eine Weiterentwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Integration sozialer Rechte in die Europäische Grundrechtecharta (GRCh) und untersucht deren Bedeutung für den Schutz individueller Rechte und die Stärkung der Europäischen Union als Wertegemeinschaft. Ziel ist es, die historischen, rechtlichen und politischen Hintergründe der Aufnahme sozialer Rechte in die GRCh zu beleuchten und deren inhaltliche Ausgestaltung zu erörtern.
- Die Bedeutung von sozialen Grundrechten für die Europäische Union
- Der Prozess der Aufnahme sozialer Rechte in die Grundrechtecharta
- Die inhaltliche Ausgestaltung der sozialen Rechte in der GRCh
- Die Reichweite und Anwendung sozialer Grundrechte im EU-Recht
- Kritische Betrachtung und Herausforderungen im Kontext der sozialen Grundrechte
Zusammenfassung der Kapitel
- A. Einleitung: Diese Einleitung stellt die aktuelle politische und rechtliche Bedeutung von Grundrechten in Europa heraus und betont die Notwendigkeit einer Charta der Grundrechte für die Europäische Union. Die Aufnahme sozialer Rechte in die Charta wird als bedeutender Schritt für die Werteorientierung der Union dargestellt.
- B. Begriffsbestimmung „Soziale Grundrechte“: Dieses Kapitel untersucht die Definition von „sozialen Grundrechten“ und deren Abgrenzung zu anderen Grundrechten. Es analysiert die verschiedenen Kategorien und Dimensionen sozialer Grundrechte und ihre Verbindung zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa.
- C. Die Aufnahme sozialer Rechte in die Grundrechtecharta: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Aufnahme sozialer Rechte in die GRCh. Es analysiert die Vorgaben des Europäischen Rates, die Diskussionen im Konvent und den Kompromiss, der zur Verankerung sozialer Rechte nach dem 3-Säulen-Modell führte.
- D. Die inhaltliche Ausgestaltung der sozialen Rechte in der Charta: Dieses Kapitel untersucht die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der sozialen Rechte in der Charta. Es erörtert die verschiedenen Wirkschichten der sozialen Rechte, wie z. B. Freiheitsrechte mit sozialrechtlichem Bezug, sozialrechtliche Schutzpflichten, Leistungs- und Teilhaberechte sowie Unionszielbestimmungen.
- E. Rückblick und Perspektiven für eine Weiterentwicklung: Dieses Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit und beleuchtet die Herausforderungen und Perspektiven für die weitere Entwicklung des Schutzes sozialer Grundrechte in der Europäischen Union.
Schlüsselwörter
Soziale Grundrechte, Europäische Grundrechtecharta, GRCh, Grundrechtsschutz, Union, Solidarität, Wirtschaft, Gesellschaft, Arbeitsrecht, Schranken, Schutzpflichten, Leistungsrechte, Teilhaberechte, Kritik, Weiterentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die EU-Grundrechtecharta verkündet?
Die Charta wurde am 7. Dezember 2000 verkündet und ist seit dem Vertrag von Lissabon (2009) rechtlich bindendes Primärrecht.
Was versteht man unter „sozialen Grundrechten“?
Es sind Rechte, die ein würdiges Leben sichern sollen, indem sie über reine Freiheitsrechte hinaus staatliche Schutzpflichten und Teilhaberechte (z.B. im Arbeitsrecht) definieren.
Was besagt das 3-Säulen-Modell der Charta?
Es beschreibt die Verankerung der Rechte durch die Präambel, den Titel „Solidarität“ sowie Querschnittsklauseln wie Art. 53.
Gibt es Einschränkungen bei der Anwendung der sozialen Rechte?
Ja, die Charta verweist oft auf „einzelstaatliche Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten“, was die Reichweite des Grundrechtsschutzes einschränken kann.
Warum war die Aufnahme sozialer Rechte umstritten?
In Wissenschaft und Politik gab es Diskussionen darüber, ob soziale Leistungen als einklagbare Rechte oder lediglich als politische Grundsätze ausgestaltet werden sollten.
- Quote paper
- Magdalena Tutsch (Author), 2017, Die Bedeutung der sozialen Grundrechte in der Grundrechtecharta der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384436