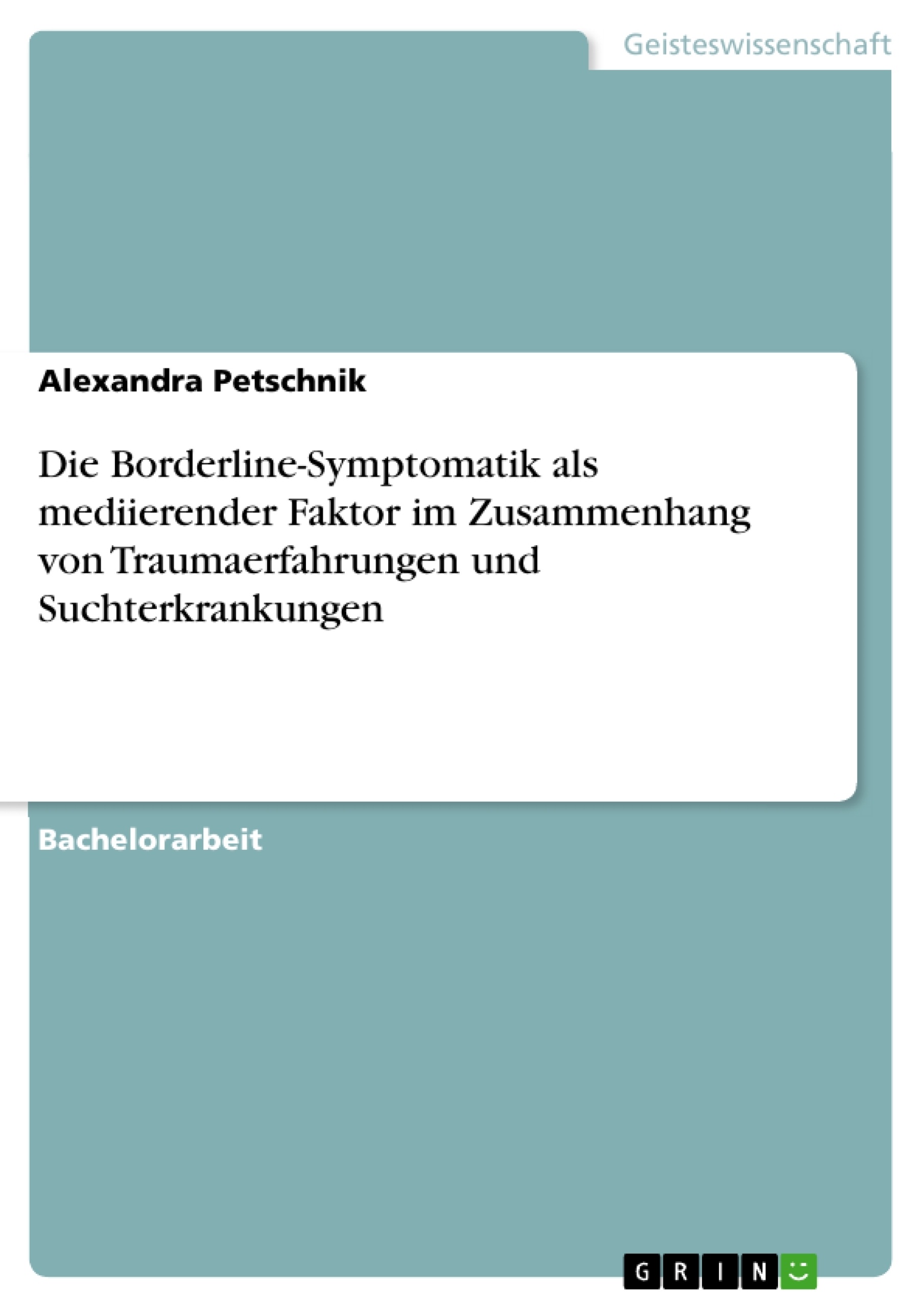Studien konnten zeigen, dass Drittvariablen eine mediierende Funktion im Zusammenhang von Traumaerfahrungen und Suchterkrankungen einnehmen. Diese traumatischen Erfahrungen können sich negativ auf die Entwicklung der Emotionsregulationsfähigkeit auswirken, welche wiederum die Kernproblematik der Borderline-Persönlichkeitsstörung darstellt.
Ziel dieser Studie war es, den Trauma-Sucht-Zusammenhang dahingehend zu untersuchen, ob eine Mediation durch Borderline-Symptome vorliegen kann. Zu diesem Zweck wurden 57 Probanden verschiedener suchtspezifischer Einrichtungen bezüglich vorangegangener Traumaerfahrungen, bestehender borderline-spezifischer Symptomatik und ihrer Suchtproblematik befragt.
Die Ergebnisse konnten zeigen, dass Borderline-Symptome als Mediator im Zusammenhang von emotionalen Misshandlungserlebnissen beziehungsweise physischer Vernachlässigung während der Kindheit und darauffolgender Suchtproblematik fungieren. Damit unterstreicht die Studie die Relevanz eines integrativen Therapieansatzes in der Behandlung von Suchterkrankungen mit komorbiden Störungen bei vorangegangenen Traumaerfahrungen.
Inhaltsverzeichnis
- ABSTRACT
- EINLEITUNG
- Suchterkrankungen in der Gesellschaft
- Traumaerfahrungen und Suchterkrankungen
- Persönlichkeitsstörungen und Suchterkrankungen als Folgen traumatischer Erfahrungen
- Fragestellung und Hypothesen
- METHODE
- Stichprobe
- Material und Messinstrumente
- Durchführung
- Statistische Datenanalyse
- ERGEBNISSE
- Allgemeine klinische Daten
- Substanzanamnese
- Traumaerfahrungen
- Borderline-Symptomatik
- Zusammenhänge zwischen Traumaerfahrungen und Suchterkrankungen
- Zusammenhänge zwischen Traumaerfahrungen und Borderline-Symptomatik
- Zusammenhänge zwischen Borderline-Symptomatik und Suchterkrankungen
- Mediationsmodelle
- DISKUSSION
- Relevanz der Studie
- Zusammenfassung und Interpretation der Befunde im Rahmen der Hypothesen
- Bewertung der Studie im Hinblick auf ihre Stärken und Schwächen
- Implikationen für die Forschung und Praxis
- LITERATURVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- ANHANG A
- Information und Einverständniserklärung
- Fragebogen zu soziodemographischen, klinischen und konsumspezifischen Daten
- Erweiterung Paper-Pencil Fragebogen
- ANHANG B
- Kolmogorov-Smirnov Test auf Normalverteilung
- Tabellen
- Nicht signifikante Mediationsmodelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Traumaerfahrungen, Borderline-Symptomatik und Suchterkrankungen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die mediierende Rolle der Borderline-Symptomatik im Zusammenhang von Trauma und Sucht zu analysieren.
- Der Einfluss von Traumaerfahrungen auf die Entwicklung von Suchtproblemen.
- Die Rolle der Borderline-Persönlichkeitsstörung als Mediator zwischen Trauma und Sucht.
- Die Relevanz eines integrativen Therapieansatzes bei Suchterkrankungen mit komorbiden Störungen.
- Die Bedeutung der Emotionsregulation für die Entstehung von Suchtproblemen.
- Die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Traumaformen und der Entwicklung von Suchterkrankungen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und skizziert den Zusammenhang zwischen Trauma, Borderline-Symptomatik und Sucht. Es werden wichtige Studien und Theorien zu diesem Themenkomplex vorgestellt.
- Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie, die Stichprobe, die verwendeten Messinstrumente und die statistische Datenanalyse.
- Ergebnisse: Die Ergebnisse der Studie werden in diesem Kapitel präsentiert und erläutert. Es werden die Zusammenhänge zwischen Traumaerfahrungen, Borderline-Symptomen und Suchtproblemen dargestellt und analysiert.
- Diskussion: Die Diskussion bewertet die Ergebnisse der Studie, interpretiert die Befunde und zieht Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Hypothesen. Es werden die Stärken und Schwächen der Studie diskutiert und Implikationen für die Forschung und Praxis abgeleitet.
Schlüsselwörter
Trauma, Suchterkrankungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Emotionsregulation, komorbide Störungen, Mediation, integrative Therapie, klinische Psychologie, Psychotherapie, Studien, Datenerhebung, statistische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Traumaerfahrungen und Suchterkrankungen zusammen?
Traumatische Erfahrungen können die Entwicklung der Emotionsregulationsfähigkeit negativ beeinflussen, was ein erhöhtes Risiko für spätere Suchterkrankungen darstellt.
Welche Rolle spielt die Borderline-Symptomatik in diesem Zusammenhang?
Die Studie zeigt, dass Borderline-Symptome als Mediator fungieren, also den Zusammenhang zwischen bestimmten Traumaerfahrungen (wie Misshandlung oder Vernachlässigung) und Sucht vermitteln.
Was ist das Kernproblem der Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Die Kernproblematik der Borderline-Störung liegt in einer tiefgreifenden Störung der Emotionsregulation.
Wie viele Personen nahmen an der Studie teil?
Es wurden 57 Probanden aus verschiedenen suchtspezifischen Einrichtungen befragt.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die Therapie?
Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit eines integrativen Therapieansatzes, der sowohl die Sucht als auch komorbide Störungen und vorangegangene Traumata behandelt.
Welche Traumaformen wurden besonders untersucht?
Die Arbeit betrachtet insbesondere emotionale Misshandlungserlebnisse und physische Vernachlässigung während der Kindheit.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Petschnik (Autor:in), 2015, Die Borderline-Symptomatik als mediierender Faktor im Zusammenhang von Traumaerfahrungen und Suchterkrankungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/383086