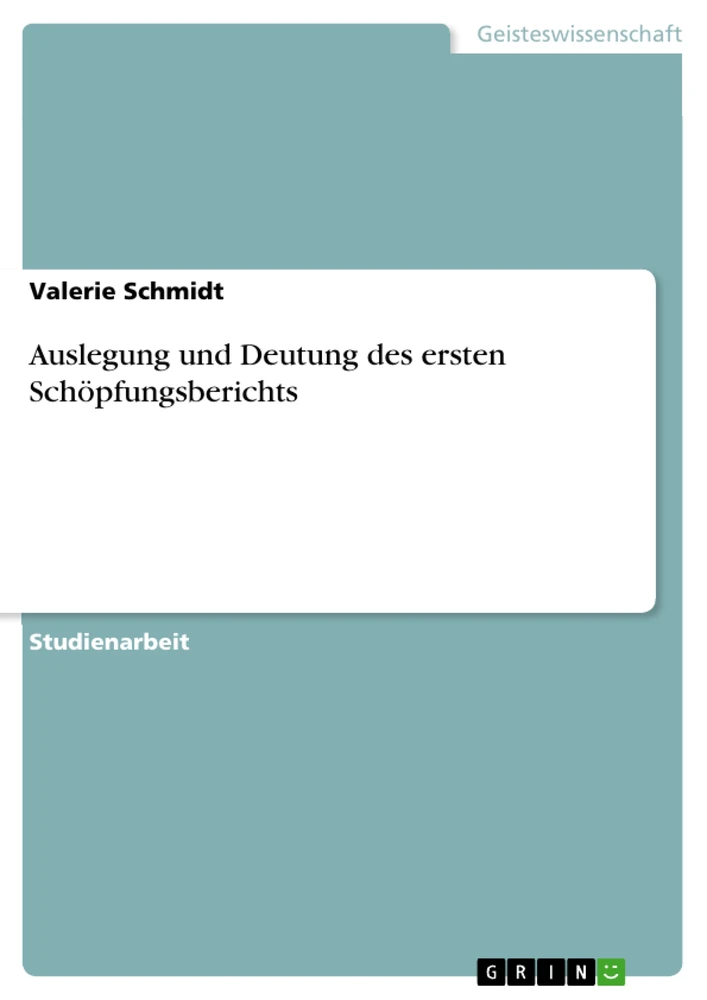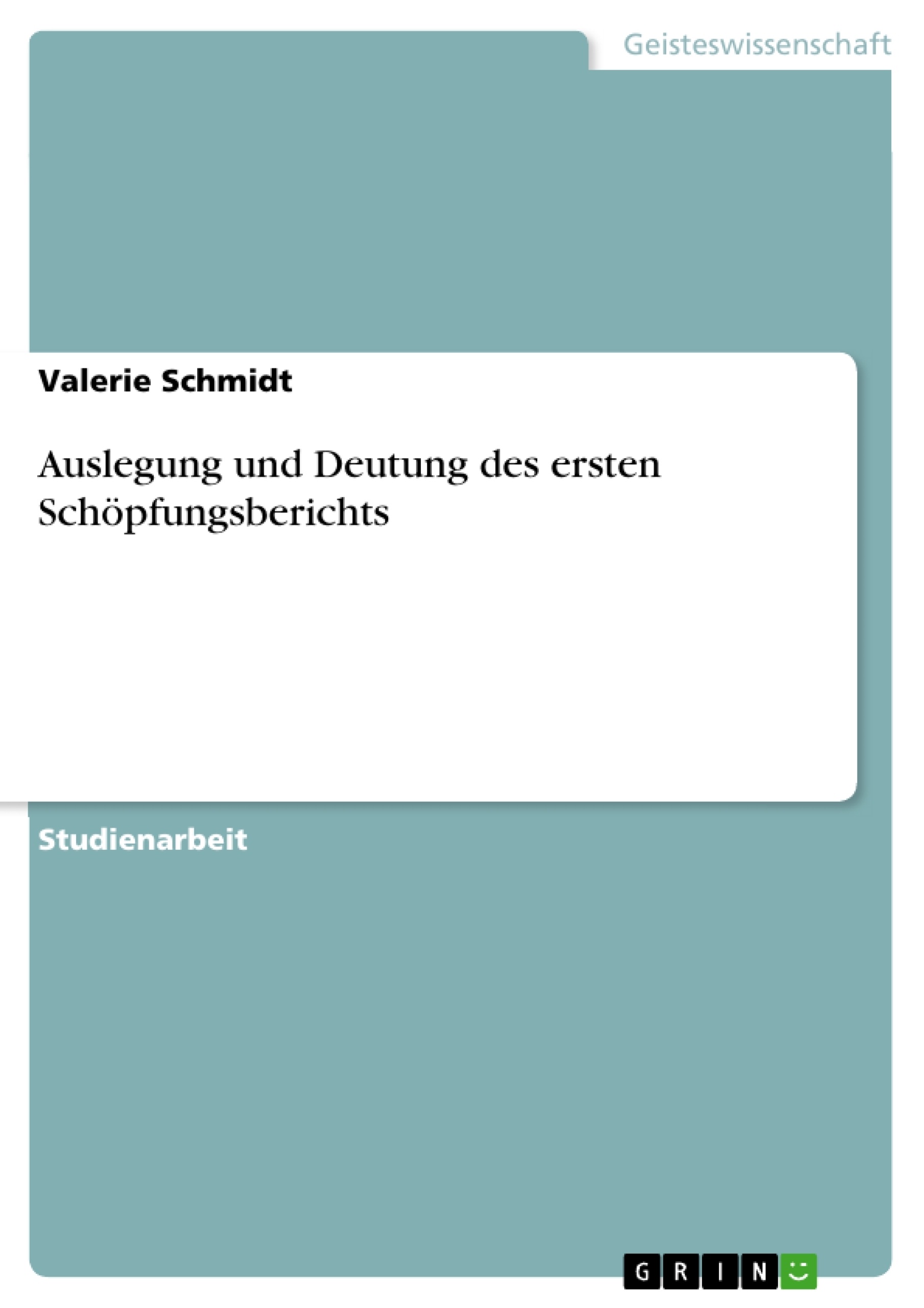Diese Arbeit bietet eine Analyse und eine systematische Deutung des Schöpfungsberichtes.
Der Schöpfungsbericht in Gen 1 ist eine eigentümliche Mischung von Theologie und Naturwissenschaft. Theologisch vermittelt der priesterliche Zeuge, dass Gott ewig, allmächtig und gütig ist. Er war da, bevor die Zeit begann. Er hat die Welt und alles auf der Welt geschaffen, durch seinen Segen macht er Menschen und Tiere fruchtbar und schenkt ihnen das Leben. Naturwissenschaftlich ist der Bericht in seinen genauen Klassifizierungen. Es wird unterschieden zwischen Gras und Kraut, das Samen bringt, sowie zwischen Bäumen, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Die Tiere werden unterschieden nach Vögeln, Wasser- und Landtieren. Den Lichtern am Himmel weist er die Funktion der Kalenderbestimmung zu.
Inhaltsverzeichnis
- Einordnung
- Analyse
- Systematische Deutung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Textes ist die Analyse des Schöpfungsberichts in Genesis 1, insbesondere unter Berücksichtigung der priesterlichen Perspektive und des Vergleichs mit altorientalischen Schöpfungsmythen. Der Text untersucht die theologischen und naturwissenschaftlichen Aspekte des Berichts und beleuchtet die sprachlichen Mittel und die Struktur des Textes.
- Die priesterliche Theologie im Schöpfungsbericht
- Vergleich mit altorientalischen Schöpfungsmythen
- Die Rolle von Ordnung und Unterscheidung in der Schöpfung
- Die sprachlichen Mittel des Schöpfungsberichts
- Die Struktur des Schöpfungsberichts (Sieben-Tage-Schema)
Zusammenfassung der Kapitel
Einordnung: Dieser Abschnitt führt in die Thematik ein und ordnet den Schöpfungsbericht in Genesis 1 in den Kontext der priesterlichen Literatur ein. Es wird die Bedeutung klarer Unterscheidungen und die strenge Ordnung im Denken der priesterlichen Schreiber hervorgehoben, die sich auch im Schöpfungsbericht widerspiegelt. Der Bericht wird als eine einzigartige Mischung aus Theologie (Gott als ewig, allmächtig und gütig) und Naturwissenschaft (genaue Klassifizierungen der Schöpfung) beschrieben. Die Verbindung zum 3. Mosebuch (Levitikus) und die Datierung der Priesterschrift werden ebenfalls kurz angesprochen.
Analyse: Die Analyse konzentriert sich auf die ersten drei Schöpfungstage. Der erste Vers wird als Zusammenfassung des gesamten Berichts interpretiert, wobei das hebräische Verb "barâ" (schaffen) als Ausdruck der unvorstellbaren Schöpfungskraft Gottes hervorgehoben wird. Der zweite Vers beschreibt den Zustand der Erde vor der Schöpfung und wird im Kontext altorientalischen Schöpfungsglauben diskutiert, wobei betont wird, dass der priesterliche Zeuge das Motiv des Kampfes, im Gegensatz zu anderen Mythen, nicht übernimmt. Der dritte Vers markiert den Beginn des eigentlichen Schöpfungsaktes durch Gottes Wort, wobei die Voranstellung der Erschaffung des Lichts vor der der Gestirne diskutiert wird. Die Verse 4 und 5 betonen die positive Bewertung Gottes seines Werkes und die Verbindung von Schöpfung und Lob. Die weiteren Verse werden im Kontext von Scheidung, Ordnung und Benennung der Schöpfung analysiert. Die Kapitel untersuchen die Bedeutung der Benennung als Herrschaftsakt und die strukturierende Funktion der wiederkehrenden Formulierung „Da ward aus Abend und Morgen…“
Schlüsselwörter
Schöpfung, Genesis 1, Priesterschrift, altorientalische Mythen, Gott, Ordnung, Unterscheidung, Licht, Finsternis, Wort Gottes, Benennung, Sieben-Tage-Schema, Theologie, Naturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zum Schöpfungsbericht in Genesis 1
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Analyse des Schöpfungsberichts in Genesis 1. Er beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Analyse der ersten drei Schöpfungstage, einen Vergleich mit altorientalischen Schöpfungsmythen, eine Erörterung der priesterlichen Theologie und eine Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die wichtigsten Themen sind die priesterliche Theologie im Schöpfungsbericht, der Vergleich mit altorientalischen Mythen, die Rolle von Ordnung und Unterscheidung in der Schöpfung, die sprachlichen Mittel des Berichts (insbesondere das hebräische Verb "barâ"), die Struktur des Sieben-Tage-Schemas und die theologischen sowie naturwissenschaftlichen Aspekte des Textes.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in mehrere Abschnitte gegliedert: Einordnung (Kontextualisierung des Schöpfungsberichts innerhalb der priesterlichen Literatur), Analyse (detaillierte Betrachtung der ersten drei Schöpfungstage), und Systematische Deutung (Vergleich mit anderen Schöpfungsmythen und theologische Interpretation). Zusätzlich enthält er eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, eine Zusammenfassung der Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselwörtern.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung ist die Analyse des Schöpfungsberichts in Genesis 1, insbesondere unter Berücksichtigung der priesterlichen Perspektive und im Vergleich mit altorientalischen Schöpfungsmythen. Es werden die theologischen und naturwissenschaftlichen Aspekte sowie die sprachlichen Mittel und die Struktur des Textes untersucht.
Welche Rolle spielt der Vergleich mit altorientalischen Mythen?
Der Vergleich mit altorientalischen Mythen dient dazu, den einzigartigen Charakter des priesterlichen Schöpfungsberichts hervorzuheben. Insbesondere wird der Unterschied in der Darstellung des Schöpfungsakts (z.B. das Fehlen eines Kampfes im priesterlichen Bericht) betont.
Welche Bedeutung hat das hebräische Verb "barâ"?
Das hebräische Verb "barâ" (schaffen) wird als Ausdruck der unvorstellbaren Schöpfungskraft Gottes interpretiert und steht im Zentrum der Analyse des ersten Verses.
Wie wird die Struktur des Schöpfungsberichts beschrieben?
Die Struktur des Berichts wird als Sieben-Tage-Schema beschrieben, wobei jeder Schöpfungstag und die wiederkehrende Formulierung „Da ward aus Abend und Morgen…“ analysiert wird.
Welche Schlüsselwörter sind im Text relevant?
Schlüsselwörter sind Schöpfung, Genesis 1, Priesterschrift, altorientalische Mythen, Gott, Ordnung, Unterscheidung, Licht, Finsternis, Wort Gottes, Benennung, Sieben-Tage-Schema, Theologie und Naturwissenschaft.
Wie wird der erste Schöpfungstag interpretiert?
Der erste Vers wird als Zusammenfassung des gesamten Berichts interpretiert. Der zweite Vers beschreibt den Zustand vor der Schöpfung im Kontext altorientalischen Glaubens. Der dritte Vers markiert den Beginn des Schöpfungsakts durch Gottes Wort, mit besonderer Betonung der Voranstellung der Erschaffung des Lichts vor der der Gestirne.
Welche Bedeutung hat die Benennung in der Schöpfung?
Die Benennung wird als ein Herrschaftsakt und als strukturierendes Element in der Schöpfung interpretiert.
- Quote paper
- Valerie Schmidt (Author), 2014, Auslegung und Deutung des ersten Schöpfungsberichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/381295