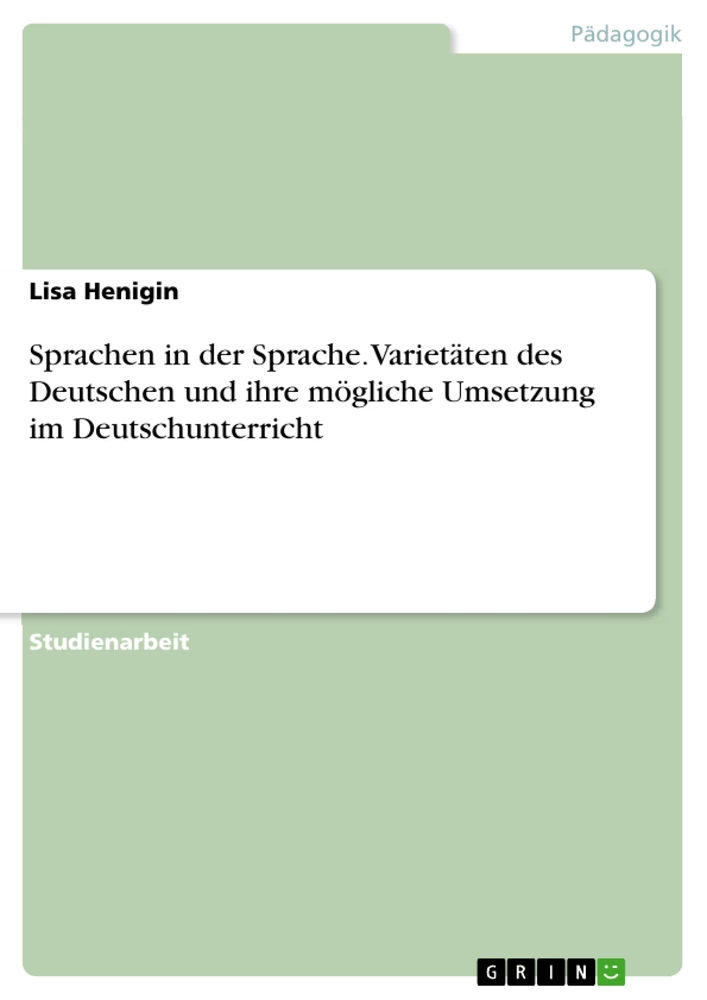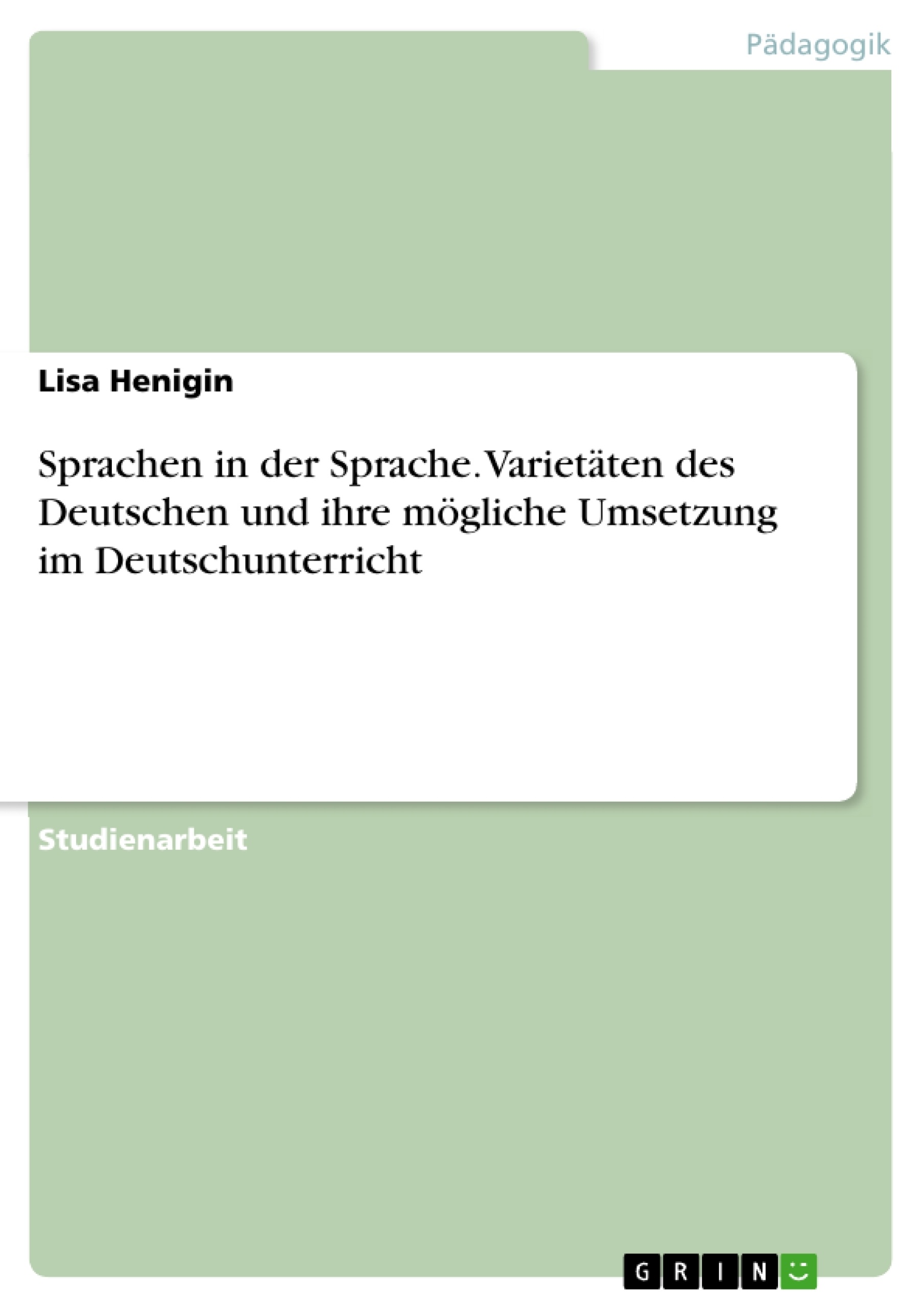Der Konfrontation mit Varietäten sehen sich auch Schülerinnen und Schüler sowohl im privaten Alltag, als auch im Schulalltag ausgesetzt, da oft viele unterschiedliche Sprachstile im Unterricht vertreten sind. Um an diese Alltagserfahrungen anzuknüpfen und so das Sprachbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu fördern, bietet sich eine Behandlung des Themas ‚Deutsche Sprachvarietäten‘ im Unterricht an.
Inhaltsverzeichnis
- Deutsch sprechen - oder babbeln, schwätzen, schnacken, labern?
- Varietät Versuch einer Definition
- Dialekte
- Dialekt / Mundart und Standardsprache: Definitionsprobleme
- Entstehung der Dialekte
- Dialektgrenzen
- Zukunft der Dialekte
- Soziolekte
- Jugendsprache
- Wer ist „Die Jugend“?
- Merkmale der Jugendsprache
- Genderlekte
- Was ist Gender?
- Männersprache vs. Frauensprache
- Jugendsprache
- „Sprachen in der Sprache“ als Unterrichtsgegenstand
- Exemplarische Bedeutung
- Bildungsstandards
- Lehrplan
- Gegenwartsbedeutung
- Zukunftsbedeutung
- Methodische Überlegungen
- Dialekte
- Jugendsprache
- Genderlekte
- Exemplarische Bedeutung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Varietäten der deutschen Sprache und deren Bedeutung für den Deutschunterricht. Ziel ist es, den Begriff „Varietät“ zu definieren und die Varietäten Dialekt und Soziolekt (mit Fokus auf Jugendsprache und Genderlekte) zu analysieren. Abschließend werden didaktische Überlegungen zur Implementierung des Themas im Unterricht präsentiert.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Varietät“
- Analyse von Dialekten und ihren Herausforderungen für die Definition
- Untersuchung von Soziolekten, insbesondere Jugendsprache und Genderlekte
- Bedeutung von Sprachvarietäten für das Sprachbewusstsein von Schülern
- Didaktische Ansätze zur Behandlung von Sprachvarietäten im Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Deutsch sprechen – oder babbeln, schwätzen, schnacken, labern?: Das einleitende Kapitel verdeutlicht die Heterogenität der deutschen Sprache anhand von Beispielen aus dem Alltag, die die unterschiedlichen Sprachvarietäten aufzeigen – vom Verständnisproblem zwischen Generationen über regionale Unterschiede bis hin zu nationalen Variationen. Es wird die Relevanz dieser Varietäten für den Schulunterricht betont und der Fokus auf die Behandlung des Themas „Deutsche Sprachvarietäten“ als Mittel zur Förderung des Sprachbewusstseins gelegt. Die Arbeit selbst wird kurz skizziert, wobei die Schwerpunkte auf der Definition von „Varietät“, der Analyse von Dialekten und Soziolekten (Jugendsprache und Genderlekte) und deren didaktischer Umsetzung im Unterricht liegen.
2. Varietät Versuch einer Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit der schwierigen Aufgabe, den Begriff „Varietät“ präzise zu definieren. Es werden unterschiedliche linguistische Ansätze präsentiert, die die Problematik der Abgrenzung und Klassifizierung von Varietäten als Subsysteme einer Sprache hervorheben. Die Definitionsschwierigkeiten werden anhand der Ansichten verschiedener Linguisten wie Sinner und Berruto verdeutlicht, wobei die zentralen Herausforderungen darin bestehen, die notwendigen Merkmale einer eigenständigen Varietät zu identifizieren und die Abgrenzung zu anderen Sprachformen zu treffen. Lehmanns Vier-Dimensionen-Modell (diaphasisch, diastratisch, diatopisch, diachronisch) bietet einen Ansatzpunkt für die weitere Betrachtung, wobei der Fokus der Arbeit auf den diastratischen und diatopischen Dimensionen (Soziolekte und Dialekte) liegt.
3. Dialekte: Kapitel 3 konzentriert sich auf die Definition und die Herausforderungen, die mit der Abgrenzung von Dialekten und Mundarten verbunden sind. Die geschichtliche Entwicklung der Termini und die unterschiedlichen Definitionen in der Linguistik werden erläutert, wobei die relative Unselbständigkeit des Begriffs Dialekt/Mundart in Relation zur Standardsprache hervorgehoben wird. Die verschiedenen Kriterien zur Abgrenzung von Dialekten und Standardsprache (linguistisch, Verwendungsbereich, Sprachbenutzer, sprachgeschichtliche Entstehung, räumliche Erstreckung, kommunikative Reichweite) werden detailliert analysiert und ihre Grenzen aufgezeigt. Es wird deutlich, dass Dialekte nur in Relation zur Standardsprache definiert werden können.
Schlüsselwörter
Sprachvarietäten, Dialekte, Soziolekte, Jugendsprache, Genderlekte, Standardsprache, Deutschunterricht, Sprachbewusstsein, Didaktik, Linguistik, Varietätenlinguistik.
Häufig gestellte Fragen zu: Deutsch sprechen – oder babbeln, schwätzen, schnacken, labern?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit verschiedenen Varietäten der deutschen Sprache und ihrer Bedeutung im Deutschunterricht. Der Fokus liegt auf der Definition des Begriffs „Varietät“ und der Analyse von Dialekten und Soziolekten (insbesondere Jugendsprache und Genderlekte). Die Arbeit enthält didaktische Überlegungen zur Implementierung des Themas im Unterricht.
Welche Sprachvarietäten werden untersucht?
Die Arbeit untersucht hauptsächlich Dialekte und Soziolekte. Im Bereich der Soziolekte wird speziell auf Jugendsprache und Genderlekte eingegangen. Die Standardsprache dient dabei als Referenzpunkt für den Vergleich und die Abgrenzung.
Wie wird der Begriff „Varietät“ definiert?
Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten bei der präzisen Definition von „Varietät“. Sie präsentiert verschiedene linguistische Ansätze und diskutiert die Problematik der Abgrenzung und Klassifizierung von Varietäten als Subsysteme einer Sprache. Lehmanns Vier-Dimensionen-Modell (diaphasisch, diastratisch, diatopisch, diachronisch) wird als Ansatzpunkt verwendet, wobei der Fokus auf den diastratischen und diatopischen Dimensionen (Soziolekte und Dialekte) liegt.
Wie werden Dialekte behandelt?
Das Kapitel zu Dialekten konzentriert sich auf die Definitionsprobleme und die Abgrenzung zu Mundarten und der Standardsprache. Es werden verschiedene Kriterien zur Abgrenzung analysiert (linguistisch, Verwendungsbereich, Sprachbenutzer, sprachgeschichtliche Entstehung, räumliche Erstreckung, kommunikative Reichweite) und deren Grenzen aufgezeigt. Die geschichtliche Entwicklung der Termini wird ebenfalls erläutert.
Wie werden Soziolekte, insbesondere Jugendsprache und Genderlekte, behandelt?
Die Arbeit analysiert Soziolekte, mit einem besonderen Fokus auf Jugendsprache (inklusive der Frage „Wer ist ‚Die Jugend‘?“ und der Merkmale der Jugendsprache) und Genderlekte (mit Fragen zu Gender und dem Vergleich von Männersprache und Frauensprache).
Welche didaktischen Überlegungen werden angestellt?
Die Arbeit enthält didaktische Überlegungen zur Implementierung des Themas „Sprachvarietäten“ im Deutschunterricht. Es werden methodische Ansätze zur Behandlung von Dialekten, Jugendsprache und Genderlekten im Unterricht präsentiert, unter Berücksichtigung von Bildungsstandards und Lehrplänen. Die Bedeutung von Sprachvarietäten für das Sprachbewusstsein der Schüler wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Sprachvarietäten, Dialekte, Soziolekte, Jugendsprache, Genderlekte, Standardsprache, Deutschunterricht, Sprachbewusstsein, Didaktik, Linguistik, Varietätenlinguistik.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: "Deutsch sprechen - oder babbeln, schwätzen, schnacken, labern?", "Varietät - Versuch einer Definition", "Dialekte", "Soziolekte" (mit Unterkapiteln zu Jugendsprache und Genderlekte), "„Sprachen in der Sprache“ als Unterrichtsgegenstand" und "Fazit".
- Citation du texte
- Lisa Henigin (Auteur), 2017, Sprachen in der Sprache. Varietäten des Deutschen und ihre mögliche Umsetzung im Deutschunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/380982