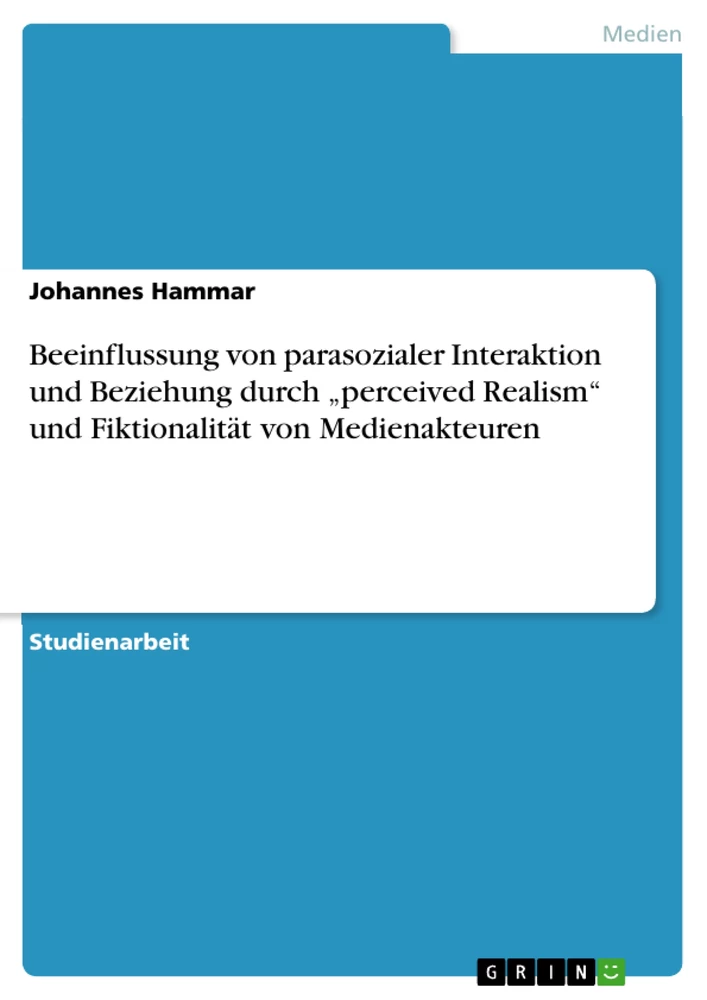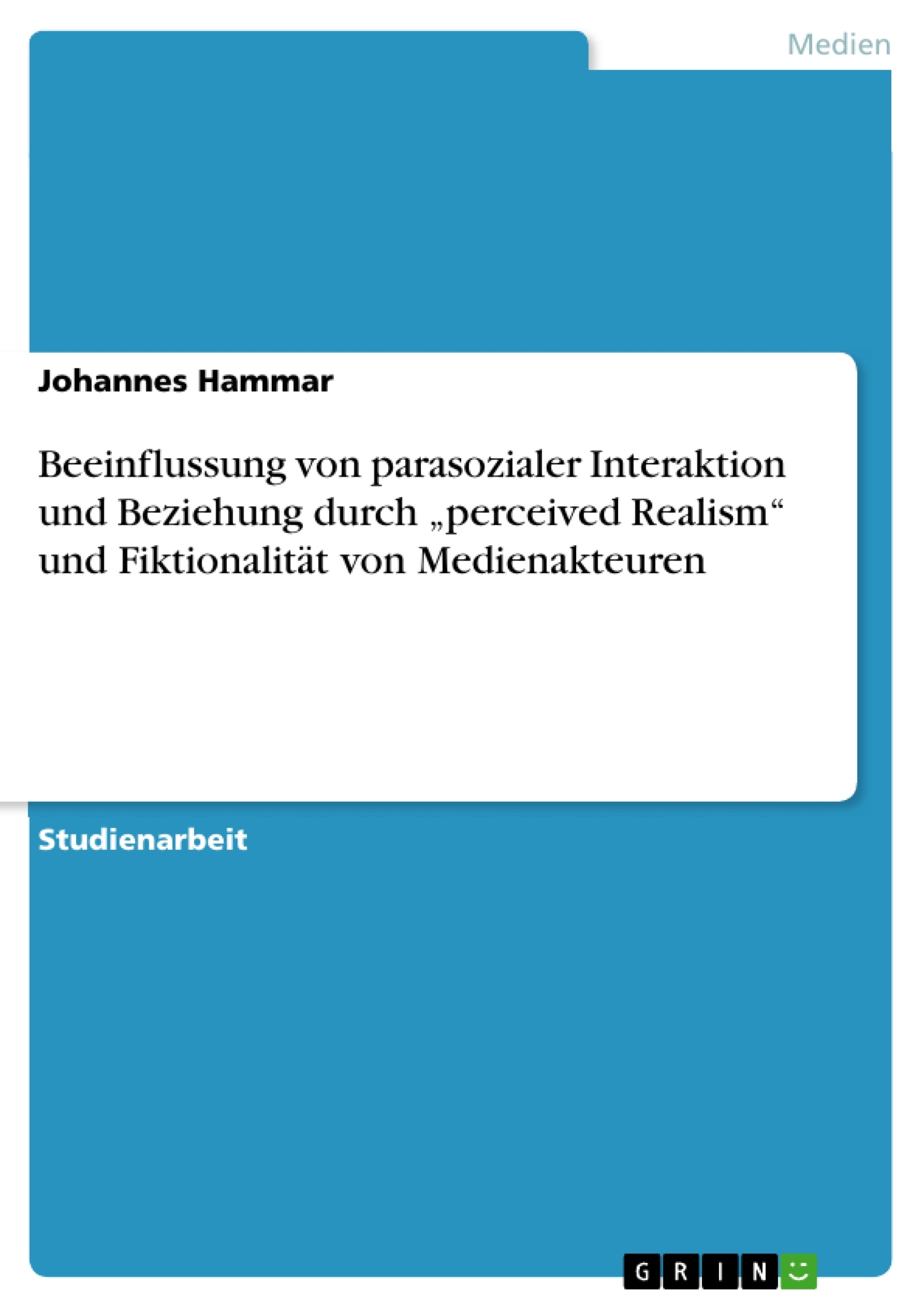Parasoziale Interaktionen sind einseitige Beziehungen, welche Mediennutzer zu einem Medienakteur, der sogenannten Persona, eingehen. Dies geschieht dadurch, dass die Persona durch verschiedene Mittel, wie z. B. direkten Blickkontakt oder Ansprache, den Eindruck vermittelt, im Kontakt mit dem Publikum zu stehen. Seitens des Mediennutzers gibt es verschiedene ausschlaggebende Faktoren, welche zu mehr oder weniger stark ausgeprägten PSB führen, z.B. das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, oder Erfahrungen, welche die Rezipienten im Kindesalter gemacht haben.
Im Verlauf dieser Arbeit wird zunächst genauer darauf eingegangen, was parasoziale Beziehungen ausmacht und wie sie sich von realen oder face to face Beziehungen unterscheiden, sowie die Schwierigkeiten bei der Messung und Einordnung derselben.
Des Weiteren wird untersucht, wie Realitätsnähe gemessen werden kann. Unter dem Stichwort „Perceived Realism“ finden sich viele Forschungsergebnisse, die Beschreiben, welche Wirkung die wahrgenommene Realität auf Medieneffekte hat, um im Anschluss zu schauen, ob sich Forschungsergebnisse finden, welche darauf schließen lassen, ob die wahrgenommene Realität beim Mediennutzer Auswirkungen auf die parasoziale Interaktion und/ oder Beziehung hat.
Viele neuere Studien zu parasozialen Phänomenen beschäftigen sich mit fiktionalen oder non-fiktionalen Mediencharakteren, weshalb in dieser Arbeit auch auf diese Bezug genommen wird, sowie auf verschiedene Studien zu parasozialen Beziehungen mit (animierten) Computerspielfiguren und Avataren.
In einem Forschungsüberblick sollen die Ergebnisse der PSB hinsichtlich des Kriteriums Realitätsnähe überprüft werden, und anschließend geschaut werden, ob die realitätsnahe Darstellung eines Medienakteurs zu einer stärkeren oder schwächeren parasozialen Beziehung führt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Parasoziale Interaktion und Beziehung
- 2.1. Unterschiede zu realen Beziehungen
- 3. Perceived Media Realism
- 4. Einfluss der Realitätsnähe auf Parasoziale Beziehungen
- 4.1. Realitätsfaktoren anhand der Medienpersona
- 5. Parasoziale Beziehungen zu Fiktionalen Mediencharakteren
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von „perceived realism“ und Fiktionalität von Medienakteuren auf parasoziale Interaktion und Beziehungen. Ziel ist es, Forschungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen wahrgenommener Realitätsnähe und der Stärke parasozialer Beziehungen zu analysieren.
- Unterschiede zwischen parasozialen und realen Beziehungen
- Messung von parasozialem Realismus
- Einfluss der Realitätsnähe auf die Intensität parasozialer Beziehungen
- Parasoziale Beziehungen zu fiktionalen Mediencharakteren
- Der Begriff der parasozialen Interaktion und Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema parasoziale Interaktion und Beziehungen ein, definiert den Begriff und skizziert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Sie hebt die Einseitigkeit parasozialer Beziehungen hervor und benennt die Schwierigkeiten bei deren Messung. Die Arbeit kündigt die Untersuchung des Einflusses von "perceived realism" auf parasoziale Beziehungen an und plant, verschiedene Studien zu parasozialen Beziehungen mit fiktionalen und nicht-fiktionalen Mediencharakteren zu berücksichtigen, um die Auswirkungen der realitätsnahen Darstellung von Medienakteuren auf die Stärke parasozialer Beziehungen zu überprüfen.
2. Parasoziale Interaktion und Beziehung: Dieses Kapitel beleuchtet die Konzeptualisierung parasozialer Interaktion und Beziehungen durch Horton und Wohl, wobei die Einseitigkeit der Beziehung betont wird. Es werden Unterschiede zu realen Beziehungen herausgestellt, die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Interaktion und Beziehung diskutiert und alternative Einordnungen im Kontext des Uses & Gratification Ansatzes beleuchtet. Es werden außerdem weitere parasoziale Phänomene wie parasoziale Trennungen und Romanzen erwähnt.
2.1. Unterschiede zu realen Beziehungen: Dieser Abschnitt vergleicht parasoziale und reale Beziehungen hinsichtlich ihrer psychologischen Muster. Während die ausgelösten Emotionen in parasozialen Interaktionen schwächer sind als in realen Freundschaften, kann die empfundene parasoziale Freundschaft stärker sein als die zu einem Nachbarn. Der entscheidende Unterschied liegt in der Einseitigkeit der parasozialen Interaktion: der Nutzer hat keine Verantwortung gegenüber der Persona und kann die Beziehung jederzeit beenden, während der Medienakteur den Beziehungsverlauf kontrolliert.
Schlüsselwörter
Parasoziale Interaktion, parasoziale Beziehung, Perceived Realism, Realitätsnähe, Medienakteur, Medienpersona, fiktionale Charaktere, Einseitigkeit, Uses & Gratification Ansatz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Parasoziale Interaktionen und Beziehungen
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht den Einfluss von „perceived realism“ (wahrgenommener Realitätsnähe) und der Fiktionalität von Medienakteuren auf parasoziale Interaktionen und Beziehungen. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Zusammenhangs zwischen wahrgenommener Realitätsnähe und der Stärke parasozialer Beziehungen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: die Definition und Konzeptualisierung parasozialer Interaktionen und Beziehungen, die Unterschiede zwischen parasozialen und realen Beziehungen, die Messung von parasozialem Realismus, den Einfluss der Realitätsnähe auf die Intensität parasozialer Beziehungen, parasoziale Beziehungen zu fiktionalen Mediencharakteren und den Uses & Gratification Ansatz.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Parasoziale Interaktion und Beziehung (inkl. Unterkapitel: Unterschiede zu realen Beziehungen), Perceived Media Realism, Einfluss der Realitätsnähe auf Parasoziale Beziehungen (inkl. Unterkapitel: Realitätsfaktoren anhand der Medienpersona), Parasoziale Beziehungen zu Fiktionalen Mediencharakteren und Fazit.
Wie werden parasoziale Beziehungen definiert?
Der Text definiert parasoziale Beziehungen basierend auf dem Ansatz von Horton und Wohl, wobei die Einseitigkeit der Beziehung hervorgehoben wird. Im Gegensatz zu realen Beziehungen besteht keine wechselseitige Verantwortung. Der Nutzer kann die Beziehung jederzeit beenden, während der Medienakteur den Beziehungsverlauf kontrolliert.
Was sind die Unterschiede zwischen parasozialen und realen Beziehungen?
Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Einseitigkeit der parasozialen Interaktion. Während die in parasozialen Interaktionen ausgelösten Emotionen schwächer sind als in realen Freundschaften, kann die empfundene parasoziale Freundschaft stärker sein als die zu einem Nachbarn. In parasozialen Beziehungen hat der Nutzer keine Verantwortung gegenüber der Medienpersona.
Welche Rolle spielt "Perceived Realism"?
Der Text untersucht, wie die wahrgenommene Realitätsnähe ("perceived realism") von Medienakteuren die Stärke parasozialer Beziehungen beeinflusst. Es wird analysiert, wie realitätsnahe Darstellungen von Medienakteuren die Intensität parasozialer Beziehungen verändern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Parasoziale Interaktion, parasoziale Beziehung, Perceived Realism, Realitätsnähe, Medienakteur, Medienpersona, fiktionale Charaktere, Einseitigkeit, Uses & Gratification Ansatz.
Welche Forschungsfragen werden im Text behandelt?
Der Text befasst sich mit der Forschungsfrage, wie der Zusammenhang zwischen wahrgenommener Realitätsnähe und der Stärke parasozialer Beziehungen aussieht. Er untersucht dabei den Einfluss von "perceived realism" und Fiktionalität von Medienakteuren auf parasoziale Interaktionen und Beziehungen.
Wie wird der Uses & Gratification Ansatz berücksichtigt?
Der Text erwähnt den Uses & Gratification Ansatz im Kontext der Einordnung parasozialer Phänomene und der Diskussion der Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Interaktion und Beziehung.
- Citation du texte
- Johannes Hammar (Auteur), 2017, Beeinflussung von parasozialer Interaktion und Beziehung durch „perceived Realism“ und Fiktionalität von Medienakteuren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378898