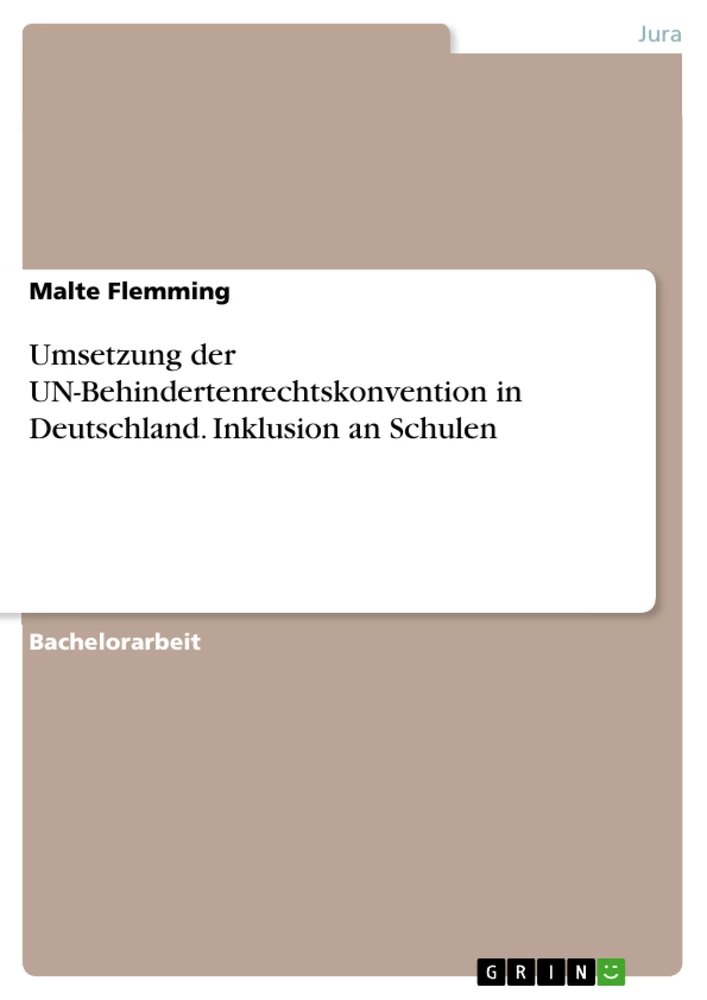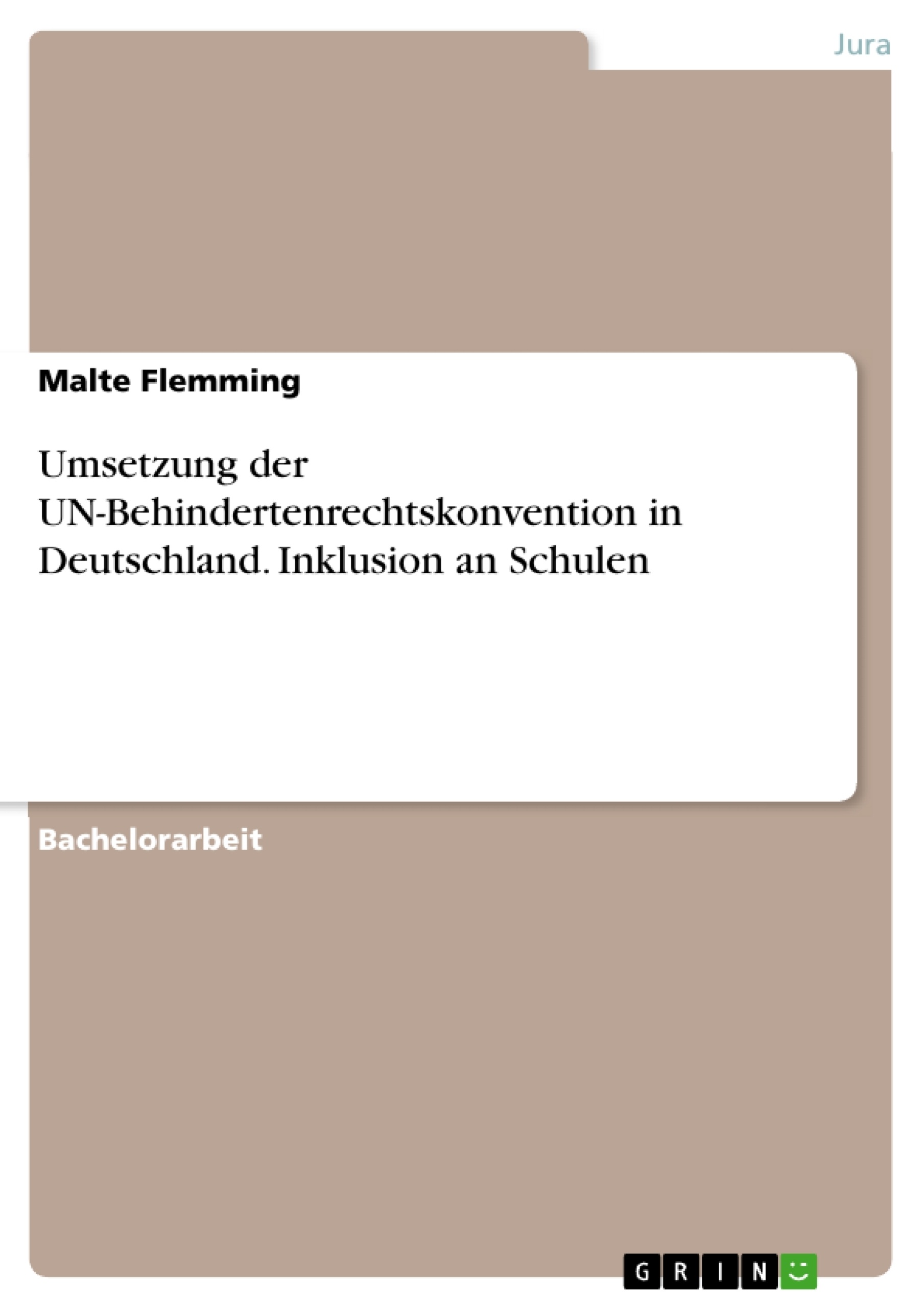Das wohl am höchsten zu gewichtende Schutzgut ist die Gewährung und Einhaltung von Menschenrechten. Besonders dem Menschenrecht der Gleichberechtigung wird ein hoher Stellenwert eingeräumt. Im Grundgesetz (GG) findet es besonders in Artikel 3 Abs. 3 in Verbindung mit dem Diskriminierungsverbot Beachtung. Demzufolge darf u.a. niemand aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden.
Ein Meilenstein für die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen ist die UN- Behindertenrechtskonvention (UN- BRK). Wie keine andere Menschenrechtsquelle hat die UN- BRK den öffentlichen Diskurs geprägt. Wie ein Lauffeuer hat sich die Erkenntnis verbreitet, dass die UN- BRK die Inklusion behinderter Kinder im deutschen Bildungssystem einfordert und Sonderwelten wie Förderschulen prinzipiell mit dem Geist der Konvention nicht vereinbar sind. Gleichwohl sind viele Fragen immer noch offen: Was verstehen wir unter Inklusion? Was ist Behindertendiskriminierung? Woher kommt die UN- BRK und welche Organe sind mit ihrer Umsetzung betraut? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die verfolgten Ziele umzusetzen? Welchen Einfluss hat die UN- BRK konkret auf das nationale Recht und wie erlangen Betroffene bei Verstößen gegen die Konvention Rechtschutz?
Insbesondere am Beispiel der Inklusion an Schulen sollen diese Fragen näher erörtert werden. Inklusion nimmt als gesellschaftliches Thema kontinuierlich an Bedeutung zu. Die Diskussionen um ein inklusives deutsches Schulsystem sind hochaktuell und in den Medien immer wieder präsent. Die dabei oftmals im Vordergrund stehende Frage ist, ob Eltern einen rechtlichen Anspruch auf einen Platz an einer Regelschule für ihr behindertes Kind haben.
Dies würde einen Paradigmenwechsel im deutschen Bildungssystem bedeuten, denn über Jahrzehnte wurden die traditionellen sozialen Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung sowie ihre notwendige besondere Förderung in besonderen Einrichtungen organisiert. Und nun fordert die UN- BRK einen radikalen Wechsel: Behinderte Menschen sollen alle die Einrichtungen besuchen und Dienstleitungen in Anspruch nehmen können, die auch den nicht behinderten Menschen offenstehen und auch darauf einen Rechtsanspruch haben.
Ziel dieser Arbeit ist es, den bisher zurückgelegten Weg zur Inklusion in Deutschland an zwei Beispielbereichen nach zu skizzieren, die dabei aufgetretenen Problemfelder aufzudecken und darzulegen, welche Rechtsmittel Betroffenen bei Versagung ihrer Rechte zur Verfügung stehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die UN-Behindertenrechtskonvention
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Entstehungsgeschichte
- 2.3 Hintergrund
- 2.4 Inhalt
- 2.4.1 Aufbau
- 2.4.2 Eckpfeiler
- 2.5 Anwendungsbereich
- 2.6 Adressaten
- 2.7 Verpflichtungen der Vertragsstaaten
- 2.8 Überwachung der Umsetzungsverpflichtungen
- 2.8.1 Auf internationaler Ebene
- 2.8.2 Auf nationaler Ebene
- 3. Das Fakultativprotokoll
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Inhalt
- 3.2.1 Die Individualbeschwerde
- 3.2.2 Das Untersuchungsverfahren
- 4. Die Umsetzung der UN- BRK
- 4.1 Maßnahmen zur inklusiven Bildung
- 4.2 Maßnahmen zur Barrierefreiheit
- 4.2.1 DIN- Norm 18040
- 4.2.2 DIN- Norm 18040- 1
- 4.2.3 DIN- Norm 18040- 2
- 4.2.4 DIN- Norm 18040- 3
- 4.2.5 Personenbeförderungsgesetz
- 4.2.6 Zusammenfassung
- 4.3 Die Kostenfrage
- 5. Rechtsfolgen
- 5.1 Rechtsanspruch
- 5.2 Rechtschutz
- 5.3 Gerichtsentscheidungen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland, insbesondere im Kontext der Inklusion. Sie beleuchtet die Entstehung und den Inhalt der Konvention sowie ihre Auswirkungen auf das deutsche Recht und die Praxis.
- Die Bedeutung der UN-BRK als Meilenstein für die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen
- Die Inklusion behinderter Kinder im deutschen Bildungssystem und der Paradigmenwechsel, der durch die UN-BRK gefordert wird
- Die rechtlichen und praktischen Herausforderungen bei der Umsetzung der UN-BRK, insbesondere im Bereich der Inklusion und Barrierefreiheit
- Die Auswirkungen der UN-BRK auf das nationale Recht und die Rechtsmittel für Betroffene bei Verstößen gegen die Konvention
- Die Kostenfrage im Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-BRK und der Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung der UN-BRK und der Inklusion für die Menschenrechte heraus und führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein.
- Kapitel 2: Die UN-Behindertenrechtskonvention: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung, den Inhalt und die wichtigsten Punkte der UN-BRK. Es werden die Eckpfeiler der Konvention sowie die Verpflichtungen der Vertragsstaaten erläutert.
- Kapitel 3: Das Fakultativprotokoll: In diesem Kapitel wird das Fakultativprotokoll zur UN-BRK vorgestellt, das den Individualbeschwerden von Menschen mit Behinderungen gegen Staaten, die die UN-BRK ratifiziert haben, ermöglicht.
- Kapitel 4: Die Umsetzung der UN-BRK: Dieses Kapitel befasst sich mit der konkreten Umsetzung der UN-BRK in Deutschland, insbesondere im Bereich der Inklusion und Barrierefreiheit. Es werden verschiedene Maßnahmen und Rechtsnormen vorgestellt.
- Kapitel 5: Rechtsfolgen: Dieses Kapitel untersucht die Rechtsfolgen der UN-BRK, insbesondere den Rechtsanspruch auf Inklusion und die Möglichkeiten des Rechtschutzes für Betroffene.
Schlüsselwörter
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den zentralen Themen der UN-Behindertenrechtskonvention, Inklusion, Barrierefreiheit, Menschenrechte, Rechtsanspruch, Rechtschutz, Bildungssystem, deutsche Rechtsordnung, und dem Empowerment von Menschen mit Behinderungen. Sie untersucht die konkreten Umsetzungsmaßnahmen der UN-BRK in Deutschland und die Herausforderungen, die sich dabei stellen.
- Quote paper
- Malte Flemming (Author), 2015, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Inklusion an Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378628