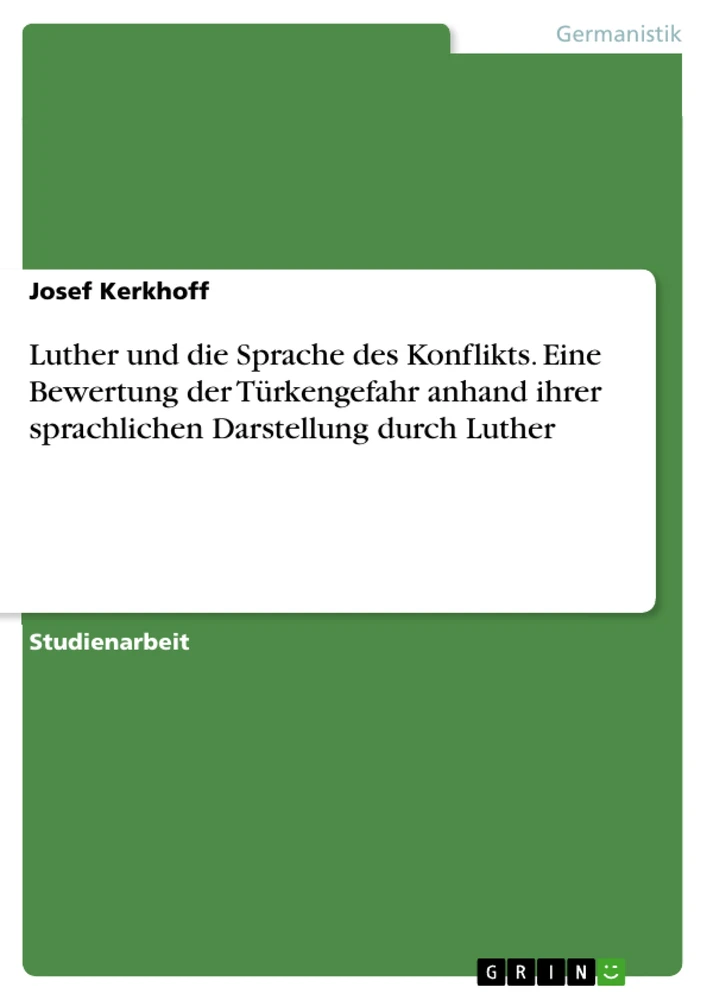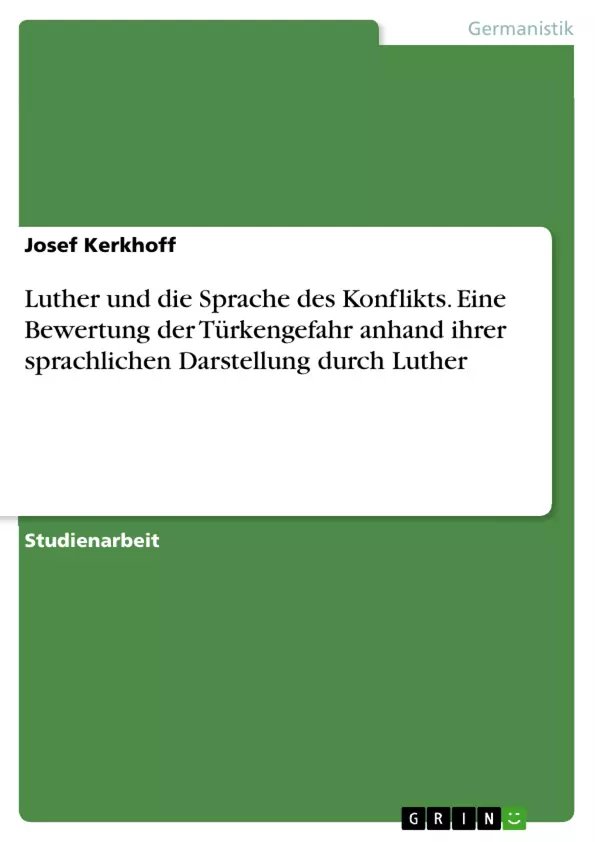Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Sprache des Konflikts, für die Martin Luther zu seiner Zeit und auch heute noch bekannt ist. Insbesondere soll anhand der Sprache gegen die Türken und das osmanische Reich versucht werden herauszufinden, inwiefern Luther die Türken als ernstzunehmende Gefahr für die Gesellschaft und das Christentum sah.
Unterteilt ist die Hausarbeit in historische sowie sprachliche Aspekte. Auch Vergleiche mit der Streitsprache gegen den Papst und gegen die jüdische Bevölkerung werden angerissen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Luthers Meinung über die Türken
- 2.1 Aus politischer und gesellschaftlicher Sicht
- 2.2 Aus theologischer Sicht
- 2.3 Zusammenfassende Belegung der ersten These
- 3. Sprachliche Gestaltung Luthers
- 3.1 Allgemeines zur Sprachgestaltung Luthers
- 3.2 Belegung der zweiten These
- 3.3 Sprachliche Gestaltung gegen Juden und den Papst
- 3.4 Sprachliche Gestaltung gegen die Türken
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Martin Luthers Verhältnis zum Islam und zur „Türkengefahr“ seiner Zeit. Sie analysiert Luthers politische und theologische Sichtweise auf die Osmanen und beleuchtet die sprachliche Gestaltung seiner Äußerungen über die Türken. Die Arbeit zielt darauf ab, Luthers Wahrnehmung der Türken als Bedrohung für das Christentum und die europäische Gesellschaft zu belegen und die sprachlichen Mittel zu untersuchen, mit denen er diese Bedrohung darstellte.
- Luthers politische und gesellschaftliche Einschätzung der Türken
- Luthers theologische Sicht auf den Islam und die „Türkengefahr“
- Die sprachliche Gestaltung von Luthers Äußerungen über die Türken
- Der Vergleich der sprachlichen Mittel Luthers gegenüber verschiedenen Gegnern (Türken, Juden, Papst)
- Die Verbindung von Politik und Religion in Luthers Denken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und benennt die beiden zentralen Forschungsthesen: Erstens, dass Luther im türkischen Volk eine Gefahr für das Christentum und die europäische Gesellschaft sah; und zweitens, dass die eindeutige und konkrete Sprache Luthers den Ernst seiner Wahrnehmung der „Türkengefahr“ und deren Stellenwert verdeutlicht. Die Einleitung skizziert den Ansatz der Arbeit, der sowohl historische als auch sprachwissenschaftliche Perspektiven einbezieht und die Untersuchung weltlicher Schriften Luthers sowie seiner Kritik am Islam umfasst.
2. Luthers Meinung über die Türken: Dieses Kapitel analysiert Luthers Sichtweise auf die Türken aus politischer, gesellschaftlicher und theologischer Perspektive. Im politischen und gesellschaftlichen Kontext wird Luthers Wissen über die Ausbreitung des Osmanischen Reiches und dessen Bedrohung für Europa hervorgehoben. Seine Schriften, wie „Vom Kriege wider die Türken“, werden zitiert, um seine politische Meinung und Kritik zu belegen und die enge Verbindung von Politik und Glauben in seinem Denken aufzuzeigen. Die grausamen Handlungen der Türken werden ebenso beschrieben wie Luthers Anerkennung bestimmter Aspekte der türkischen Gesellschaft und Kultur (Staatsordnung, Erziehung, Wissenschaft). Diese ambivalente Sicht wird kritisch beleuchtet und der scheinbare Widerspruch zwischen Anerkennung und Verurteilung wird aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Martin Luther, Türkengefahr, Osmanisches Reich, Islam, Christentum, Sprachgestaltung, Rhetorik, Politik, Religion, historischer Kontext, Theologie, Sprachwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Luthers Verhältnis zum Islam und zur „Türkengefahr“
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht Martin Luthers Verhältnis zum Islam und zur „Türkengefahr“ seiner Zeit. Sie analysiert Luthers politische und theologische Sichtweise auf die Osmanen und beleuchtet die sprachliche Gestaltung seiner Äußerungen über die Türken. Die Arbeit zielt darauf ab, Luthers Wahrnehmung der Türken als Bedrohung für das Christentum und die europäische Gesellschaft zu belegen und die sprachlichen Mittel zu untersuchen, mit denen er diese Bedrohung darstellte.
Welche Hauptthesen werden in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit vertritt zwei zentrale Thesen: Erstens, dass Luther im türkischen Volk eine Gefahr für das Christentum und die europäische Gesellschaft sah; und zweitens, dass die eindeutige und konkrete Sprache Luthers den Ernst seiner Wahrnehmung der „Türkengefahr“ und deren Stellenwert verdeutlicht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Luthers politische und gesellschaftliche Einschätzung der Türken; Luthers theologische Sicht auf den Islam und die „Türkengefahr“; die sprachliche Gestaltung von Luthers Äußerungen über die Türken; ein Vergleich der sprachlichen Mittel Luthers gegenüber verschiedenen Gegnern (Türken, Juden, Papst); und die Verbindung von Politik und Religion in Luthers Denken.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Luthers Meinung über die Türken (unterteilt in politische/gesellschaftliche und theologische Sichtweise), ein Kapitel zur sprachlichen Gestaltung Luthers (mit Unterkapiteln zu allgemeinen Aspekten, Belegung der zweiten These, sprachlicher Gestaltung gegenüber Juden und dem Papst sowie der sprachlichen Gestaltung gegenüber den Türken) und eine Zusammenfassung.
Wie wird Luthers Sicht auf die Türken aus politischer und gesellschaftlicher Perspektive dargestellt?
Dieses Kapitel beleuchtet Luthers Wissen über die Ausbreitung des Osmanischen Reiches und dessen Bedrohung für Europa. Es werden Schriften Luthers zitiert, um seine politische Meinung und Kritik zu belegen und die enge Verbindung von Politik und Glauben in seinem Denken aufzuzeigen. Die grausamen Handlungen der Türken werden ebenso beschrieben wie Luthers Anerkennung bestimmter Aspekte der türkischen Gesellschaft und Kultur.
Wie wird Luthers theologische Sicht auf die Türken behandelt?
Die theologische Perspektive analysiert Luthers Verständnis des Islam im Kontext der „Türkengefahr“. Es wird untersucht, wie er den Islam theologisch einordnete und wie diese Einordnung seine Sicht auf die Osmanen beeinflusste.
Welche Rolle spielt die sprachliche Analyse in der Arbeit?
Die sprachliche Analyse untersucht die sprachlichen Mittel, die Luther zur Darstellung der „Türkengefahr“ verwendete. Ein Vergleich mit seiner Sprache gegenüber anderen Gegnern (Juden, Papst) soll die Besonderheiten seiner Rhetorik im Kontext der „Türkengefahr“ hervorheben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Martin Luther, Türkengefahr, Osmanisches Reich, Islam, Christentum, Sprachgestaltung, Rhetorik, Politik, Religion, historischer Kontext, Theologie, Sprachwissenschaft.
- Citar trabajo
- Josef Kerkhoff (Autor), 2017, Luther und die Sprache des Konflikts. Eine Bewertung der Türkengefahr anhand ihrer sprachlichen Darstellung durch Luther, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378601