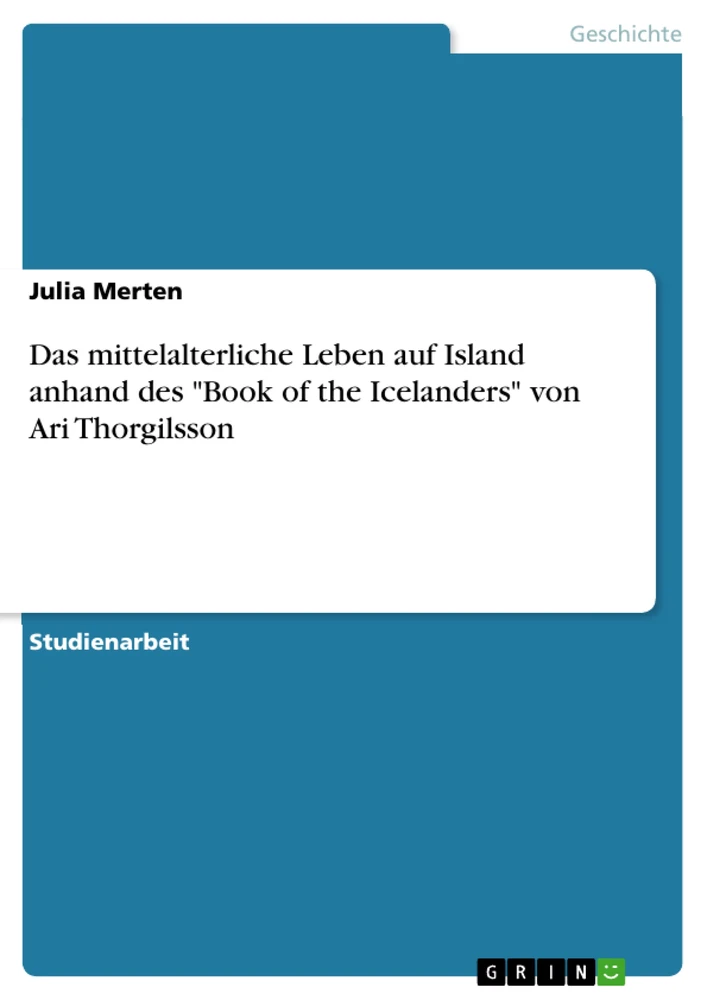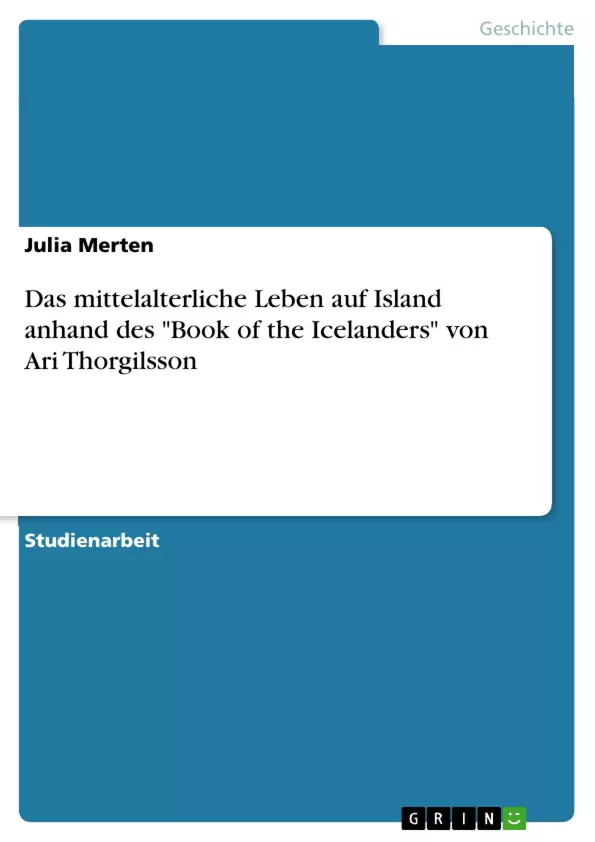Wie sah das Leben im Mittelalter auf Island aus? Welche Grundsteine wurden für die heutige Gesellschaft gelegt? Wovon ernährten sich die Isländer? All das möchte ich mithilfe von Quellen und Sekundärliteratur herausfinden und erarbeiten. Das "Book of the Icelanders" von Ari Thorgilsson, welches um 1125 geschrieben wurde, scheint gut geeignetes Quellenmaterial zu sein, da der Bestand an weiterer, vergleichbarer Literatur äußerst begrenzt ist.
Das "Book of the Icelanders" (isl.: Íslendingabók) beinhaltet Überlieferungen über die Besiedlung Islands, die Errichtung einer Gesetzgebung und der Aufteilung des Landes in Viertel, der Jahresberechnung, der Besiedlung des benachbarten Grönlands und der Christianisierung Islands. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Besiedlung Islands
- Die Gesetzgebung
- Die Einteilung in Viertel
- Die Besiedlung Grönlands
- Die Christianisierung Islands
- Die Armen- und Altenfürsorge
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht anhand des „Book of the Icelanders“ von Ari Thorgilsson das mittelalterliche Leben auf Island. Das Ziel ist es, mithilfe von Quellen und Sekundärliteratur ein Bild vom isländischen Alltag, seiner Entstehung und frühen Entwicklung zu zeichnen, unter besonderer Berücksichtigung der Grenzen und des Wertes der benutzten Quelle. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Quellenkritik im Umgang mit Gründungsmythen.
- Die Besiedlung Islands und die Rolle von Norwegern und irischen Mönchen
- Die Entwicklung der isländischen Gesetzgebung und des Alþingi
- Die Christianisierung Islands und ihr Einfluss auf die Gesellschaft
- Die Darstellung der isländischen Gesellschaft im „Book of the Icelanders“
- Die Bewertung des „Book of the Icelanders“ als historische Quelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit – die Rekonstruktion des mittelalterlichen Lebens auf Island anhand des „Book of the Icelanders“ – und erläutert die Herausforderungen der Quellenkritik, insbesondere im Hinblick auf die zeitliche Distanz zwischen den Ereignissen und der Niederschrift, sowie die Einstufung des Werkes als Gründungsmythos. Es wird auf die Bedeutung der mündlichen Überlieferung (Oral History) hingewiesen und der Vergleich mit dem „Landnámabók“ angedeutet. Die Einleitung stellt die Frage nach dem Wert und der Zuverlässigkeit der Quelle, und betont die Notwendigkeit, zwischen bewusster Manipulation und authentischer Überlieferung zu unterscheiden.
Die Besiedlung Islands: Dieses Kapitel beschreibt die Ankunft der Norweger um 870 n. Chr. und deren Interaktion mit bereits auf Island lebenden irischen Mönchen. Es wird die Frage nach den Motiven der norwegischen Einwanderung diskutiert – Flucht vor König Harald Schönhaar oder gezielte Expansion. Das Kapitel analysiert die dargestellte Landschaft Islands und die angebliche friedliche Vertreibung der irischen Mönche, wobei die Glaubwürdigkeit dieser Darstellung kritisch hinterfragt wird. Die umfangreiche Emigration aus Norwegen wird erläutert, und der Zusammenhang mit der Herrschaft Haralds Schönhaars wird untersucht. Das Kapitel schließt mit der Aussage, dass die Besiedlung Islands innerhalb von 60 Jahren abgeschlossen war und die Bedeutung der „stolzen Gesinnung“ der norwegischen Einwanderer hervorhebt.
Die Gesetzgebung: Das Kapitel beschreibt die Gründung des isländischen Parlaments Alþingi im Jahre 930 durch Ulfjot und erläutert die vorherigen Volksversammlungen in Kjalarness unter Thorstein, dem Sohn von Ingolf dem Siedler. Der Text legt den Fokus auf die Bedeutung dieser Entwicklung für die politische Ordnung Islands. Der Abschnitt analysiert die Rolle von Thorstein und seinem hohen gesellschaftlichen Status, sowie die allmähliche Entwicklung einer stabilen politischen Struktur im frühen Island.
Schlüsselwörter
Book of the Icelanders, Íslendingabók, Ari Thorgilsson, Mittelalterliches Island, Besiedlung Islands, Christianisierung Islands, Gesetzgebung, Alþingi, Gründungsmythos, Oral History, Quellenkritik, Norwegen, irische Mönche, Landnahme.
Häufig gestellte Fragen zum "Book of the Icelanders"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das mittelalterliche Leben auf Island anhand von Ari Thorgilssons „Book of the Icelanders“. Sie rekonstruiert den isländischen Alltag, seine Entstehung und frühe Entwicklung, unter Berücksichtigung der Quellenkritik und der Grenzen des benutzten Textes als Gründungsmythos. Die Arbeit umfasst die Besiedlung Islands, die Entwicklung der Gesetzgebung und des Alþingi, die Christianisierung und die isländische Gesellschaft. Dabei wird die Bedeutung der mündlichen Überlieferung und der Vergleich mit dem „Landnámabók“ diskutiert.
Welche Themen werden im "Book of the Icelanders" behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Besiedlung Islands mit der Rolle der Norweger und irischen Mönche, die Entwicklung der isländischen Gesetzgebung und des Alþingi, die Christianisierung Islands und deren gesellschaftlichen Einfluss, sowie die Darstellung der isländischen Gesellschaft im „Book of the Icelanders“ selbst. Ein wichtiger Aspekt ist die Bewertung des Werks als historische Quelle und die damit verbundenen Herausforderungen der Quellenkritik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Besiedlung Islands, ein Kapitel zur isländischen Gesetzgebung, ein Kapitel zur Christianisierung Islands und eine Konklusion. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und die Herausforderungen der Quellenkritik. Die Kapitel behandeln detailliert die jeweiligen Themen mit Analysen und kritischen Bewertungen der Quellenangaben.
Wie wird die Besiedlung Islands dargestellt?
Das Kapitel zur Besiedlung Islands beschreibt die Ankunft der Norweger um 870 n. Chr. und deren Interaktion mit irischen Mönchen. Es diskutiert die Motive der norwegischen Einwanderung (Flucht vor König Harald Schönhaar oder Expansion) und analysiert die dargestellte Landschaft und die angebliche friedliche Vertreibung der irischen Mönche. Die Glaubwürdigkeit dieser Darstellung wird kritisch hinterfragt. Die umfangreiche Emigration aus Norwegen und der Zusammenhang mit Haralds Herrschaft werden untersucht. Der Abschluss des Besiedlungsprozesses innerhalb von 60 Jahren und die Bedeutung der „stolzen Gesinnung“ der Einwanderer werden hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die Gesetzgebung?
Das Kapitel zur Gesetzgebung beschreibt die Gründung des Alþingi im Jahre 930 durch Ulfjot und die vorherigen Volksversammlungen in Kjalarness. Es konzentriert sich auf die Bedeutung dieser Entwicklung für die politische Ordnung Islands und analysiert die Rolle von Thorstein und seinem hohen gesellschaftlichen Status sowie die Entwicklung einer stabilen politischen Struktur im frühen Island.
Welche Bedeutung hat die Quellenkritik in dieser Arbeit?
Quellenkritik spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit betont die Herausforderungen im Umgang mit dem „Book of the Icelanders“ als Gründungsmythos und die Notwendigkeit, zwischen bewusster Manipulation und authentischer Überlieferung zu unterscheiden. Die zeitliche Distanz zwischen Ereignissen und Niederschrift wird berücksichtigt, und die Bedeutung der mündlichen Überlieferung (Oral History) wird hervorgehoben. Der Vergleich mit dem „Landnámabók“ wird angedeutet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Book of the Icelanders, Íslendingabók, Ari Thorgilsson, Mittelalterliches Island, Besiedlung Islands, Christianisierung Islands, Gesetzgebung, Alþingi, Gründungsmythos, Oral History, Quellenkritik, Norwegen, irische Mönche, Landnahme.
- Quote paper
- Julia Merten (Author), 2014, Das mittelalterliche Leben auf Island anhand des "Book of the Icelanders" von Ari Thorgilsson, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375463