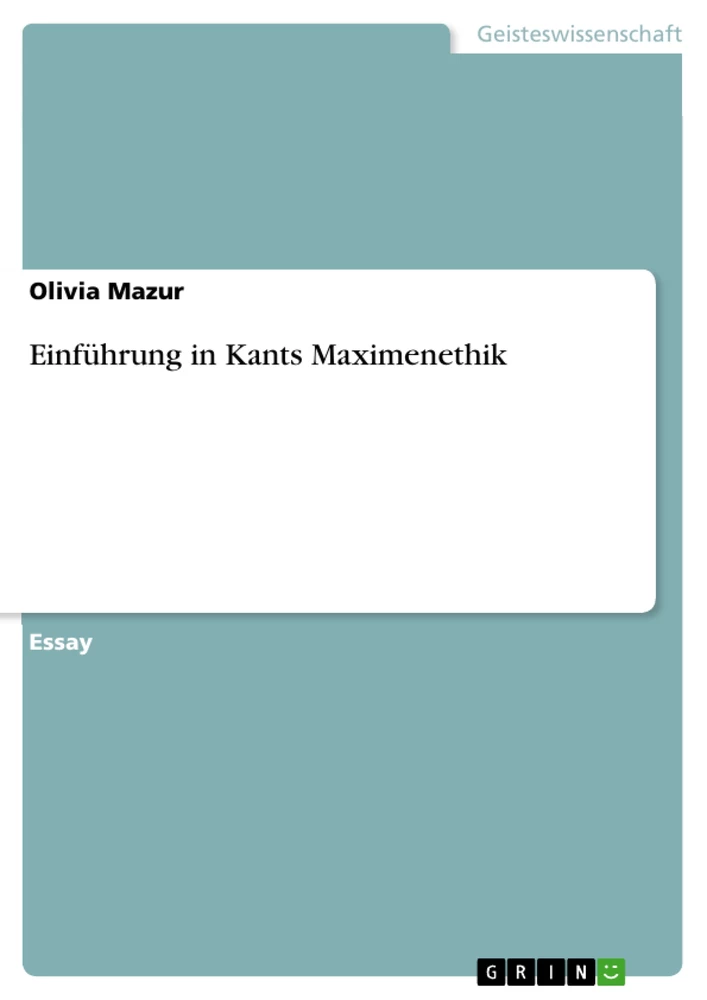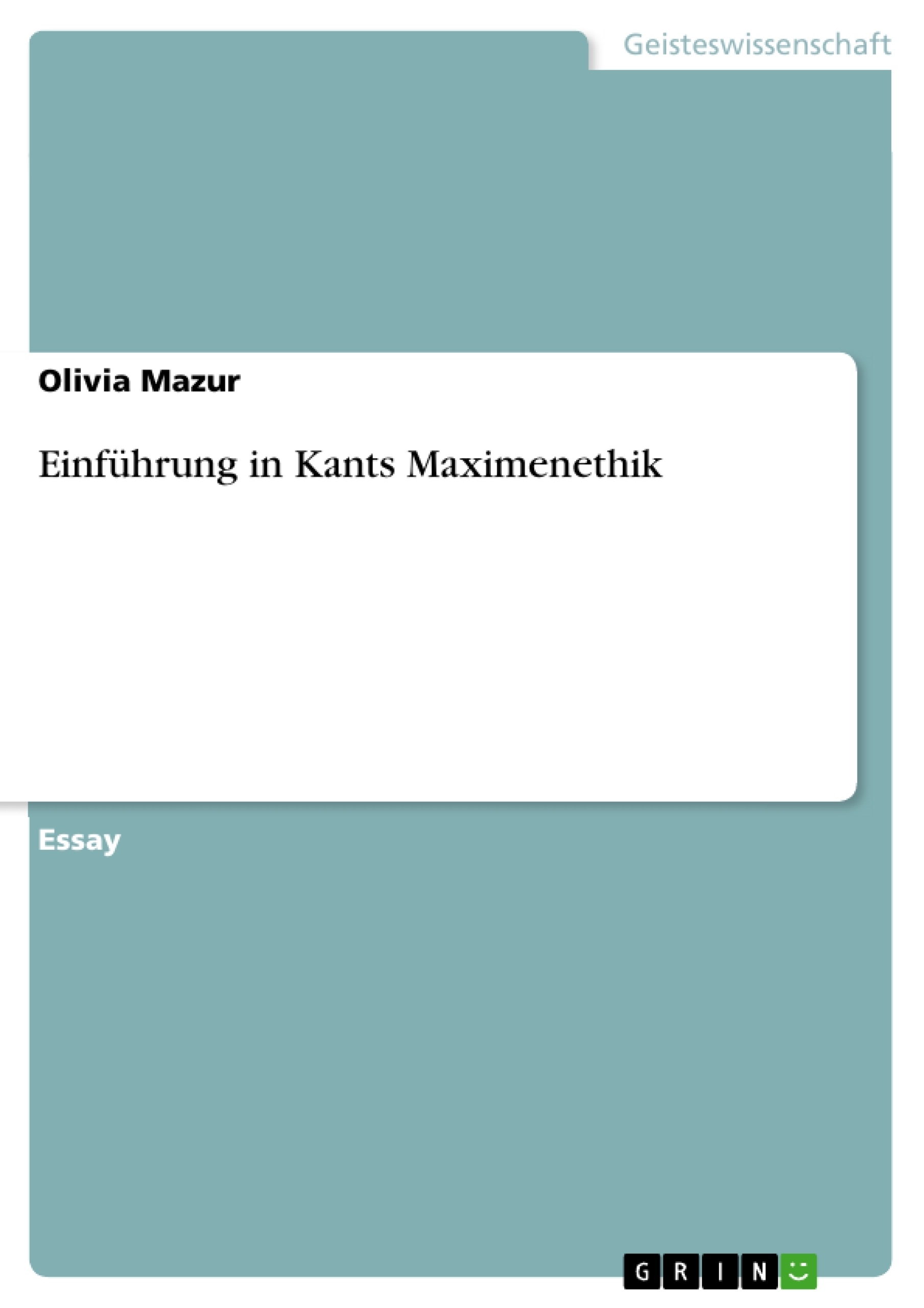Diese Arbeit gibt eine Einführung in die Transzendentalphilosophie und Maximenethik Immanuel Kants. Kants Philosophie nennt man „Transzendentalphilosophie“, da sie aus einem System der Prinzipien der reinen Vernunft besteht. Damit möchte Kant zeigen, dass der Empirismus als philosophische Position nicht haltbar ist. Er meint, dass viel mehr Empirisches notwendigerweise Nicht-Empirisches voraussetzt. Dabei unterscheidet er zwischen dem erfahrenden Subjekt und all dem, was diesem Subjekt in der Erfahrung objektiv gegeben und insofern Gegenstand der Erfahrung ist. Obwohl Subjekt und Objektiv zu unterscheiden sind, sind sie dennoch aufeinander bezogen.
Wittgenstein vergleicht dieses Phänomen in seinem Werk „Tractatus logico-philosophicus“ mit dem Bild von Auge und Gesichtsfeld. Dabei wird gezeigt, dass das Auge Bedingung und Voraussetzung für das Gesichtsfeld ist, denn gäbe ohne das sehende Auge gäbe es auch kein Gesichtsfeld. So ist das Auge die Bedingung der Möglichkeit des Gesichtsfeldes, obwohl das Auge nie im Gesichtsfeld vorkommt und kein Gegenstand davon ist. Dieses Bild des sehendes Augen kann man mit dem Begriff der „Transzendentale Differenz“ vergleichen, denn so ähnlich wie das Auge Bedingung und Voraussetzung des Gesichtsfeldes ist, ist das erfahrende Subjekt bei Kant Bedingung und Voraussetzung des Inbegriffs dessen, was ihm in der Erfahrung gegeben ist, also aller Erfahrungsobjekte unserer gesamten Erkenntnis. Das bedeutet, dass der Mensch gleichzeitig Bedingung und Voraussetzung der objektiven Erfahrungswelt ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung zur Kants Transzendalphilosophie
- 2. Der kategorische Imperativ
- 3. Antithesen der Motivation
- 3.1 material-formal
- 3.2 subjektiv-objektiv
- 3.3 hypothetisch-kategorisch
- 3.4 autonomie-heteronom
- 4. Konkretisierung des Moralprinzips
- 4.1 Warum ist die Maximethik nicht konkretisierbar?
- 5. Gut und Böse
- 6. Die moralisch relevante Freiheit
- 7. Moralvergleich: Kant und Nietzsche
- 8. Persönliche Überlegungen zum Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Kants transzendentale Philosophie und deren Anwendung auf seine Maximethik. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des kategorischen Imperativs und seiner Implikationen für moralisches Handeln. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Antithesen der Motivation und diskutiert die Frage der Konkretisierbarkeit des Moralprinzips.
- Kants Transzendentalphilosophie und ihre Grundlagen
- Der kategorische Imperativ als zentrales Moralprinzip
- Differenzierung verschiedener Motivationstypen
- Die Problematik der Konkretisierung des Moralprinzips
- Der Vergleich der Ethik Kants mit der Nietzsche's
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung zur Kants Transzendalphilosophie: Diese Einleitung führt in Kants Transzendentalphilosophie ein, die sich durch ein System von Prinzipien der reinen Vernunft auszeichnet. Kant widerlegt den Empirismus, indem er argumentiert, dass empirisches Wissen nicht-empirisches Wissen voraussetzt. Er verwendet das Beispiel der transzendentalen Differenz zwischen erfahrendem Subjekt und Erfahrungsobjekt, wobei beide voneinander abhängig sind, analog zu Wittgensteins Vergleich von Auge und Gesichtsfeld. Kant postuliert, dass der Mensch die Dinge nicht an sich, sondern nur in ihrer Erscheinung erkennt, wobei "a priori" Erkenntnisse eine zentrale Rolle spielen. Diese "a priori" Kategorien der reinen Vernunft sind für Kant universell und ermöglichen jedem Menschen die gleichen Erkenntnismöglichkeiten.
2. Der kategorische Imperativ: Dieses Kapitel erklärt den kategorischen Imperativ als Handlungsgrundsatz: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde." Maximen sind subjektive praktische Grundsätze, die uneingeschränkt und allgemeingültig sein müssen. Kant betont die Notwendigkeit, aus Pflicht und nicht aus Neigung zu handeln. Beispiele verdeutlichen den Unterschied zwischen moralisch gutem Handeln aus Pflicht und moralisch schlechtem Handeln aus Eigeninteresse. Der Gebrauch anderer Personen lediglich als Mittel wird verurteilt; sie müssen immer auch als Zweck an sich betrachtet werden. Der kategorische Imperativ zielt auf Handeln aus reiner Vernunft und frei von Lust-Unlust-Motivation ab, mit dem "Reich der Zwecke" als moralischem Ideal einer Gemeinschaft, in der alle vernünftigen Wesen sich selbst und andere als Zweck behandeln.
Schlüsselwörter
Transzendentale Philosophie, Kants Maximethik, Kategorischer Imperativ, Motivation, Moralprinzip, Pflicht, Neigung, Autonomie, Heteronomie, Reich der Zwecke, allgemeingültige Maxime.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kants Transzendentale Philosophie und Maximethik
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert Kants transzendentale Philosophie und ihre Anwendung auf seine Maximethik. Schwerpunkte sind der kategorische Imperativ, verschiedene Antithesen der Motivation und die Problematik der Konkretisierung des Moralprinzips. Ein Vergleich mit Nietzsches Ethik wird ebenfalls vorgenommen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Kants Transzendentalphilosophie, den kategorischen Imperativ als zentrales Moralprinzip, verschiedene Motivationstypen (z.B. material-formal, subjektiv-objektiv, hypothetisch-kategorisch, autonom-heteronom), die Schwierigkeit der Konkretisierung des Moralprinzips, und einen Vergleich zwischen Kants und Nietzsches Ethik.
Was ist der kategorische Imperativ nach Kant?
Der kategorische Imperativ ist Kants Handlungsgrundsatz: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde." Er fordert Handeln aus Pflicht und nicht aus Neigung und betont, dass Menschen nicht nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck an sich betrachtet werden müssen.
Welche Antithesen der Motivation werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Antithesen der Motivation, darunter material-formal, subjektiv-objektiv, hypothetisch-kategorisch und autonom-heteronom. Diese Antithesen helfen, das Verständnis des kategorischen Imperativs und der moralischen Handlung zu vertiefen.
Warum ist die Konkretisierung des Moralprinzips problematisch?
Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Konkretisierung des Moralprinzips, also die Frage, wie der kategorische Imperativ in konkreten Situationen angewendet werden kann. Ein Kapitel ist speziell der Frage gewidmet, warum die Maximethik nicht konkretisierbar ist.
Wie wird Kants Ethik mit der Nietzsches verglichen?
Die Arbeit enthält ein Kapitel, das einen Vergleich zwischen Kants und Nietzsches Ethik anstellt, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Philosophien aufzuzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung zur Kants Transzendentalphilosophie, Der kategorische Imperativ, Antithesen der Motivation, Konkretisierung des Moralprinzips, Gut und Böse, Die moralisch relevante Freiheit, Moralvergleich: Kant und Nietzsche, und Persönliche Überlegungen zum Schluss.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Transzendentale Philosophie, Kants Maximethik, Kategorischer Imperativ, Motivation, Moralprinzip, Pflicht, Neigung, Autonomie, Heteronomie, Reich der Zwecke, allgemeingültige Maxime.
Wie wird Kants Transzendentale Philosophie eingeführt?
Die Einleitung führt in Kants Transzendentalphilosophie ein, indem sie dessen System der Prinzipien der reinen Vernunft erläutert, den Empirismus widerlegt und die Rolle der "a priori" Erkenntnisse hervorhebt. Der Vergleich zwischen erfahrendem Subjekt und Erfahrungsobjekt wird anhand des Beispiels von Wittgenstein diskutiert.
- Citar trabajo
- Olivia Mazur (Autor), 2017, Einführung in Kants Maximenethik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373898