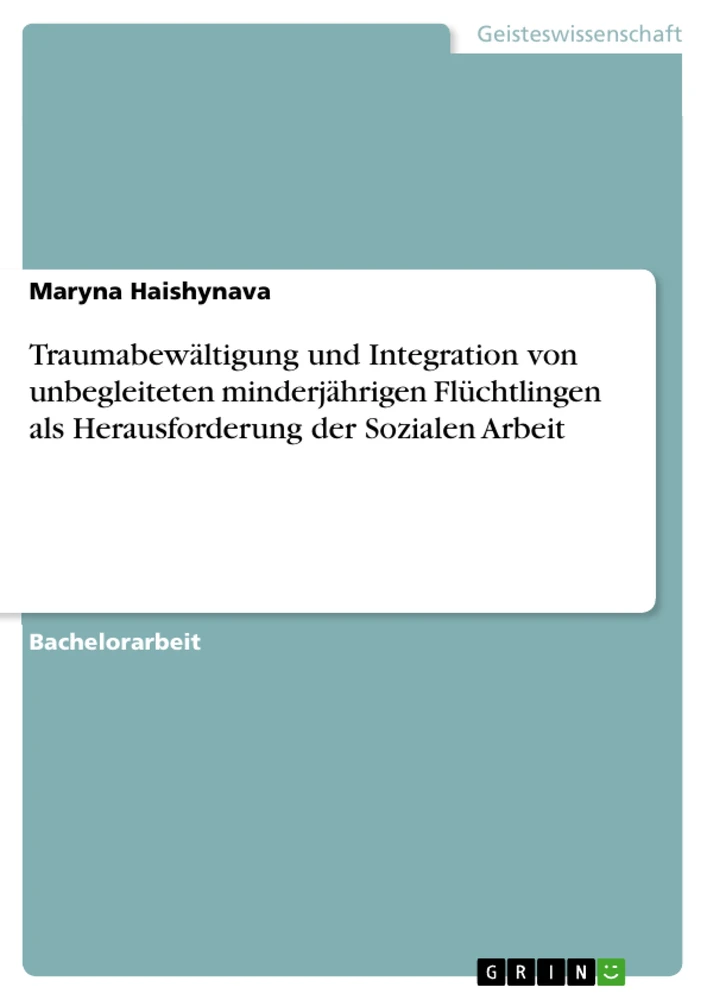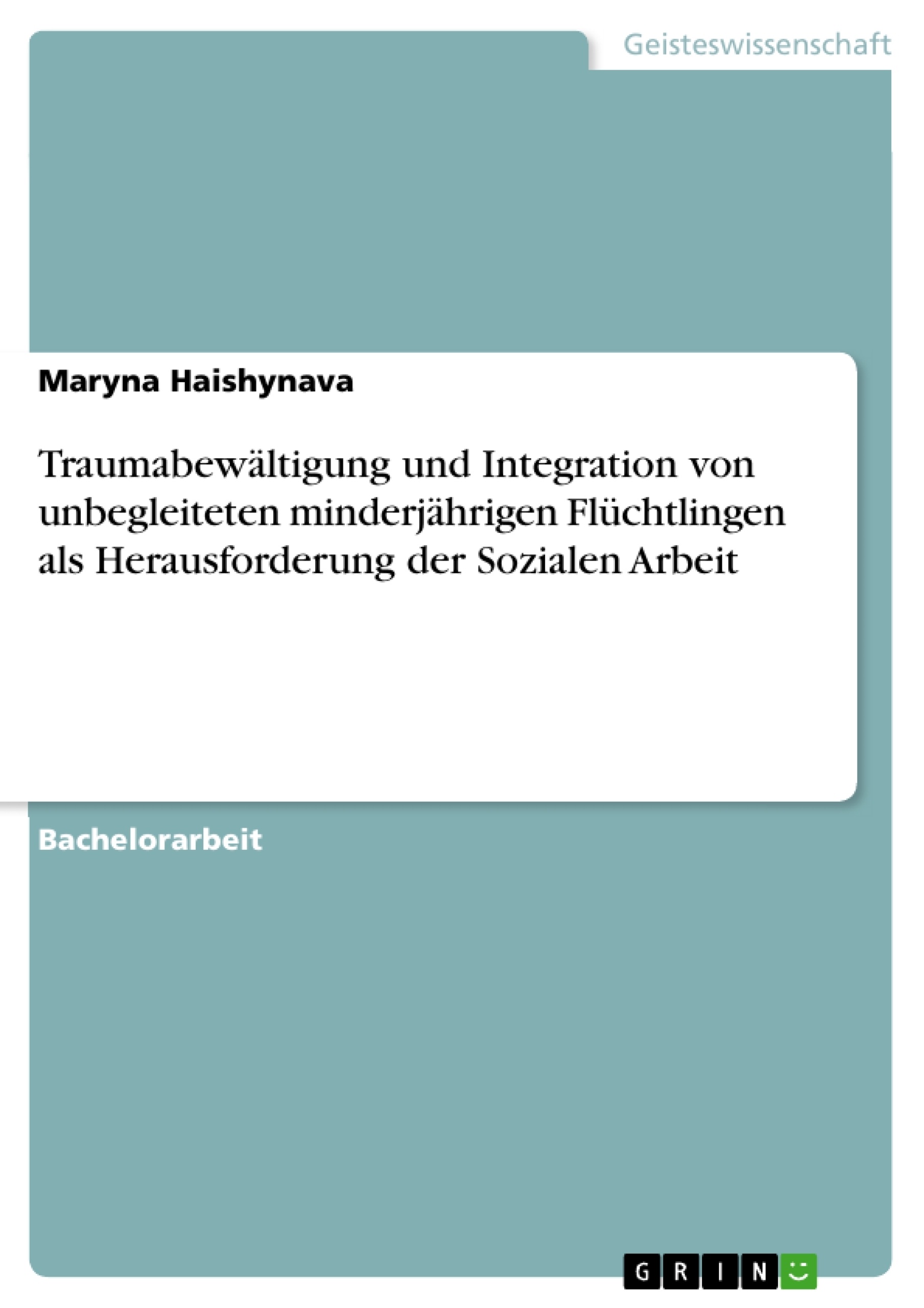1 Einleitung
Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern oder anderen begleitenden Personen nach Deutschland kommen, nennt man unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Im neuen Land stehen sie neuen gesellschaftlichen Verhältnissen gegenüber und müssen sich der neuen Umgebung anpassen. Hinzu kommt, dass junge Leute noch oft traumatisiert sind. Das Leben in der neuen Heimat und unter fremden Menschen, deren Sprache sie nicht verstehen, beinhaltet in sich viele Herausforderungen für sie selbst und auch für die SozialarbeiterInnen der Kinder- und Jugendhilfe.
Die vorliegende Bachelorarbeit hat zum Ziel die Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Umgang mit traumatisierten minderjährigen Flüchtlingen herauszuarbeiten. Um diese Frage beantworten zu können, wird die Situation von UMF aus sozialpolitischer, rechtlicher und psychosozialer Sicht aufgezeigt. Dabei sollen auch die folgenden Kernfragen beantwortet werden:
• Welche Einwirkung hat die erlebte Vergangenheit und die aktuelle Situation auf den psychischen Zustand von UMF?
• Welche Maßnahmen sind für die Traumabewältigung und Integration von UMF notwendig?
1.1 Aufbau der Arbeit
Das zweite Kapitel dient zu einer Einführung in die Thematik. Zunächst wird auf die Definition des Begriffs „minderjähriger unbegleiteter Flüchtling“ eingegangen. Anschließend wird ein Überblick verschafft, aus welchen Gründen UMF fliehen, welche Hauptfluchtländer und welche Haupteinreiseorte davon betroffen sind.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den rechtlichen Grundlagen. Es werden zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt, die auf europäischer Ebene wichtige Grundlagen für den Umgang mit UMF bieten, wie die UN-Kinderrechtskonvention, das Haager Kinderschutzübereinkommen, die Genfer Flüchtlingskonvention, die Dubliner Verordnung und die EU-Aufnahme- und Qualifikationsrichtlinie. Weiter werden in diesem Kapitel die nationalen Gesetzesgrundlagen und der Nationale Aktionsplan vorgestellt.
Im vierten Kapitel werden die Lebenssituation von UMF und ihr psychisches Befinden beschrieben.
Das dritte Kapitel beinhaltet den Aspekt der Traumatisierung. In diesem Kapitel soll beschrieben werden, was der Begriff „Traumatisierung“ bedeutet, welche mögliche Folgen von Traumata geben und inwiefern UMF von einer Traumatisierung betroffen sein können.
Im weiteren Kapitel wird der Aspekt auf die Traumabewältigung und Integration von UMF gelegt und anschließend die
die Herausforderungen für die SozialarbeiterInnen
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- 2.1 Begriffsdefinition
- 2.1.1 Definition des Begriffes „unbegleitet“
- 2.1.2 Definition des Begriffes „minderjährig“
- 2.1.3 Definition des Begriffes „Flüchtling“
- 2.2 Fluchtursachen und Motive
- 2.3 Aktuelle Situation in Deutschland
- 3 Rechtliche Lage von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
- 3.1 Internationale Schutzkonventionen für unbegleitete Minderjährige
- 3.1.1 Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)
- 3.1.2 Die UN-Kinderrechtskonvention (KRK)
- 3.1.3 Das Haager Kinderschutzübereinkommen (KSÜ)
- 3.1.4 Entschließung des Rates der Europäischen Union vom 26. Juni 1997
- 3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen der Europäischen Union
- 3.2.1 EU-Aufnahmerichtlinie und Qualifikationsrichtlinie
- 3.2.2 Die Dublin III-Verordnung
- 3.3 Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland
- 3.3.1 Das Grundgesetz (GG)
- 3.3.2 Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- 3.3.3 Das Asylgesetz (AsylG)
- 3.3.4 Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- 3.3.5 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
- 4 Die Lebenssituation von UMF und psychisches Befinden
- 4.1 Der Hintergrund der Lebenssituation von UMF
- 4.1.1 Erfahrungen aus der Heimat
- 4.1.2 Erfahrungen auf der Flucht
- 4.2 Psychisches Befinden
- 4.2.1 Adoleszenz im Fluchtkontext
- 5 Der Begriff Trauma und Traumafolgestörungen
- 5.1 Trauma. Begriffsdefinition
- 5.2 Arten von Traumatisierungen
- 5.3 Traumafolgestörungen
- 5.3.1 Akute Belastungsstörung
- 5.3.2 Posttraumatische Belastungsstörung
- 5.3.2.1 Symptome des intrusiven Wiedererlebens
- 5.3.2.2 Symptome des Vermeidungsverhalten
- 5.3.2.3 Erhöhte Angstbedingte Erregung
- 5.3.3 Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung - DESNOS
- 5.4 Erkennungsmöglichkeiten einer Traumatisierung bei UMF
- 6 Traumabewältigung und Integrationsmöglichkeiten von UMF
- 6.1 Unterstützungsmaßnahmen für traumatisierte UMF
- 6.1.1 Bezugspersonen
- 6.1.2 Forderung von Resilienz
- 6.2 Therapie zur Traumabewältigung
- 6.2.1 Stabilisierungsphase
- 6.2.2 Bearbeitungsphase
- 6.2.3 Integrationsphase
- 6.3 Besonderheiten der Traumatherapie mit UMF
- 6.4 Möglichkeiten der Integration
- 6.4.1 Integration durch Bildung
- 6.4.1.1 Vorschulprogramm als die erste Stufe der Bildungsintegration
- 6.4.1.2 Integration in der Schule
- 6.4.1.3 Ausbildung
- 6.4.2 Projekte
- 7 Herausforderungen für die Soziale Arbeit
- 7.1 Spezifisches Wissen und Können
- 7.2 Herausforderungen
- 8 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Umgang mit traumatisierten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF). Sie beleuchtet die Situation der UMF aus sozialpolitischer, rechtlicher und psychosozialer Perspektive. Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen der Vergangenheit und der aktuellen Lebenssituation auf den psychischen Zustand der UMF zu analysieren und notwendige Maßnahmen für Traumabewältigung und Integration aufzuzeigen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für UMF auf europäischer und nationaler Ebene
- Psychosoziale Auswirkungen von Flucht und Trauma auf UMF
- Notwendige Unterstützungsmaßnahmen zur Traumabewältigung
- Möglichkeiten der Integration von UMF in die Gesellschaft
- Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Umgang mit UMF
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (UMF) ein und beschreibt die Herausforderungen für die Soziale Arbeit. Sie benennt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Herausforderungen im Umgang mit traumatisierten UMF herauszuarbeiten und die Situation der UMF aus sozialpolitischer, rechtlicher und psychosozialer Sicht zu beleuchten. Die Einleitung skizziert die zentralen Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen, und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
2 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Dieses Kapitel definiert den Begriff „unbegleiteter minderjähriger Flüchtling“ und beleuchtet Fluchtursachen und -motive sowie die aktuelle Situation von UMF in Deutschland. Es liefert eine umfassende Grundlage zum Verständnis der sozioökonomischen und politischen Hintergründe der Migration und der spezifischen Herausforderungen, denen UMF gegenüberstehen. Die Definitionen der einzelnen Begriffe schaffen ein gemeinsames Verständnis der Thematik.
3 Rechtliche Lage von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für UMF auf internationaler (Genfer Flüchtlingskonvention, UN-Kinderrechtskonvention, Haager Kinderschutzübereinkommen), europäischer (EU-Aufnahmerichtlinie, Dublin III-Verordnung) und nationaler Ebene (Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB VIII). Es zeigt die komplexen rechtlichen Regelungen auf, die den Umgang mit UMF bestimmen und ihre Rechte schützen sollen. Die Darstellung der verschiedenen Rechtsgrundlagen verdeutlicht die vielschichtige rechtliche Situation.
4 Die Lebenssituation von UMF und psychisches Befinden: Dieses Kapitel beschreibt die Lebenssituation von UMF, ihre Erfahrungen in der Heimat und auf der Flucht, sowie ihr psychisches Befinden. Es beleuchtet die Traumatisierungserfahrungen, die viele UMF gemacht haben, und deren Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit. Der Fokus liegt auf den vielfältigen Belastungen, denen UMF ausgesetzt sind und deren Folgen für ihre Entwicklung. Die Adoleszenz im Kontext von Flucht wird als besonderer Aspekt der Problematik diskutiert.
5 Der Begriff Trauma und Traumafolgestörungen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Trauma“ und beschreibt verschiedene Arten von Traumatisierungen und die daraus resultierenden Traumafolgestörungen (akute Belastungsstörung, PTBS, komplexe PTBS). Es erläutert die Symptome dieser Störungen und deren Auswirkungen auf die Betroffenen, sowie die Herausforderungen bei der Erkennung von Traumatisierungen bei UMF. Die detaillierte Beschreibung der Traumatypen bildet eine wichtige Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel zur Traumabewältigung.
6 Traumabewältigung und Integrationsmöglichkeiten von UMF: Dieses Kapitel befasst sich mit Unterstützungsmaßnahmen für traumatisierte UMF, Therapiemöglichkeiten zur Traumabewältigung (Stabilisierung, Bearbeitung, Integration) und Besonderheiten der Traumatherapie mit UMF. Es analysiert verschiedene Integrationsmöglichkeiten, insbesondere durch Bildung (Vorschulprogramm, Schule, Ausbildung) und Projekte. Die Kapitel unterstreicht die Wichtigkeit von ganzheitlichen Ansätzen, die sowohl die Traumabewältigung als auch die Integration in die Gesellschaft fördern.
7 Herausforderungen für die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Umgang mit UMF. Es benennt spezifisches Wissen und Können, das für die Arbeit mit traumatisierten UMF erforderlich ist und skizziert allgemeine Herausforderungen, denen SozialarbeiterInnen bei der Unterstützung von UMF gegenüberstehen. Das Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit spezialisierter Ausbildung und Unterstützungssysteme für SozialarbeiterInnen in diesem Bereich.
Schlüsselwörter
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Trauma, Traumatisierung, Traumafolgestörungen, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Integration, Traumabewältigung, Soziale Arbeit, Rechtliche Rahmenbedingungen, Flucht, Asyl, Kinder- und Jugendhilfe, Resilienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Trauma
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Umgang mit traumatisierten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF). Sie beleuchtet die Situation der UMF aus sozialpolitischer, rechtlicher und psychosozialer Perspektive und analysiert die Auswirkungen von Flucht und Trauma auf deren psychischen Zustand. Ziel ist es, notwendige Maßnahmen zur Traumabewältigung und Integration aufzuzeigen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Rechtliche Rahmenbedingungen für UMF auf europäischer und nationaler Ebene, psychosoziale Auswirkungen von Flucht und Trauma auf UMF, notwendige Unterstützungsmaßnahmen zur Traumabewältigung, Möglichkeiten der Integration von UMF in die Gesellschaft und Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Umgang mit UMF.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Definition von UMF und deren Situation, rechtliche Lage von UMF, Lebenssituation und psychisches Befinden von UMF, Trauma und Traumafolgestörungen, Traumabewältigung und Integrationsmöglichkeiten, Herausforderungen für die Soziale Arbeit und Zusammenfassung. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Thematik.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert internationale Schutzkonventionen (Genfer Flüchtlingskonvention, UN-Kinderrechtskonvention, Haager Kinderschutzübereinkommen), europäische Richtlinien (EU-Aufnahmerichtlinie, Dublin III-Verordnung) und deutsche Gesetze (Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB VIII) im Kontext der rechtlichen Lage von UMF.
Wie wird das Thema Trauma behandelt?
Die Arbeit definiert den Begriff „Trauma“ und beschreibt verschiedene Arten von Traumatisierungen und die daraus resultierenden Traumafolgestörungen (akute Belastungsstörung, PTBS, komplexe PTBS). Sie erläutert Symptome, Auswirkungen und Herausforderungen bei der Erkennung von Traumatisierungen bei UMF und zeigt Therapiemöglichkeiten auf (Stabilisierung, Bearbeitung, Integration).
Welche Integrationsmöglichkeiten werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Integrationsmöglichkeiten für UMF, insbesondere durch Bildung (Vorschulprogramm, Schule, Ausbildung) und Projekte. Sie betont die Wichtigkeit ganzheitlicher Ansätze, die sowohl Traumabewältigung als auch gesellschaftliche Integration fördern.
Welche Herausforderungen für die Soziale Arbeit werden identifiziert?
Die Arbeit beschreibt spezifisches Wissen und Können, das für die Arbeit mit traumatisierten UMF erforderlich ist, und skizziert allgemeine Herausforderungen, denen Sozialarbeiter*innen bei der Unterstützung von UMF gegenüberstehen. Die Notwendigkeit spezialisierter Ausbildung und Unterstützungssysteme wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Trauma, Traumatisierung, Traumafolgestörungen, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Integration, Traumabewältigung, Soziale Arbeit, Rechtliche Rahmenbedingungen, Flucht, Asyl, Kinder- und Jugendhilfe, Resilienz.
- Arbeit zitieren
- Maryna Haishynava (Autor:in), 2017, Traumabewältigung und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen als Herausforderung der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373283