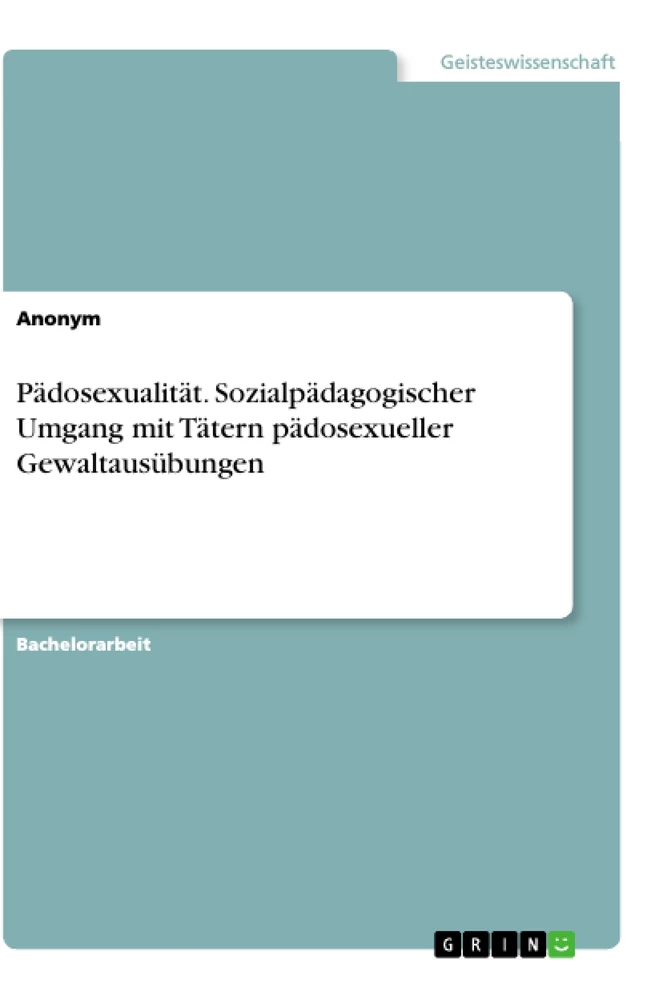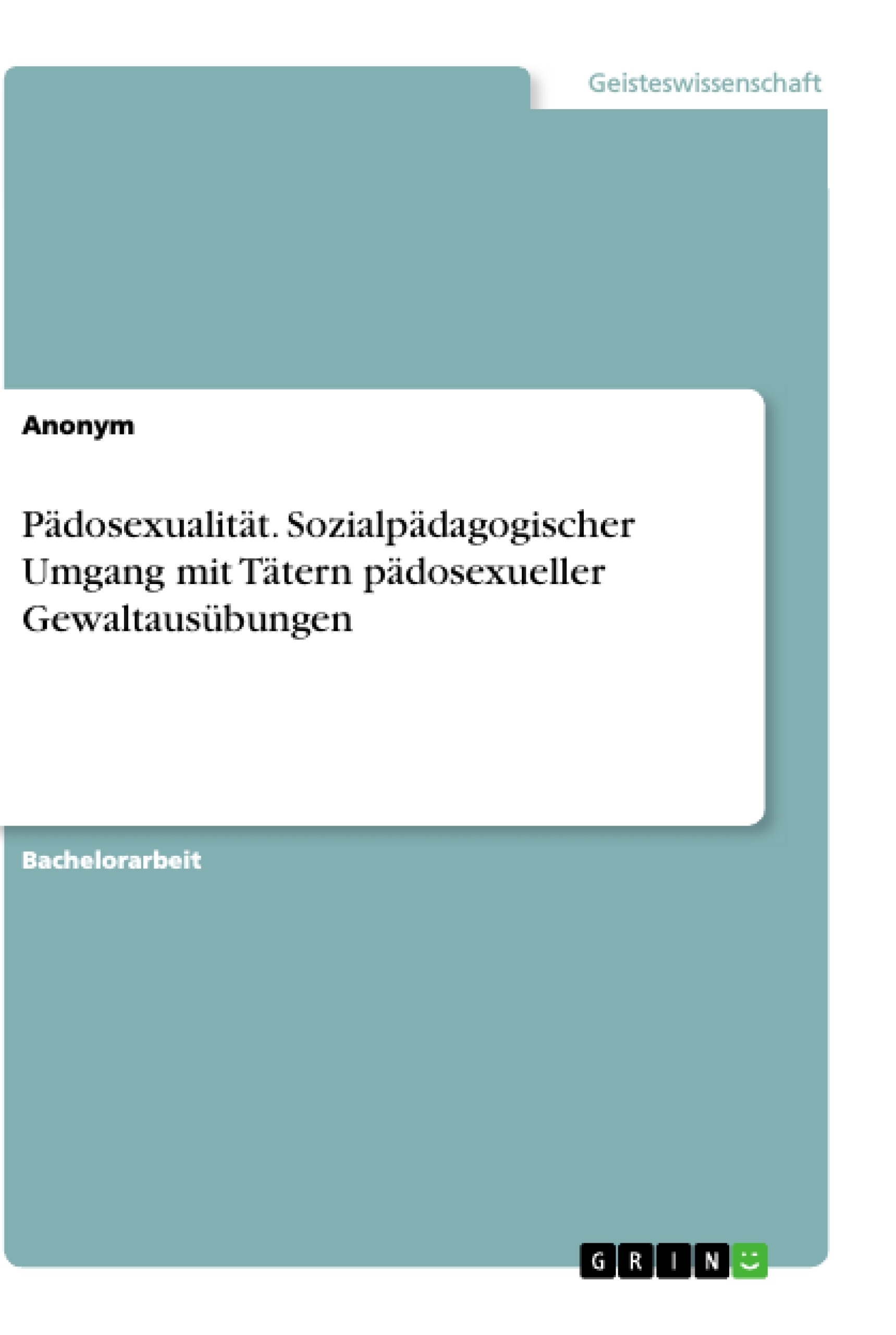Die Intention dieser Bachelorarbeit liegt vor allem darin, die Thematik der Pädosexualität aus neuen Perspektiven zu betrachten. Die Täter für immer "wegzusperren" ist keine Option. Das wäre nicht nur zu einfach, sondern würde das Problem auch nicht lösen. Alternativ möchte ich mich in dieser Arbeit verschiedenen sozialpädagogischen Umgangsformen mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung annähern. Denn Täterarbeit ist immer noch der beste Opferschutz.
Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, werde ich mich ausschließlich auf männliche Straftäter beziehen, welche in Deutschland leben. Die Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch werden ebenfalls keinen separaten Platz einnehmen. Literatur findet sich dazu allerdings – im Gegensatz zu dem hiesigen Thema – in hohem Maß.
Den Leser erwartet zunächst die Thematisierung der Begrifflichkeiten Pädophilie/ Pädosexualität und sexueller Missbrauch von Kindern in Form von definitorischen Erklärungen, sowie empirischen Befunden. Im Anschluss folgt ein historischer Rückblick des strafrechtlichen und gesellschaftlichen Umganges mit dem Phänomen Pädosexualität, der sich bis heute stets im Wandel befindet. In einem weiteren Kapitel werden Erklärungsansätze zur Entstehung von Pädosexualität erläutert, welche sowohl auf ätiologische, als auch auf situative Risikobedingungen zurück zu führen sind. Anschließend versuche ich mich an der Erstellung einer Tätertypologie. Ferner habe ich mich für die Thematisierung von zwei großen Behandlungs- bzw. Umgangsräumlichkeiten entschieden: dem Maßregelvollzug, sowie dem Strafvollzug. Nach näherer Betrachtung der Unterbringungsmöglichkeiten und deren rechtlichen Grundlagen, werde ich konkrete sozialarbeiterische Leitgedanken, sowie Methoden und besondere Herausforderungen für die Soziale Arbeit in den Vollzugsanstalten skizzieren, um in einem letzten inhaltlichen Kapitel diese Dinge konkret auf den pädosexuellen Straftäter anzuwenden.
Da die Arbeit einen sozialarbeiterischen Hintergrund hat, werden therapeutische und medikamentöse Behandlungsweisen kein Thema sein.
In einer persönlichen Schlussbetrachtung werde ich mit Bezug auf den gesamten Inhalt der Arbeit versuchen, die für die Soziale Arbeit zentralen Umgangsformen mit Tätern pädosexueller Gewaltausübungen aufzuführen und den Lesern weitere Denkanstöße zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1. Pädophilie
- 2.1.1. Definition nach ICD-10
- 2.1.2. Definition nach DSM-5
- 2.1.3. Begriffsproblematik: Pädophilie vs. Pädosexualität
- 2.2. Sexueller Missbrauch von Kindern
- 2.2.1. Rechtliche Grundlagen
- 2.2.2. Empirische Nachweise
- 2.2.3. Begriffsproblematik Sexueller Missbrauch vs. Pädosexuelle Gewaltausübung
- 3. Historischer Wandel
- 3.1. Entwicklung des Sexualstrafrechts
- 3.2. Die Punitivität der Gesellschaft
- 4. Die Täter
- 4.1. Erklärungsansätze zur Entstehung von Pädosexualität
- 4.1.1. Ätiologische Risikobedingungen für Pädosexualität
- 4.1.2. Typologie
- 4.2. Situative Risikobedingungen für Pädosexualität
- 5. Soziale Arbeit im Maßregelvollzug
- 5.1. Rechtliche Grundlagen
- 5.2. Aufgabenbereich
- 6. Soziale Arbeit im Strafvollzug
- 6.1. Rechtliche Grundlagen
- 6.2. Aufgabenbereich
- 7. Leitgedanken
- 8. Methoden in der Arbeit mit Straftätern
- 8.1. Motivationsarbeit
- 8.2. Hilfeplangespräch
- 8.3. Case-Management
- 8.4. Krisenintervention
- 8.5. Soziales Training
- 8.6. Beratungsgespräche
- 9. Besondere Herausforderungen
- 10. Exkurs: „Kein Täter werden“ – Ein Präventivnetzwerk
- 11. Die Soziale Arbeit mit Tätern pädosexueller Gewaltausübungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit zielt darauf ab, sozialpädagogische Umgangsformen mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung zu beleuchten und neue Perspektiven auf dieses komplexe Thema zu eröffnen. Die einfache Lösung, Täter "wegzusperren", wird hinterfragt. Stattdessen wird die Bedeutung von Täterarbeit als beste Form des Opferschutzes hervorgehoben.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Pädophilie und Pädosexualität
- Historische Entwicklung des Umgangs mit Pädosexualität im Strafrecht und in der Gesellschaft
- Erklärungsansätze für die Entstehung von Pädosexualität (ätiologische und situative Risikofaktoren)
- Soziale Arbeit im Maßregelvollzug und im Strafvollzug
- Methoden und Herausforderungen der Sozialen Arbeit mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Pädosexualität und den Umgang mit Tätern in den Kontext der gesellschaftlichen Wahrnehmung und der politischen Diskussion. Sie hebt die Notwendigkeit sozialpädagogischer Ansätze hervor und umreißt den Aufbau der Arbeit. Die Autorin betont die Beschränkung auf männliche Täter in Deutschland und verzichtet auf eine detaillierte Betrachtung der Opferperspektive. Die Arbeit konzentriert sich auf sozialpädagogische Aspekte und schließt therapeutische und medikamentöse Behandlungen explizit aus.
2. Definitionen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Pädophilie und Pädosexualität nach ICD-10 und DSM-5. Es analysiert die Begriffsproblematik und differenziert zwischen diesen Begriffen und dem sexuellen Missbrauch von Kindern. Die rechtlichen Grundlagen des sexuellen Missbrauchs von Kindern werden ebenso behandelt wie empirische Nachweise zur Häufigkeit und den Tatmerkmalen. Die Abgrenzung zwischen "sexuellem Missbrauch" und "pädosexueller Gewaltausübung" wird kritisch beleuchtet.
3. Historischer Wandel: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Sexualstrafrechts im Bezug auf Pädosexualität und analysiert den Wandel der gesellschaftlichen Punitivität gegenüber Tätern. Es untersucht, wie sich die rechtlichen und gesellschaftlichen Reaktionen auf Pädosexualität im Laufe der Zeit verändert haben und welche Faktoren diese Veränderungen beeinflusst haben. Dieser historische Überblick dient als Grundlage für das Verständnis des aktuellen Umgangs mit dem Thema.
4. Die Täter: Dieses Kapitel erörtert verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von Pädosexualität. Es werden sowohl ätiologische (z.B. biologische, psychologische) als auch situative Risikofaktoren diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung einer Typologie von Tätern, wobei statistische und persönlichkeitsbezogene Merkmale berücksichtigt werden. Die Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen individuellen Merkmalen und dem Tatverhalten.
5. Soziale Arbeit im Maßregelvollzug: Das Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen und dem Aufgabenbereich der Sozialen Arbeit im Maßregelvollzug für Sexualstraftäter. Es analysiert die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit in diesem Kontext, unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Zielsetzung der Maßregelvollzugs. Der Fokus liegt auf der Rolle der Sozialen Arbeit bei der Behandlung und Resozialisierung von Tätern.
6. Soziale Arbeit im Strafvollzug: Dieses Kapitel untersucht die rechtlichen Grundlagen und den Aufgabenbereich der Sozialen Arbeit im Strafvollzug für Sexualstraftäter. Es beleuchtet die konkreten Aufgaben und Herausforderungen der Sozialen Arbeit in diesem Setting und zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zur Sozialen Arbeit im Maßregelvollzug. Der Fokus liegt auf den Möglichkeiten der Prävention von Rückfällen und der Unterstützung der Täter bei der Resozialisierung.
7. Leitgedanken: Dieses Kapitel skizziert zentrale Leitgedanken für die Soziale Arbeit mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung. Es formuliert grundlegende Prinzipien und ethische Überlegungen für den professionellen Umgang mit dieser Klientel. Hier werden wichtige Aspekte für eine verantwortungsvolle und effektive Sozialarbeit herausgearbeitet.
8. Methoden in der Arbeit mit Straftätern: In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden der Sozialen Arbeit mit Straftätern, wie Motivationsarbeit, Hilfeplangespräche, Case-Management, Krisenintervention, soziales Training und Beratungsgespräche, detailliert beschrieben und im Kontext der Arbeit mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung eingeordnet. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Methoden und ihrer Wirksamkeit.
9. Besondere Herausforderungen: Dieses Kapitel beleuchtet besondere Herausforderungen, denen Soziale Arbeit im Umgang mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung begegnet. Es analysiert die Schwierigkeiten und die Notwendigkeit spezifischer Strategien und Vorgehensweisen. Die Kapitel identifiziert kritische Punkte, die eine besondere Berücksichtigung erfordern.
10. Exkurs: „Kein Täter werden“ – Ein Präventivnetzwerk: Dieser Exkurs präsentiert ein Präventionsprogramm und analysiert dessen Ansatz und Zielsetzung. Es zeigt ein Beispiel für präventive Maßnahmen und ihre Bedeutung für den Schutz von Kindern. Der Abschnitt liefert Einblicke in die Präventionsarbeit.
11. Die Soziale Arbeit mit Tätern pädosexueller Gewaltausübungen: Dieses Kapitel fasst die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammen und wendet diese konkret auf die Soziale Arbeit mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung an. Es integriert die gewonnenen Erkenntnisse in einen umfassenden Überblick über die Thematik.
Schlüsselwörter
Pädosexualität, sexueller Missbrauch von Kindern, Täterarbeit, Opferschutz, Maßregelvollzug, Strafvollzug, Soziale Arbeit, Prävention, Resozialisierung, Risikofaktoren, Tätertypologie, Methoden der Sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Soziale Arbeit mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit befasst sich mit sozialpädagogischen Umgangsformen mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung. Sie hinterfragt die einfache Lösung des „Wegsperrens“ und betont die Bedeutung von Täterarbeit als beste Form des Opferschutzes. Der Fokus liegt auf der Sozialen Arbeit im Maßregelvollzug und Strafvollzug, unter Ausschluss therapeutischer und medikamentöser Behandlungen. Die Arbeit beschränkt sich auf männliche Täter in Deutschland und verzichtet auf eine detaillierte Betrachtung der Opferperspektive.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung der Begriffe Pädophilie und Pädosexualität; historische Entwicklung des Umgangs mit Pädosexualität im Strafrecht und in der Gesellschaft; Erklärungsansätze für die Entstehung von Pädosexualität (ätiologische und situative Risikofaktoren); Soziale Arbeit im Maßregelvollzug und im Strafvollzug; Methoden und Herausforderungen der Sozialen Arbeit mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung; ein Präventionsprogramm ("Kein Täter werden").
Wie werden Pädophilie und Pädosexualität definiert?
Die Arbeit definiert Pädophilie und Pädosexualität nach ICD-10 und DSM-5 und analysiert die Begriffsproblematik. Sie differenziert zwischen diesen Begriffen und dem sexuellen Missbrauch von Kindern und beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des sexuellen Missbrauchs sowie empirische Nachweise zur Häufigkeit und den Tatmerkmalen. Die Abgrenzung zwischen „sexuellem Missbrauch“ und „pädosexueller Gewaltausübung“ wird kritisch diskutiert.
Welche Erklärungsansätze für die Entstehung von Pädosexualität werden vorgestellt?
Die Arbeit erörtert verschiedene Erklärungsansätze, inklusive ätiologischer (biologische, psychologische) und situativer Risikofaktoren. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung einer Tätertypologie, unter Berücksichtigung statistischer und persönlichkeitsbezogener Merkmale und dem Zusammenhang zwischen individuellen Merkmalen und Tatverhalten.
Wie beschreibt die Arbeit die Soziale Arbeit im Maßregelvollzug und Strafvollzug?
Die Arbeit beschreibt die rechtlichen Grundlagen und Aufgabenbereiche der Sozialen Arbeit im Maßregelvollzug und Strafvollzug für Sexualstraftäter. Sie analysiert die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit in diesen Kontexten, unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Zielsetzung des Maßregelvollzugs bzw. Strafvollzugs. Der Fokus liegt auf der Rolle der Sozialen Arbeit bei der Behandlung und Resozialisierung von Tätern und der Prävention von Rückfällen.
Welche Methoden der Sozialen Arbeit werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden der Sozialen Arbeit mit Straftätern, wie Motivationsarbeit, Hilfeplangespräche, Case-Management, Krisenintervention, soziales Training und Beratungsgespräche. Sie ordnet diese Methoden im Kontext der Arbeit mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung ein und konzentriert sich auf deren praktische Anwendung und Wirksamkeit.
Welche besonderen Herausforderungen werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet besondere Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Umgang mit Tätern pädosexueller Gewaltausübung, analysiert Schwierigkeiten und die Notwendigkeit spezifischer Strategien und Vorgehensweisen und identifiziert kritische Punkte, die besondere Berücksichtigung erfordern.
Was ist der Inhalt des Exkurses „Kein Täter werden“?
Der Exkurs präsentiert ein Präventionsprogramm und analysiert dessen Ansatz und Zielsetzung. Er zeigt ein Beispiel für präventive Maßnahmen und deren Bedeutung für den Schutz von Kindern und liefert Einblicke in die Präventionsarbeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pädosexualität, sexueller Missbrauch von Kindern, Täterarbeit, Opferschutz, Maßregelvollzug, Strafvollzug, Soziale Arbeit, Prävention, Resozialisierung, Risikofaktoren, Tätertypologie, Methoden der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Pädosexualität. Sozialpädagogischer Umgang mit Tätern pädosexueller Gewaltausübungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372053