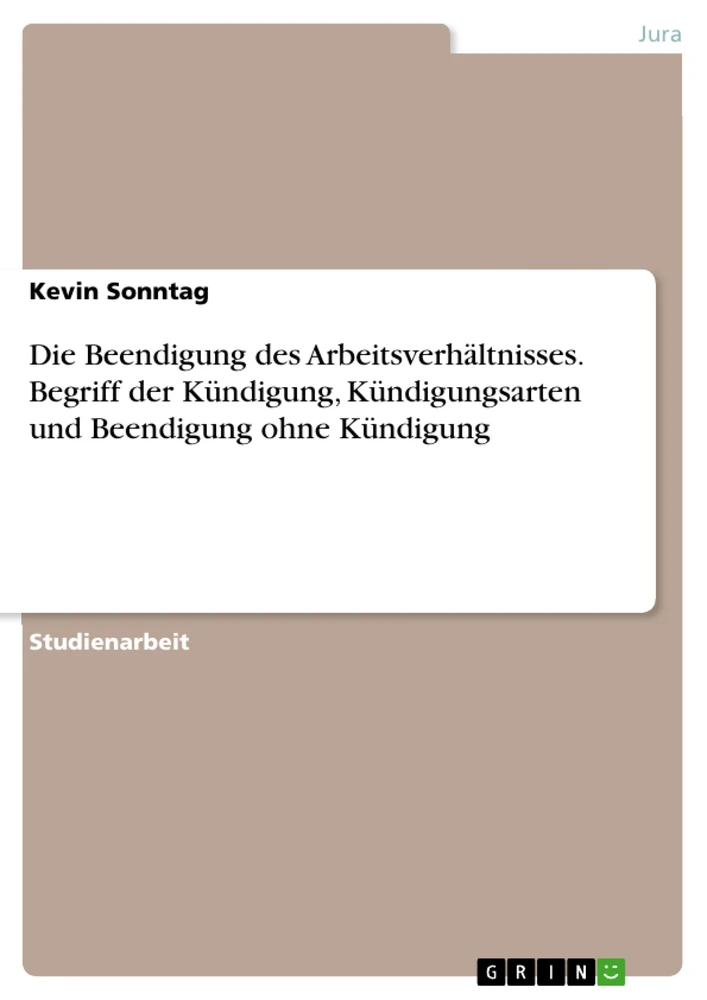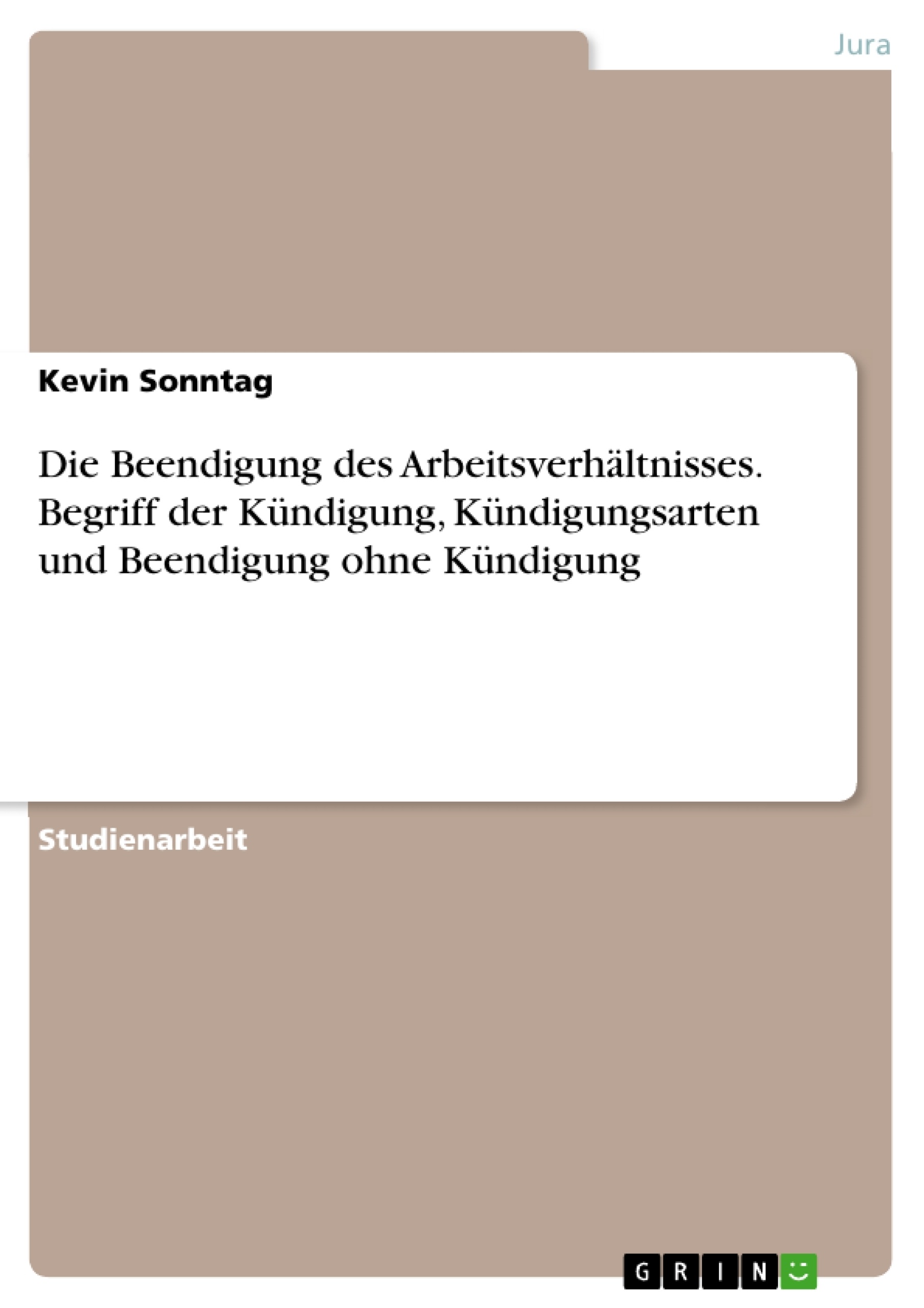Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus Sicht des Arbeitsrechts.
Zunächst wird der Begriff Kündigung ausführlich definiert. Anschließend wird erläutert, welche Voraussetzungen bei der ordentlichen und außerordentlichen Kündigung vorliegen müssen und welche Probleme bei einer Verdachtskündigung und einer Änderungskündigung entstehen können. Außerdem wird der Frage nachgegangen, wie ein Arbeitsverhältnis auch ohne eine Kündigung enden kann und welche Gesichtspunkte bei einem Aufhebungsvertrag zu beachten sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriff der Kündigung
- 3. Kündigungsarten
- 3.1 Ordentliche Kündigung
- 3.2 Außerordentliche Kündigung
- 3.3 Probleme bei einer Verdachtskündigung
- 3.4 Probleme bei einer Änderungskündigung
- 3.5 Folgen einer Kündigung in Bezug auf Versicherungs- und Sozialleistungen
- 4. Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung
- 5. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen im deutschen Arbeitsrecht, wobei der Fokus auf der Kündigung liegt. Ziel ist es, den Begriff der Kündigung zu definieren, verschiedene Kündigungsarten zu erläutern und die damit verbundenen Probleme zu beleuchten. Zusätzlich wird die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung betrachtet.
- Definition und rechtliche Grundlagen der Kündigung
- Unterschiede zwischen ordentlicher und außerordentlicher Kündigung
- Probleme im Zusammenhang mit Verdachts- und Änderungskündigungen
- Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung (z.B. Aufhebungsvertrag)
- Relevanz der Kündigung im Kontext aktueller wirtschaftlicher Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Kündigung im Kontext aktueller wirtschaftlicher Entwicklungen und öffentlichkeitswirksamer Fälle (z.B. Schlecker-Insolvenz, Abgasskandal Volkswagen) heraus. Sie hebt die Komplexität des Themas hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Definition der Kündigung, die verschiedenen Kündigungsarten und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung konzentriert.
2. Begriff der Kündigung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Kündigung als einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, die das Arbeitsverhältnis beendet. Es wird auf das Schriftformerfordernis nach § 623 BGB eingegangen, die elektronische Form wird ausgeschlossen. Die Kapitel beleuchtet die Frage der Wirksamkeit der Kündigung bei Abwesenheit des Arbeitnehmers und die Notwendigkeit einer Kündigungsbegründung (Ausnahmen nach § 22 Abs. 3 BBIG und § 9 Abs. 3 MuSchG werden erwähnt, aber nicht detailliert behandelt).
3. Kündigungsarten: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen ordentlicher und außerordentlicher Kündigung. Es wird erwähnt, dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer kündigen können und dass im Falle eines Kündigungsschutzes nach KSchG verschiedene Kündigungsgründe (z.B. betriebsbedingte Gründe) existieren. Die detaillierte Erläuterung der verschiedenen Kündigungsarten und der damit verbundenen Rechtsfolgen findet aufgrund der Kürze des Auszugs hier jedoch keine Berücksichtigung.
Schlüsselwörter
Kündigung, Arbeitsrecht, Arbeitsverhältnis, ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung, Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Schriftform, Verdachtskündigung, Änderungskündigung, Aufhebungsvertrag, Beendigung des Arbeitsverhältnisses, betriebsbedingte Kündigung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Beendigung von Arbeitsverhältnissen"
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im deutschen Arbeitsrecht, mit Schwerpunkt auf der Kündigung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die behandelten Themen umfassen den Begriff der Kündigung, verschiedene Kündigungsarten (ordentliche, außerordentliche, Verdachts-, Änderungskündigung), Probleme im Zusammenhang mit diesen, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung (z.B. Aufhebungsvertrag) und die Relevanz im Kontext aktueller wirtschaftlicher Entwicklungen.
Welche Kündigungsarten werden behandelt?
Das Dokument unterscheidet zwischen ordentlichen und außerordentlichen Kündigungen. Es erwähnt auch die Probleme im Zusammenhang mit Verdachts- und Änderungskündigungen, geht aber aufgrund des begrenzten Umfangs nicht detailliert auf die jeweiligen Rechtsfolgen ein. Die Möglichkeit der Kündigung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird angesprochen, ebenso wie der Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) und verschiedene Kündigungsgründe (z.B. betriebsbedingte Kündigung).
Was ist der Unterschied zwischen ordentlicher und außerordentlicher Kündigung?
Das Dokument definiert beide Kündigungsarten, geht aber nicht im Detail auf die Unterschiede ein. Es wird lediglich erwähnt, dass beide Arten von sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer ausgeübt werden können und im Falle des Kündigungsschutzes nach KSchG verschiedene Kündigungsgründe existieren.
Welche Probleme bei Verdachts- und Änderungskündigungen werden angesprochen?
Das Dokument benennt die Probleme im Zusammenhang mit Verdachts- und Änderungskündigungen, geht aber aufgrund des begrenzten Umfangs nicht detailliert darauf ein. Diese Punkte werden lediglich als Themenschwerpunkte aufgeführt.
Wie wird die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung behandelt?
Das Dokument erwähnt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung, beispielsweise durch einen Aufhebungsvertrag, als ein wichtiges Thema, das aber nicht im Detail behandelt wird. Es dient lediglich als ein weiterer Aspekt der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Kündigung, Arbeitsrecht, Arbeitsverhältnis, ordentliche Kündigung, außerordentliche Kündigung, Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Schriftform, Verdachtskündigung, Änderungskündigung, Aufhebungsvertrag, Beendigung des Arbeitsverhältnisses und betriebsbedingte Kündigung.
Welche rechtlichen Grundlagen werden erwähnt?
Das Dokument erwähnt § 623 BGB (Schriftformerfordernis bei Kündigungen), § 22 Abs. 3 BBIG und § 9 Abs. 3 MuSchG (Ausnahmen vom Schriftformerfordernis, werden aber nicht detailliert erläutert) und das Kündigungsschutzgesetz (KSchG).
Welche Beispiele werden genannt?
Als Beispiele für öffentlichkeitswirksame Fälle werden die Schlecker-Insolvenz und der Abgasskandal Volkswagen erwähnt, um die Relevanz des Themas Kündigung im Kontext aktueller wirtschaftlicher Entwicklungen zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Kevin Sonntag (Author), 2017, Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Begriff der Kündigung, Kündigungsarten und Beendigung ohne Kündigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371925