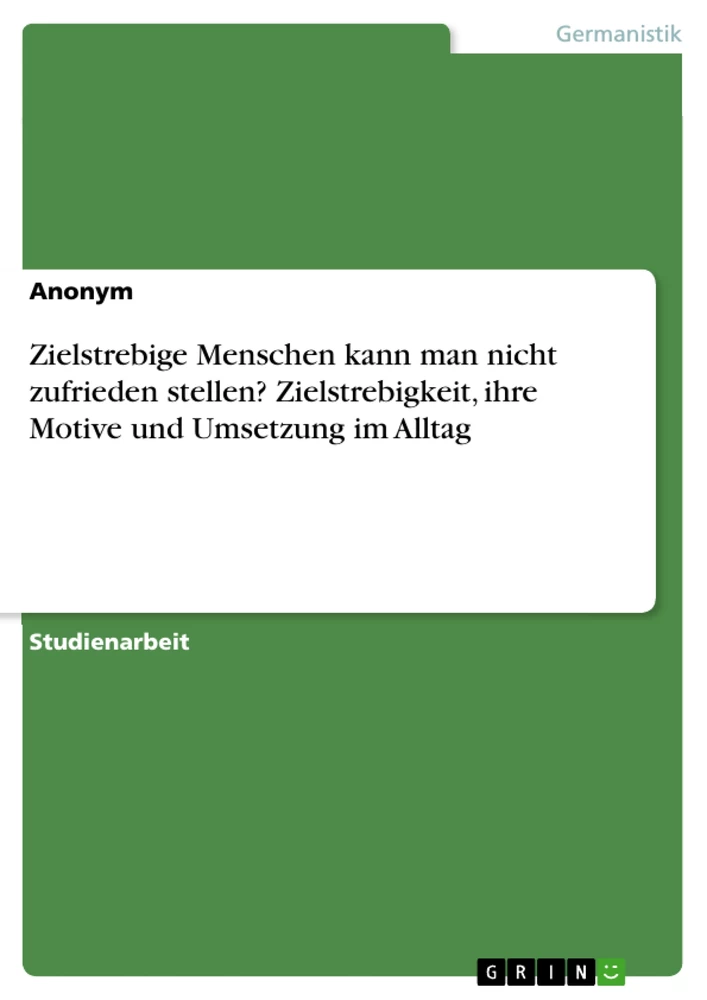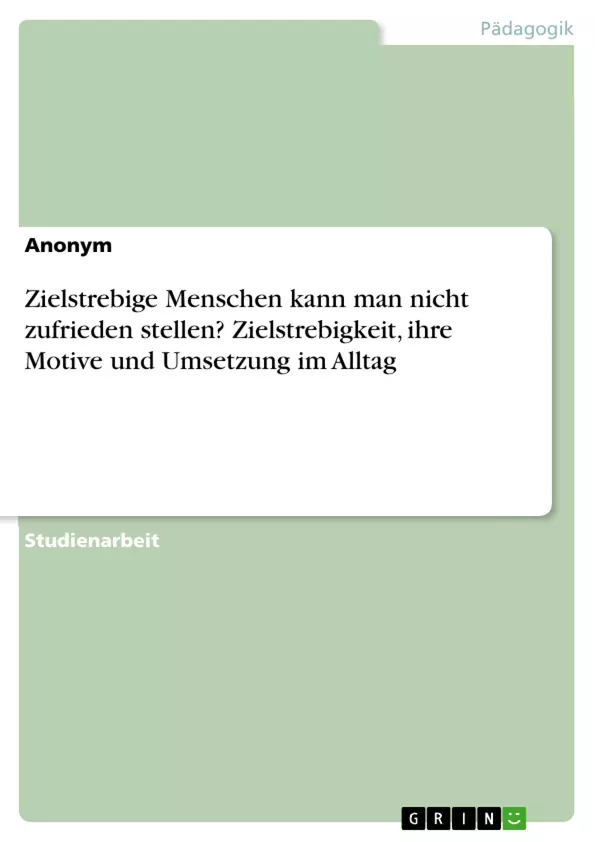Ein Wert, der heutzutage eine Voraussetzung für viele Berufe, gerade für höhere Positionen, ist, neben dem Ehrgeiz, die Zielstrebigkeit. Wer etwas aus sich machen möchte, muss in dieser hart umkämpften Arbeitswelt viele Strapazen auf sich nehmen und eine stark entwickelte Persönlichkeit haben. Aber ob es sich immer um einen Zugewinn handelt, wenn man sehr zielstrebig ist, gilt es in dieser Arbeit zu erörtern.
Dementsprechend ist es zu Beginn sehr wichtig, zu klären, was dieser Wert nun eigentlich bedeutet:
Beharrlichkeit, (feste) Entschlossenheit, Geradlinigkeit, Hartnäckigkeit, Unbeirrbarkeit, Verbissenheit, Willensstärke. Das Streben, etwas zu verändern, ob Zustand oder Situation, und um Bedürfnisse zu stillen.
Doch nach welchem Ziel lohnt es sich, zu streben? Wer oder was bringt jemanden dazu, (nach etwas) zu streben? Wie weit kann es einen bringen, nach einem Ziel zu streben? Macht ein ständiges Streben krank? Was ist die Ursache für diesen Wert? Wann ist man an seinem Ziel angekommen? Kann man eine zielstrebige Person jemals zufriedenstellen? Nach einigen Recherchen ergibt sich daraus ein interessanter Aspekt: "Zielstrebige Menschen kann man nicht zufriedenstellen."
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zielstrebige Menschen kann man nicht zufriedenstellen
- 1.1 Extrinsisches Motiv
- 1.2 Soziales Motiv
- 1.3 Easterlin Paradoxon
- 2. Zielstrebigkeit im Alltag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht den Wert der Zielstrebigkeit und hinterfragt die These, dass zielstrebige Menschen nicht zufriedenzustellen sind. Sie analysiert die Motivationsfaktoren hinter zielstrebigem Verhalten und beleuchtet die Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit.
- Extrinsische Motivation und der Einfluss von Belohnung und Anerkennung
- Soziale Vergleiche und deren Rolle bei der Zielsetzung
- Das Easterlin-Paradoxon und die Beziehung zwischen Einkommen und Lebenszufriedenheit
- Die Auswirkungen von Zielstrebigkeit auf die persönliche Entwicklung
- Die Balance zwischen ambitioniertem Streben und Zufriedenheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zielstrebige Menschen kann man nicht zufriedenstellen: Dieses Kapitel erörtert die zentrale These der Arbeit, dass zielstrebige Individuen aufgrund ihrer intrinsischen und extrinsischen Motivationen nur schwer zufriedenzustellen sind. Es werden verschiedene Motivationsfaktoren analysiert, darunter extrinsische Motivationen wie das Streben nach höherem Einkommen, Prestige oder materiellen Gütern, und intrinsische Motivationen wie der Wunsch nach Selbstverwirklichung und sozialem Vergleich. Die ständige Weiterentwicklung von Wünschen und Zielen, selbst nach deren Erreichung, wird als zentraler Faktor für die anhaltende Unzufriedenheit identifiziert. Der Abschnitt 1.1 beleuchtet die extrinsische Motivation und beschreibt, wie positive Erfahrungen und Belohnungen einen Kreislauf des Strebens aufrechterhalten. Abschnitt 1.2 fokussiert auf den sozialen Vergleich als Motivator und erklärt, wie der Vergleich mit anderen die eigenen Ansprüche und Wünsche ständig steigert. Abschnitt 1.3 führt das Easterlin-Paradoxon ein, welches postuliert, dass die Lebenszufriedenheit ab einem bestimmten Einkommen nicht mehr signifikant ansteigt, obwohl das Streben nach mehr weiterhin besteht. Dieses Kapitel legt den Grundstein für die weitere Argumentation und stellt die zentrale These der Arbeit vor, welche im weiteren Verlauf vertieft und durch Beispiele illustriert wird.
2. Zielstrebigkeit im Alltag: Im zweiten Kapitel wird die These aus dem ersten Kapitel anhand persönlicher Erfahrungen der Autorin veranschaulicht. Die Autorin beschreibt ihren eigenen Weg und die Rolle der Zielstrebigkeit in ihrem Leben, insbesondere ihr Streben nach einem Studienplatz und ihrem Traumjob. Sie beschreibt sowohl extrinsische als auch intrinsische Motivatoren für ihr Handeln und räumt ein, dass das ständige Streben nach Verbesserung zwar anstrengend sein kann, aber auch zu persönlicher Entwicklung geführt hat. Die Autorin reflektiert über den Druck, sich selbst auferlegte Ziele zu erreichen und die Schwierigkeiten, mit dem Erreichten zufrieden zu sein, selbst bei großen Erfolgen. Dieses Kapitel bietet eine persönliche Perspektive auf die zuvor theoretisch erörterten Aspekte und unterstreicht die Komplexität und Ambivalenz des Themas.
Schlüsselwörter
Zielstrebigkeit, Motivation, Lebenszufriedenheit, extrinsische Motivation, intrinsische Motivation, sozialer Vergleich, Easterlin-Paradoxon, Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, Wunsch, Anspruch.
Häufig gestellte Fragen zur Facharbeit: "Zielstrebige Menschen kann man nicht zufriedenstellen"
Was ist das zentrale Thema der Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die These, dass zielstrebige Menschen aufgrund ihrer intrinsischen und extrinsischen Motivationen nur schwer zufriedenzustellen sind. Sie analysiert die Motivationsfaktoren hinter zielstrebigem Verhalten und deren Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit.
Welche Aspekte der Zielstrebigkeit werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Zielstrebigkeit, darunter extrinsische Motivation (Streben nach Belohnung, Anerkennung, materiellem Besitz), intrinsische Motivation (Selbstverwirklichung), den Einfluss sozialer Vergleiche und das Easterlin-Paradoxon (Beziehung zwischen Einkommen und Lebenszufriedenheit).
Was ist das Easterlin-Paradoxon und welche Rolle spielt es in der Arbeit?
Das Easterlin-Paradoxon besagt, dass die Lebenszufriedenheit ab einem bestimmten Einkommen nicht mehr signifikant ansteigt, obwohl das Streben nach mehr weiterhin besteht. Die Arbeit nutzt dieses Paradoxon, um die anhaltende Unzufriedenheit zielstrebiger Menschen trotz Erreichung von Zielen zu erklären.
Wie wird die These der Arbeit belegt?
Die These wird sowohl theoretisch durch die Analyse von Motivationsfaktoren und dem Easterlin-Paradoxon als auch anhand einer persönlichen Erfahrungsgeschichte der Autorin belegt. Das zweite Kapitel bietet eine persönliche Perspektive und illustriert die Komplexität und Ambivalenz des Themas.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus zwei Kapiteln: Kapitel 1 ("Zielstrebige Menschen kann man nicht zufriedenstellen") erörtert die zentrale These und analysiert die Motivationsfaktoren. Kapitel 2 ("Zielstrebigkeit im Alltag") veranschaulicht die These anhand der persönlichen Erfahrungen der Autorin.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Zielstrebigkeit, Motivation, Lebenszufriedenheit, extrinsische Motivation, intrinsische Motivation, sozialer Vergleich, Easterlin-Paradoxon, Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, Wunsch, Anspruch.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Komplexität des Zusammenhangs zwischen Zielstrebigkeit und Lebenszufriedenheit auf. Sie argumentiert, dass das ständige Streben nach Zielen, angetrieben von intrinsischen und extrinsischen Motivationen und verstärkt durch soziale Vergleiche, zu anhaltender Unzufriedenheit führen kann, selbst bei großem Erfolg. Gleichzeitig wird jedoch auch die persönliche Entwicklung durch ambitioniertes Streben hervorgehoben.
Für wen ist diese Facharbeit relevant?
Diese Facharbeit ist relevant für alle, die sich für die Themen Motivation, Lebenszufriedenheit, Persönlichkeitsentwicklung und die Auswirkungen von Zielstrebigkeit interessieren. Sie eignet sich insbesondere für Studierende der Psychologie, Soziologie und verwandter Fächer.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2015, Zielstrebige Menschen kann man nicht zufrieden stellen? Zielstrebigkeit, ihre Motive und Umsetzung im Alltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371855