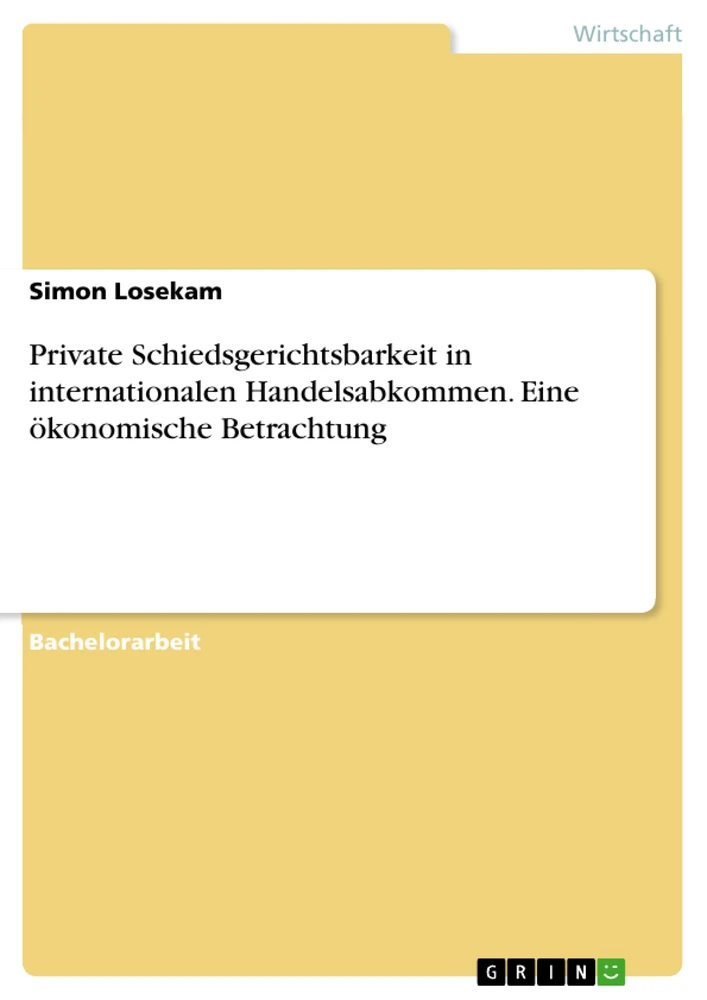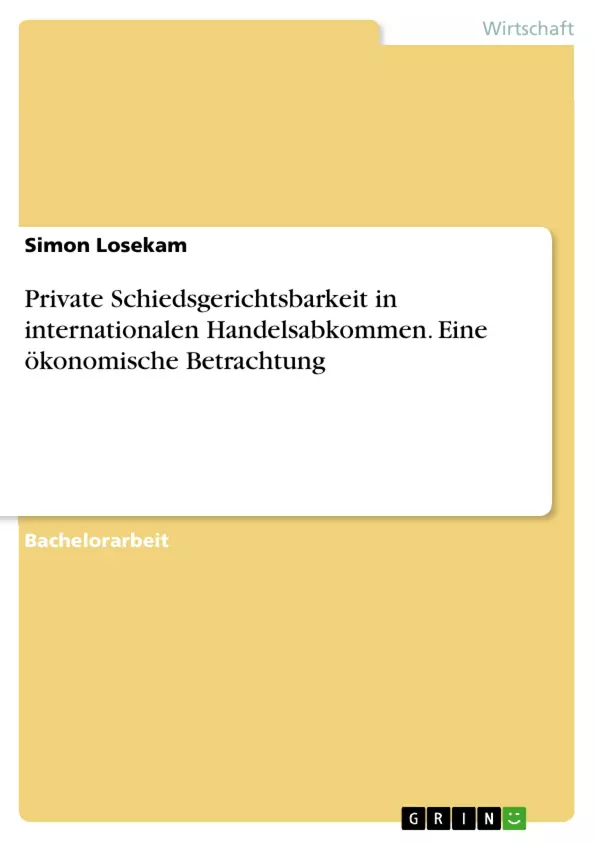Der Leser dieser Arbeit soll zunächst kurz ein grundlegendes Verständnis dafür entwickeln, warum Recht und Handel in einem engen ökonomischen Verhältnis zueinander stehen und welche Gründe dafür gesorgt haben, dass sich die handelspolitische Ausrichtung insbesondere auf den Abschluss regionaler bzw. bilateraler Handelsabkommen konzentriert hat. In diesem Zusammenhang wird schließlich dann die Entwicklung der privaten Schiedsgerichtsbarkeit als ein wesentlicher Bestandteil regionaler bzw. bilateraler Handelsabkommen beschrieben sowie grundlegend ökonomisch untersucht. Dabei wird der Begriff der privaten Schiedsgerichtsbarkeit genauer eingeordnet sowie die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit vorgestellt. Im Anschluss daran wird dann ein spieltheoretisches Modell erarbeitet, welches ein grundlegendes ökonomisches Argument für das Instrument der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit begründet. Zudem werden allgemeine Vorteile privater Schiedsverfahren gegenüber staatlichen Verfahren erläutert. Den Abschluss der Arbeit bildet mit dieser Grundlage schließlich einerseits eine Diskussion über die wesentlichen Chancen und Risiken der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit sowie andererseits ein Ausblick über die wesentlichen Reformen dieser im Rahmen des Freihandelsabkommens CETA.
Während seit Jahrzehnten das Instrument der privaten Schiedsgerichtsbarkeit im Rahmen regionaler bzw. bilateraler Handels- und Investitionsschutzabkommen zu den Standardklauseln des Investitionsschutzes gehört, steht dieses Instrument seit Beginn der Verhandlungen zu den beiden Freihandelsabkommen „Transatlantic Trade and Investment Partnership” (TTIP) und dem „Comprehensive Economic and Trade Agreement” (CETA) unter erheblicher Kritik.
Zahlreiche Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und Verbände befürchten im Rahmen der privaten Schiedsgerichtsbarkeit die Entstaatlichung der nationalen Justiz und die Entziehung der staatlichen Regulierungsfähigkeit. Sie sind fest davon überzeugt, dass ein derartiges Instrument vor allem die Macht von global agierenden Konzernen stärken werde. Befürworter der privaten Schiedsgerichtsbarkeit hingegen sprechen vor allem über die ökonomischen und juristischen Vorteile eines solchen Systems. Die private Schiedsgerichtsbarkeit gehöre ihrer Meinung nach seit Jahrzehnten zu den festen und akzeptierten Bestandteilen des internationalen Investitionsrechts.
Inhaltsverzeichnis
- II. Einführung und Problemstellung, Analyse sowie Schlussbetrachtung
- 1. Einleitung
- 2. Internationaler Handel, Entwicklung und Hintergründe multilateraler, sowie bilateraler Handels- und Investitionsschutzabkommen
- 2.1 Internationaler Handel und Recht
- 2.2 Internationale Handelsabkommen im Rahmen multilateraler Koordination
- 2.3 Entwicklung bilateraler Handels- und Investitionsschutzabkommen
- 3. Die private Schiedsgerichtsbarkeit - Garantie für Rechtsschutz und Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten
- 3.1 Die Private Schiedsgerichtsbarkeit - Eine Begriffseinordnung
- 3.2 Internationale Entwicklung privater Schiedsgerichtsbarkeit
- 3.3 Die theoretisch - ökonomische Begründung der privaten Schiedsgerichtsbarkeit
- 3.4 Allgemeine Vorteile der privaten Schiedsgerichtsbarkeit
- 4. Diskussion über die Chancen und Risiken der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit
- 4.1 Förderung von Direktinvestitionen
- 4.2 Verlust staatlicher Regulierungsfähigkeit und Gefährdung öffentlicher Finanzen
- 4.3 Umgehung und Aushöhlung des Rechtsstaates
- 5. Reformen der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Rahmen von CETA
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Instrument der privaten Schiedsgerichtsbarkeit im Kontext von Handels- und Investitionsschutzabkommen. Sie beleuchtet die ökonomischen und rechtlichen Aspekte dieses Instruments und setzt es in den Rahmen der aktuellen Debatte um Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA.
- Die Bedeutung des internationalen Handels und der Rechtsetzung im Kontext der globalen Verflechtung
- Die Entwicklung und Relevanz von multilateralen und bilateralen Handelsabkommen
- Die Funktionsweise und ökonomische Begründung der privaten Schiedsgerichtsbarkeit
- Chancen und Risiken der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit für Staaten und Unternehmen
- Die Relevanz von Reformen in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Kontext von CETA
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Einordnung der privaten Schiedsgerichtsbarkeit in die aktuelle handelspolitische Debatte. Es zeigt die kontroversen Meinungen zu diesem Instrument auf, die durch die Verhandlungen um TTIP und CETA verstärkt wurden. Das zweite Kapitel befasst sich mit der allgemeinen Bedeutung des internationalen Handels und der Rechtsetzung. Es erläutert die Entwicklung von multilateralen und bilateralen Handelsabkommen, wobei das General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) als Beispiel dient.
Das dritte Kapitel behandelt die private Schiedsgerichtsbarkeit als Instrument des Rechtsschutzes und der Streitigkeitsbeilegung. Es definiert den Begriff, zeichnet die Entwicklung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit nach und untersucht die ökonomischen Begründungen. Kapitel vier diskutiert die Chancen und Risiken der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit für Staaten und Unternehmen. Es beleuchtet Aspekte wie die Förderung von Direktinvestitionen, den Verlust staatlicher Regulierungsfähigkeit und die potenzielle Umgehung des Rechtsstaates.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit Reformen der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Rahmen des Freihandelsabkommens CETA.
Schlüsselwörter
Private Schiedsgerichtsbarkeit, Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, Handelsabkommen, TTIP, CETA, internationales Recht, Rechtsschutz, Streitigkeitsbeilegung, ökonomische Analyse, Direktinvestitionen, Regulierungsfähigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Reformen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist private Schiedsgerichtsbarkeit?
Es handelt sich um ein Verfahren zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten außerhalb staatlicher Gerichte durch private Schiedsrichter, die oft in internationalen Handelsabkommen vereinbart werden.
Warum wird dieses System bei Abkommen wie TTIP oder CETA kritisiert?
Kritiker befürchten eine „Entstaatlichung“ der Justiz, eine Bevorzugung globaler Konzerne und eine Einschränkung der staatlichen Regulierungsfähigkeit (z.B. im Umweltschutz).
Welche Vorteile bietet die Schiedsgerichtsbarkeit für den Handel?
Vorteile sind die Schnelligkeit der Verfahren, die Fachkompetenz der Schiedsrichter, die Neutralität (besonders bei Streitigkeiten mit Staaten) und die internationale Vollstreckbarkeit der Urteile.
Wie begründet die Spieltheorie den Einsatz von Schiedsgerichten?
Sie dienen als Mechanismus, um das Vertrauen zwischen Investoren und Gastländern zu sichern, indem sie das Risiko willkürlicher staatlicher Entscheidungen minimieren und so Investitionen fördern.
Welche Reformen wurden im Rahmen von CETA eingeführt?
CETA sieht unter anderem einen ständigen Investitionsgerichtshof mit öffentlich ernannten Richtern und eine Berufungsinstanz vor, um die Transparenz und Rechtsstaatlichkeit zu erhöhen.
- Citar trabajo
- Simon Losekam (Autor), 2016, Private Schiedsgerichtsbarkeit in internationalen Handelsabkommen. Eine ökonomische Betrachtung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371755