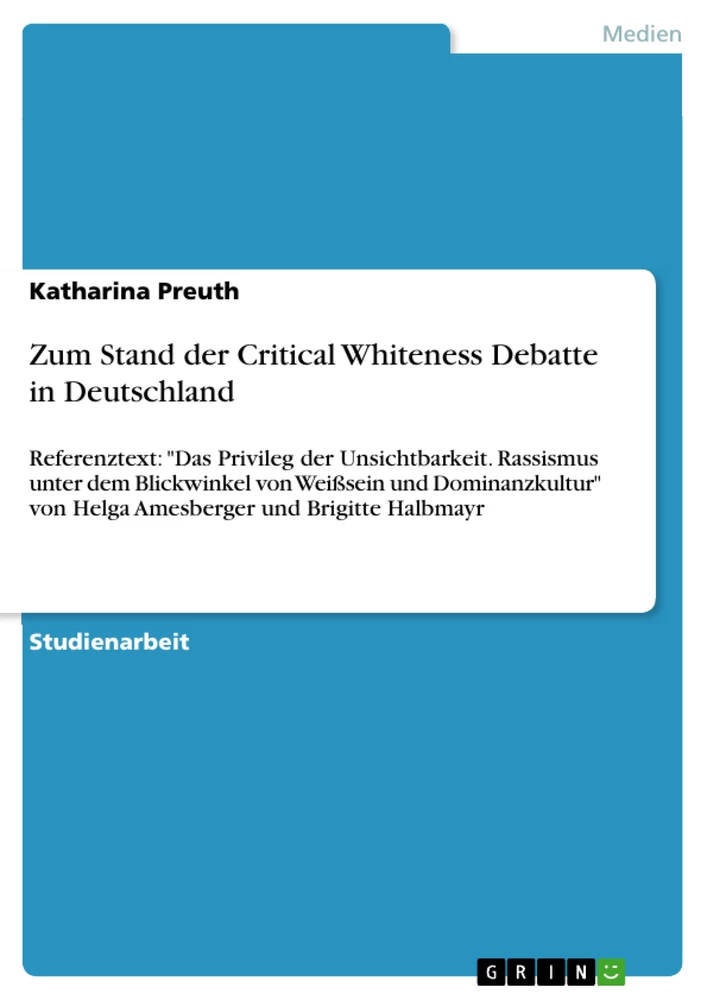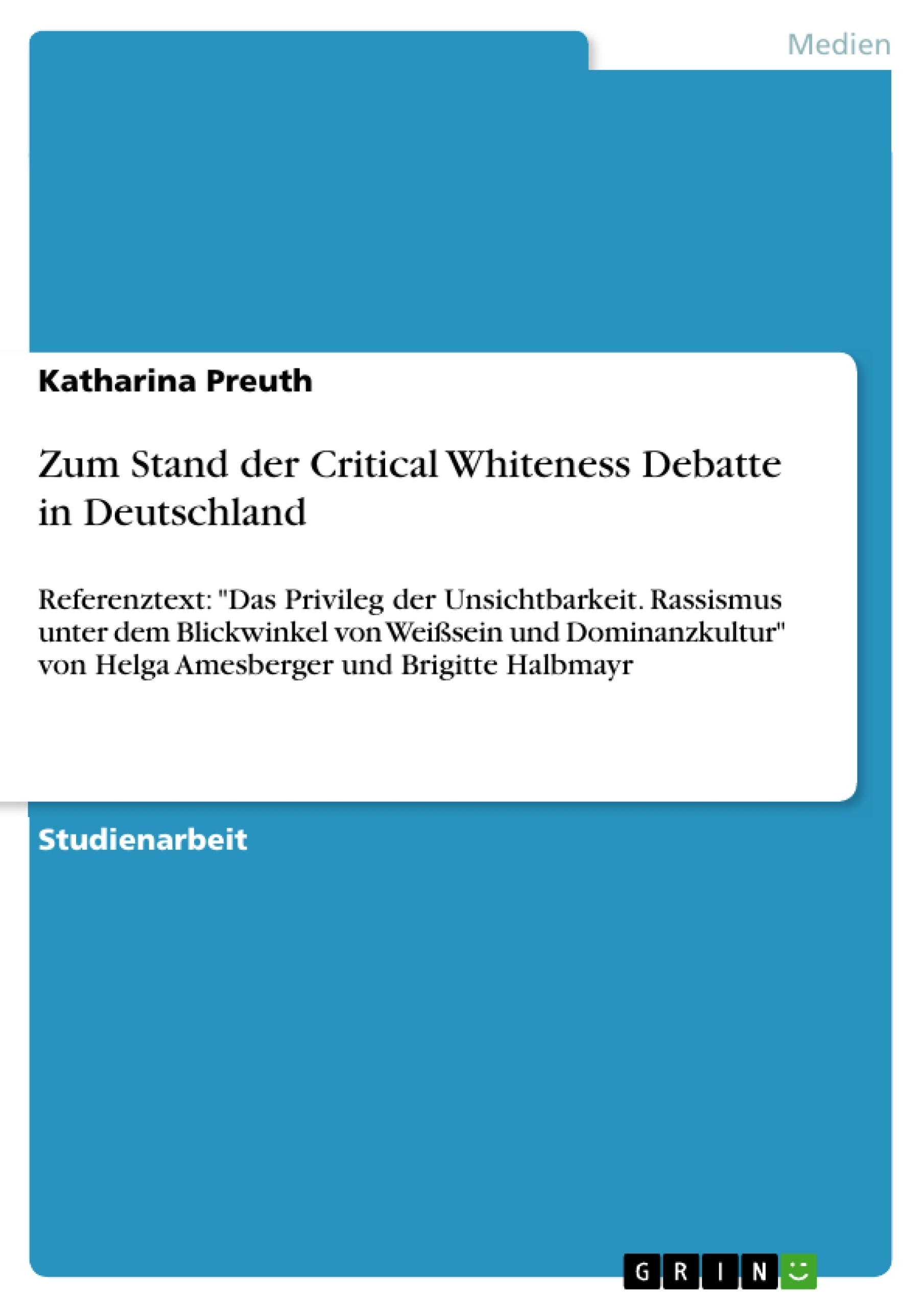Die vorliegende Arbeit beleuchtet, welche Dimensionen Weißsein angenommen hat, wo die geschichtlichen Ursprünge dieses Phänomens zu suchen sind und wie der Stand der Critical Whiteness Debatte im deutschsprachigen Raum einzustufen ist. Das Aufzeigen des Status quo macht auf eine intensive und vor allem kritische Debatte aufmerksam, die Verbesserungspotenziale im Hinblick auf gesellschaftliche Empathiefähigkeit und Toleranz beherbergt und damit insgesamt als zukunftsweisend eingestuft werden kann.
Als maßgeblicher Referenztext dieser Ausarbeitung liegt der Text „Das Privileg der Unsichtbarkeit“ von Helga Amesberger und Brigitte Halbmayr, erschienen im Jahr 2008, zugrunde. Die Gliederung dieser Arbeit orientiert sich an dem Aufbau der Ausführungen beider Autorinnen und behandelt nach der Definition und geschichtlichen Verortung von Critical Whiteness in Punkt 2. die einzelnen und klar nachvollziehbaren Dimensionen von Whiteness (s. Punkt 2.1 „Weißsein als (unbenannte und unmarkierte) Norm bis Punkt 2.7 „Weißsein als (Konflikt um) Identität“). Inhaltlich werden diese Abschnitte mit Seminartexten angereichert. Diese Ergänzungen sind nicht als Kritik am Referenztext zu verstehen. Vielmehr fließen in die stark soziologisch geprägten Ausführungen von Amesberger und Halbmayr zentrale Thesen der Kunstkritik zum Rassismus mit ein, die den Fokus des Referenztextes erweitern und die Aussagekraft der einzelnen Dimensionen des Weißseins stärken. Auf diese Art und Weise wird die Auswertung des Referenztextes in den Gesamtkontext des Seminars eingebettet. In Punkt 2.8 „Verengungen und Überdehnungen von Weißsein“ werden die kritischen Thesen von Amesberger und Halbmayr zur aktuellen deutschsprachigen Debatte referiert und gleichzeitig einer thematischen Verengung bzw. Überdehnung von Weißsein zugeordnet. Schließlich erfolgt in Punkt 3. eine persönliche Einschätzung der diskutierten Thesen sowie ein Blick auf das künstlerische Zeitgeschehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorstellung der Ausarbeitungsperspektive
- 2. Critical Whiteness in der deutschsprachigen Debatte
- 2.1 Weißsein als (unbenannte und unmarkierte) Norm
- 2.2 Weißsein als unsichtbare Kategorie
- 2.3 Weißsein als Mythos
- 2.4 Weißsein als (Kontrolle der) Geschichte
- 2.5 Weißsein als (Re)Produktion von Macht
- 2.6 Weißsein als (Kultur des) Konsums
- 2.7 Weißsein als (Konflikt um) Identität
- 2.8 Verengungen und Überdehnungen von Weißsein
- 3. Persönliche Einschätzung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die Dimensionen von Weißsein im deutschsprachigen Raum und setzt sich mit der Critical Whiteness Debatte auseinander. Sie analysiert die historischen Ursprünge des Phänomens und beleuchtet den aktuellen Stand der Debatte. Die Arbeit will auf die Bedeutung dieser kritischen Auseinandersetzung für eine Verbesserung der gesellschaftlichen Empathiefähigkeit und Toleranz hinweisen. Als zentrale Grundlage dient der Text "Das Privileg der Unsichtbarkeit" von Helga Amesberger und Brigitte Halbmayr.
- Definition und historische Verortung von Critical Whiteness
- Dimensionen von Whiteness: Weißsein als Norm, unsichtbare Kategorie, Mythos, Kontrolle der Geschichte, (Re)Produktion von Macht, Kultur des Konsums und Konflikt um Identität
- Kritische Thesen von Amesberger und Halbmayr zur aktuellen deutschsprachigen Debatte
- Einfluss von Weißsein auf die Kunstgeschichte und das künstlerische Zeitgeschehen
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit präsentiert die Ausarbeitungsperspektive und stellt den zentralen Referenztext "Das Privileg der Unsichtbarkeit" von Helga Amesberger und Brigitte Halbmayr vor. Dieser Text bildet die Grundlage für die Analyse von Critical Whiteness in der deutschsprachigen Debatte.
Das zweite Kapitel geht auf die Definition und die historischen Ursprünge von Critical Whiteness ein. Es werden die einzelnen Dimensionen von Whiteness, wie sie von Amesberger und Halbmayr beschrieben werden, detailliert untersucht. Der Text beleuchtet dabei die unterschiedlichen Bedeutungen von Weißsein als Norm, als unsichtbare Kategorie, als Mythos, als Kontrolle der Geschichte, als (Re)Produktion von Macht, als Kultur des Konsums und als Konflikt um Identität.
Im dritten Kapitel werden die kritischen Thesen von Amesberger und Halbmayr zur aktuellen deutschsprachigen Debatte referiert. Es wird untersucht, wie sich die Thesen auf den gesellschaftlichen Diskurs über Weißsein auswirken und welche Herausforderungen die Übertragung der Critical Whiteness Debatte auf den deutschsprachigen Raum mit sich bringt.
Schlüsselwörter
Critical Whiteness, Weißsein, Whiteness, Rassismus, Hegemoniekritik, Norm, unsichtbare Kategorie, Mythos, Geschichte, Macht, Konsum, Identität, deutschsprachige Debatte, Kunstgeschichte, künstlerisches Zeitgeschehen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Critical Whiteness Debatte?
Es ist eine kritische Auseinandersetzung mit „Weißsein“ als unhinterfragte gesellschaftliche Norm und den damit verbundenen unsichtbaren Privilegien.
Was bedeutet „Weißsein als unsichtbare Kategorie“?
Weißsein wird oft nicht als spezifische ethnische Identität wahrgenommen, sondern als neutraler Standard, an dem alles „Andere“ gemessen wird.
Wie hängen Weißsein und Macht zusammen?
Die Debatte analysiert, wie Weißsein zur (Re)Produktion von Machtstrukturen und zur Kontrolle der Geschichtsschreibung beigetragen hat.
Welche Rolle spielt Weißsein in der Kunstgeschichte?
Die Arbeit untersucht, wie rassistische Stereotype und die weiße Norm die Kunstkritik und die Bewertung künstlerischen Schaffens historisch geprägt haben.
Was ist das Ziel dieser kritischen Auseinandersetzung?
Ziel ist die Förderung von gesellschaftlicher Empathiefähigkeit, Toleranz und der Abbau struktureller Diskriminierung durch das Bewusstmachen verborgener Privilegien.
- Citar trabajo
- Master of Education Katharina Preuth (Autor), 2012, Zum Stand der Critical Whiteness Debatte in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370992