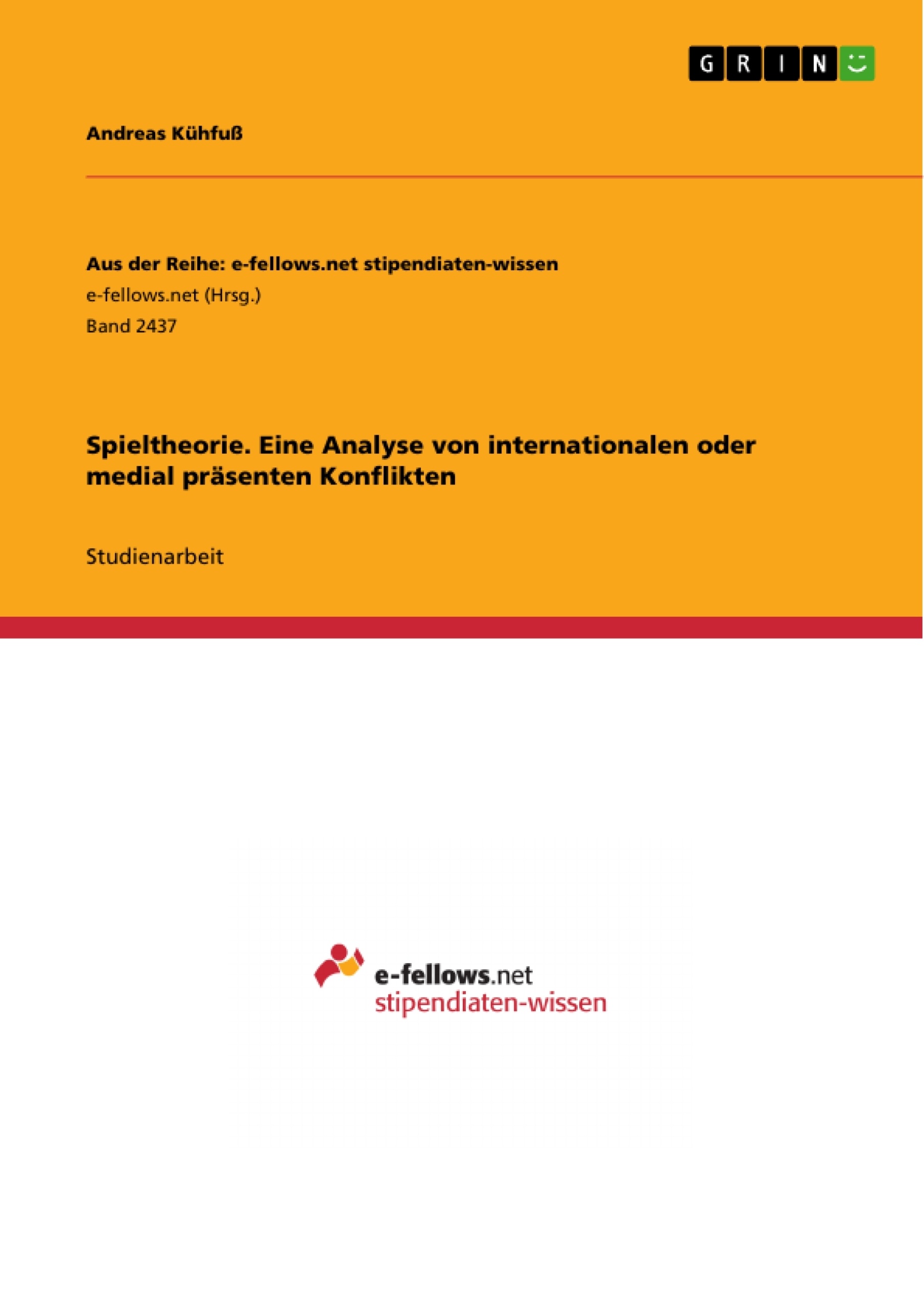Die vorliegende Arbeit erläutert das Modell der Spieltheorie und stellt verschiedene Ausprägungen von Spielen dar. Anhand einfacher Beispiele sollen Parallelen zu internationalen oder medial präsenten Konflikten aufgezeigt werden. Eine praktische Anwendung der Methoden wird bei Fallbeispielen aus Politik und Wirtschaft vollzogen. Es sollen anhand spieltheoretischer Ansätze die Handlungsalternativen der beteiligten Spieler aufgezeigt und Strategien definiert werden.
Bei der Anbahnung eines Konflikts oder einer anstehenden Entscheidung betrachtet man oftmals nur die eigene Situation. Die klassische Entscheidungstheorie dient hierbei als Hilfsmittel und versucht, aus mehreren Alternativen die für den Entscheider optimale zu finden. Hierfür gibt sie Hilfestellungen, wie Menschen rationale Entscheidungen treffen können und will erklären, wie reale Entscheidungen zustande kommen. Für die Ordnung der Entscheidungsergebnisse müssen diese nicht nur bekannt sein, sondern auch bewertet werden können.
Betrachtet werden dabei Individuen, Gruppen und Organisationen. Da die Wahl einer Alternative nicht durch das Handeln anderer Akteure beeinflusst wird, bestehen keine Interdependenzen. In der Realität sind aber oftmals genau solche Abhängigkeiten zu anderen Entscheidungsträgern vorhanden, welche das eigene Handeln elementar beeinflussen können. Die Interaktionen anderer beteiligter Parteien dürfen daher bei Entscheidungen nicht außer Acht gelassen werden. Da die klassische Entscheidungstheorie bei solchen Fällen kein Ergebnis liefern kann, möchte die Spieltheorie erweiterte Lösungsansätze bereitstellen. Sie wird ebenfalls zu den Entscheidungstheorien gezählt und befasst sich mit der Frage, wie ein Individuum oder eine Gruppe entscheidet, wenn sowohl das eigene Handeln als auch die Aktionen interdependenter Akteure Einfluss auf das Ergebnis der Entscheidung besitzen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Abstract
- II. Abbildungsverzeichnis
- III. Tabellenverzeichnis
- IV. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Allgemeine Einführung in das Thema Spieltheorie
- 2. Spieltheorie als Erklärungsmodell für Konflikte
- 2.1. Einführung und Begriffsdefinition
- 2.2. Pioniere
- 2.3. Klassische Spiele der Spieltheorie
- 2.3.1. Statisches Spiel mit vollständiger Information
- 2.3.2. Statische Spiele mit unvollständiger Information
- 2.3.3. Dynamische Spiele mit vollständiger Information
- 2.3.4. Dynamische Spiele mit unvollständiger Information
- 2.3.5. Kooperative Spieltheorie
- 2.3.6. Spiele mit fehlerhaften Strategien
- 3. Angewandte Spieltheorie
- 3.1. Länderfinanzausgleich
- 3.2. Griechenland und der Rest der Eurozone
- 3.3. Volkswagen AG vs. Prevent DEV GmbH
- 3.4. Terrorismus
- 4. Zusammenfassung
- Einführung und Begriffsdefinition der Spieltheorie
- Analyse verschiedener Spieltypen (statische/dynamische Spiele, vollständige/unvollständige Information)
- Anwendung der Spieltheorie in realen Konflikten (z.B. Länderfinanzausgleich, Griechenlandkrise, VW-Prevent-Konflikt, Terrorismus)
- Bewertung der Wirksamkeit der Spieltheorie als Erklärungsmodell für Konflikte
- Diskussion der Grenzen und Möglichkeiten der Spieltheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit dem Thema Spieltheorie und deren Anwendung in der Analyse von internationalen oder medial präsenten Konflikten. Sie zielt darauf ab, die Grundprinzipien der Spieltheorie zu erläutern und anhand verschiedener Beispiele deren Anwendung in unterschiedlichen Konfliktkonstellationen aufzuzeigen. Darüber hinaus soll die Arbeit das Verständnis für die Komplexität von Entscheidungen in interdependenten Situationen fördern.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Spieltheorie ein und beleuchtet ihre Bedeutung als Erklärungsmodell für Konflikte. Es werden die grundlegenden Konzepte und Definitionen der Spieltheorie vorgestellt, sowie die Pioniere der Theorie. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Spieltypen und erläutert deren Charakteristika, wie z.B. statische und dynamische Spiele sowie Spiele mit vollständiger und unvollständiger Information. Beispiele aus der Spieltheorie werden vorgestellt, um die verschiedenen Konzepte zu verdeutlichen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Anwendung der Spieltheorie in realen Konflikten. Anhand von Beispielen wie dem Länderfinanzausgleich, der Griechenlandkrise, dem Konflikt zwischen VW und Prevent sowie dem Thema Terrorismus wird demonstriert, wie die Spieltheorie zur Analyse und zum Verständnis von komplexen Entscheidungssituationen beitragen kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Spieltheorie, Konflikte, Kooperation, Entscheidungsfindung, Strategie, Interdependenzen, Auszahlungsmatrix, Nash-Gleichgewicht, Länderfinanzausgleich, Griechenlandkrise, Volkswagen, Prevent, Terrorismus. Diese Begriffe beschreiben die zentralen Themen und Konzepte der Arbeit und verdeutlichen den Fokus auf die Analyse von Konflikten und die Anwendung der Spieltheorie als Instrument zur Erklärung und Lösung dieser Konflikte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Spieltheorie?
Spieltheorie ist ein mathematisches und soziologisches Modell, das untersucht, wie Akteure (Individuen, Firmen, Staaten) Entscheidungen treffen, wenn das Ergebnis nicht nur vom eigenen Handeln, sondern auch von den Aktionen anderer abhängt.
Was versteht man unter einem Nash-Gleichgewicht?
Ein Nash-Gleichgewicht ist eine Situation, in der kein Spieler seine Strategie ändern möchte, solange die anderen Spieler ihre Strategien beibehalten, da jede Änderung zu einem schlechteren Ergebnis führen würde.
Wie wird die Spieltheorie in der Politik angewendet?
Sie hilft bei der Analyse von Konflikten wie der Griechenlandkrise oder dem Länderfinanzausgleich, indem sie die Interessen und möglichen Reaktionen aller beteiligten Parteien (z.B. Eurozone vs. Griechenland) modelliert.
Was ist der Unterschied zwischen kooperativer und nicht-kooperativer Spieltheorie?
In der kooperativen Spieltheorie können Spieler verbindliche Verträge schließen, um den gemeinsamen Nutzen zu maximieren. In der nicht-kooperativen Spieltheorie entscheidet jeder Akteur rein nach seinem individuellen Vorteil.
Kann Spieltheorie beim Thema Terrorismus helfen?
Ja, sie wird genutzt, um Strategien zur Terrorabwehr zu entwickeln, indem die Interaktionen zwischen Sicherheitsbehörden und terroristischen Gruppen als strategisches „Spiel“ analysiert werden.
- Citation du texte
- Andreas Kühfuß (Auteur), 2017, Spieltheorie. Eine Analyse von internationalen oder medial präsenten Konflikten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370279