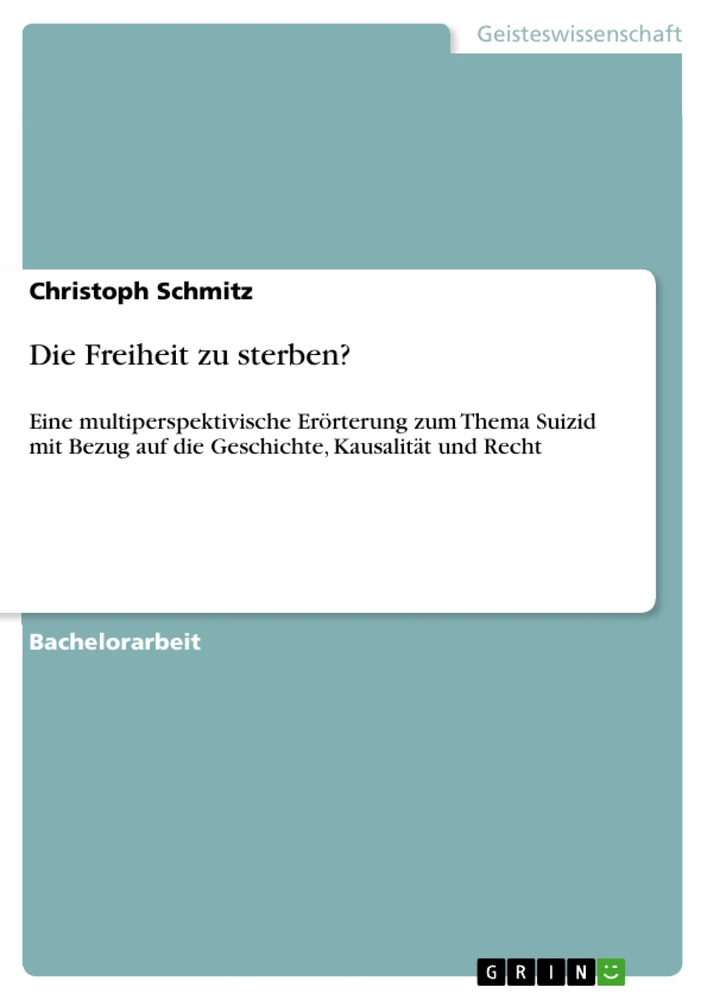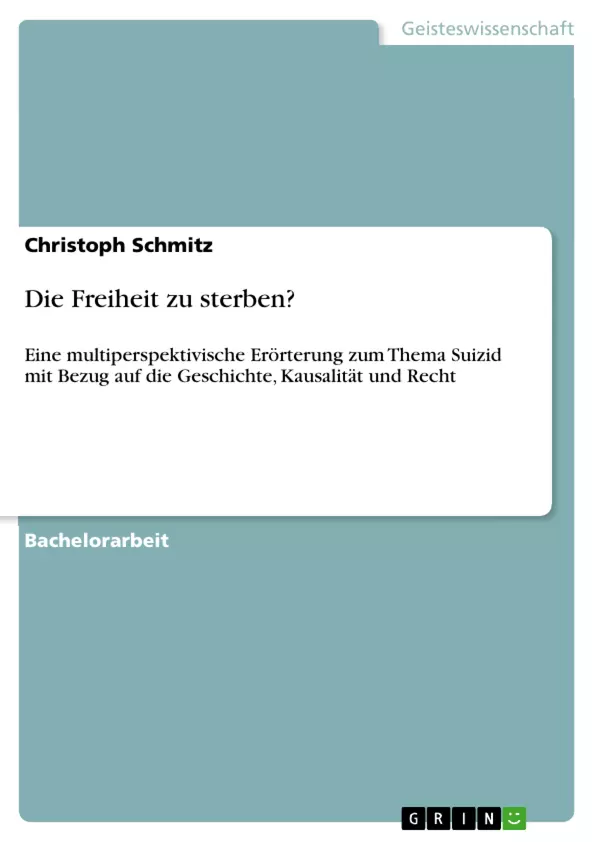Der Tod ist Teil des Lebens. Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens zwangsweise mit ihm konfrontiert, sei es der eigene oder der Tod von Familienangehörigen, Freunden oder des Lebenspartners. Wir Menschen müssen uns dieser Thematik stellen, wenngleich es eine sehr emotionale und traurige ist. Die Motivation, freiwillig zu sterben, kann sehr unterschiedlich und scheint von Dritten oft nicht nachvollziehbar zu sein. Doch neben den Fragen, warum ein Mensch seine eigene Existenz auslöscht, wer die Schuld trägt und ob man es hätte verhindern können, ist zu klären, ob der Mensch die Freiheit hat und haben darf, sich umzubringen. Freilich wird der Verfasser diese Frage nicht abschließend klären können, jedoch sollen Ambivalenzen in der Freiheit zum Suizid aufgezeigt werden. Dazu werden als Grundlage zunächst Begriffe bezüglich des Suizids voneinander abgegrenzt und definiert. Anschließend soll der Suizid als existenzielles Problem historisch aufgearbeitet werden. Dabei soll veranschaulicht werden, unter welchen Lebensumständen die Menschen in Zentral-Europa von der Antike bis heute gelebt haben und wie der Suizid philosophisch und gesellschaftlich bewertet wurde. Dieser Rückblick soll in der Darstellung der rechtlichen und politischen Situation heute in Deutschland enden. Um zu klären, wie frei ein Mensch bei der Entscheidung zum Suizid sein kann, sollen weiter soziologische, biologische und psychologische Einflussgrößen aufgezeigt werden. Danach werden die bisherigen Ergebnisse in einem Zwischenfazit zusammengefasst und hinsichtlich etwaiger Ambivalenzen der Freiheit im Suizid durch den Verfasser weitergedacht. Wie die Polizei in Deutschland mit Suizidenten umgeht und wie sie es begründet, soll abschließend aufgezeigt werden.
Auf den ersten Blick haben die Begriffe Suizid, Selbstmord, Selbsttötung, Freitod und Opfertod dieselbe Bedeutung, nämlich das Beenden der eigenen Existenz durch eine selbst ausgeführte, zum Tode führende Handlung. Die Wortwahl bei der Benennung des Phänomens ist jedoch sprechend, denn die unterschiedlichen Begriffe stehen in geschichtlichem Kontext und sind unterschiedlich konnotiert. Wie der moralisierende Begriff „Selbstmord“ schon zeigt, verbindet dieser den Tod mit einem Verbrechen an sich selbst. Der Begriff ist mit dem sog. „Augustin-Verbot“ des spätrömischen Reiches verknüpft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Die Herkunft verschiedener Suizidbegriffe
- Eine inhaltliche Annäherung an den Begriff Suizid
- Formen der Sterbehilfe
- Die Freiheit des Menschen als Grundrecht
- Philosophische Ideen über den Suizid als historische Skizze
- Die Antike - griechische und römische Philosophie
- Mittelalter Aquin, Dante und Montaigne
- Die Neuzeit - Kant, Hume und Schopenhauer
- Die Moderne - philosophische Heterogenität
- Politische und rechtliche Regularien Deutschlands
- Die Strafbarkeit von Suizid und Sterbehilfe
- Direkte aktive Sterbehilfe und Suizid im Vergleich
- Die indirekte aktive und passive Sterbehilfe
- Das politische Statement zu einer moralischen Frage
- Die Strafbarkeit von Suizid und Sterbehilfe
- Warum Suizid? Eine polykausale Ergründung
- Zahlen und Fakten
- Suizid eine vererbbare Krankheit des Geistes?
- Soziologische Einflussgrößen
- Eine Annäherung an die Psyche von Suizidenten
- Ambivalenzen der Freiheit im Suizid
- Eine kurze Zusammenschau
- Die Freiheit zu sterben - eine Widersprüchlichkeit?
- Umgang der Polizei mit Suizid(enten)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Suizid und untersucht die Frage, ob der Mensch die Freiheit hat und haben darf, sich selbst das Leben zu nehmen. Der Autor analysiert verschiedene Aspekte des Suizids, darunter die historische Entwicklung des Verständnisses von Suizid, die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen in Deutschland sowie die psychologischen und soziologischen Faktoren, die zum Suizid beitragen können. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Ambivalenzen, die mit der Freiheit zum Suizid verbunden sind.
- Die historische Entwicklung des Suizidbegriffs
- Die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen in Deutschland
- Die psychologischen und soziologischen Ursachen von Suizid
- Die Ambivalenzen der Freiheit zum Suizid
- Der Umgang der Polizei mit Suizidenten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Frage nach der Freiheit zum Suizid. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Begriffsdefinitionen zum Suizid geklärt und die verschiedenen Formen der Sterbehilfe unterschieden. Das dritte Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des philosophischen Denkens zum Suizid, von der Antike bis zur Moderne. Kapitel 4 analysiert die politischen und rechtlichen Regelungen in Deutschland im Bezug auf Suizid und Sterbehilfe. Kapitel 5 beschäftigt sich mit den Ursachen von Suizid und betrachtet die Rolle von biologischen, psychologischen und soziologischen Faktoren. In Kapitel 6 werden die Ambivalenzen der Freiheit im Kontext des Suizids untersucht. Das abschließende Kapitel beleuchtet den Umgang der Polizei mit Suizid(enten) in Deutschland.
Schlüsselwörter
Suizid, Sterbehilfe, Freiheit, Selbsttötung, philosophische Perspektiven, rechtliche Rahmenbedingungen, psychologische Ursachen, soziologische Faktoren, Umgang mit Suizid(enten)
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen Unterschied zwischen den Begriffen Selbstmord und Freitod?
Ja, die Begriffe sind unterschiedlich konnotiert. "Selbstmord" ist historisch moralisierend und mit dem "Augustin-Verbot" verknüpft, während "Freitod" oder "Suizid" eher neutraler oder die persönliche Freiheit betonend verwendet werden.
Wie ist die rechtliche Lage zur Sterbehilfe in Deutschland?
In Deutschland wird rechtlich zwischen direkter aktiver Sterbehilfe (strafbar), indirekter aktiver Sterbehilfe und passiver Sterbehilfe unterschieden. Die Arbeit analysiert die politischen und rechtlichen Regularien dieser Formen.
Wie bewerteten Philosophen wie Kant oder Schopenhauer den Suizid?
Die Bewertung wandelte sich historisch stark: Während die Antike oft einen pragmatischen Blick hatte, lehnten Denker wie Kant den Suizid moralisch meist ab, während Hume oder Schopenhauer differenziertere Positionen einnahmen.
Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung zum Suizid?
Die Entscheidung ist meist polykausal und wird durch soziologische Einflüsse, biologische Faktoren und die individuelle psychische Verfassung beeinflusst.
Wie geht die Polizei in Deutschland mit Suizidenten um?
Die Polizei hat spezifische Handlungsvorgaben und Begründungen für den Umgang mit Personen, die einen Suizid versuchen oder vollziehen, wobei oft der Schutz des Lebens im Vordergrund steht.
- Citar trabajo
- Christoph Schmitz (Autor), 2016, Die Freiheit zu sterben?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370267