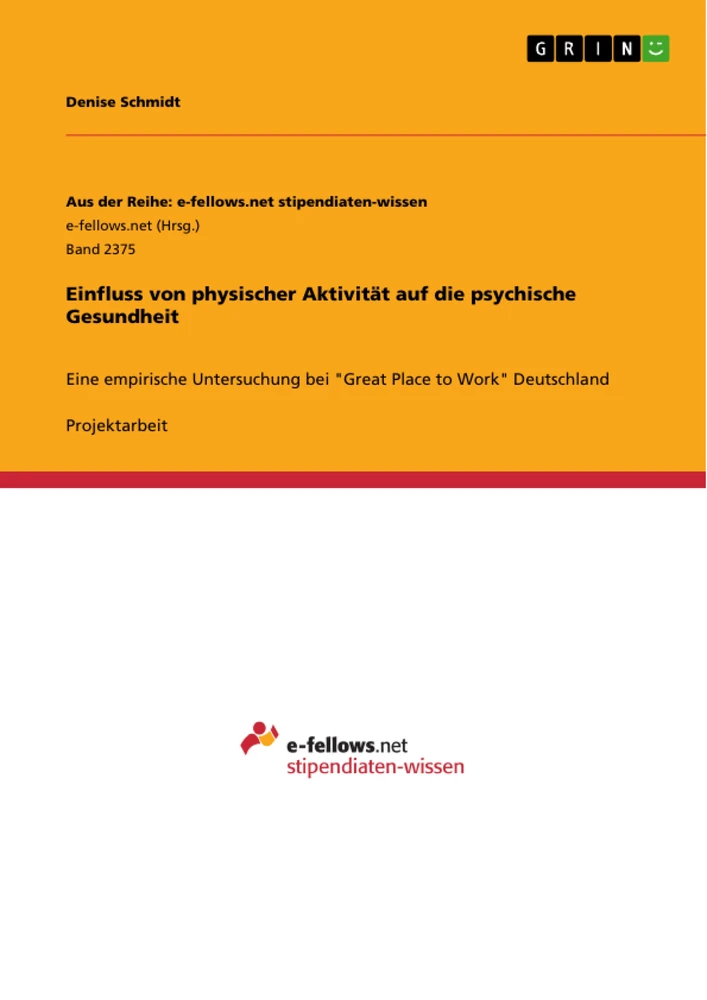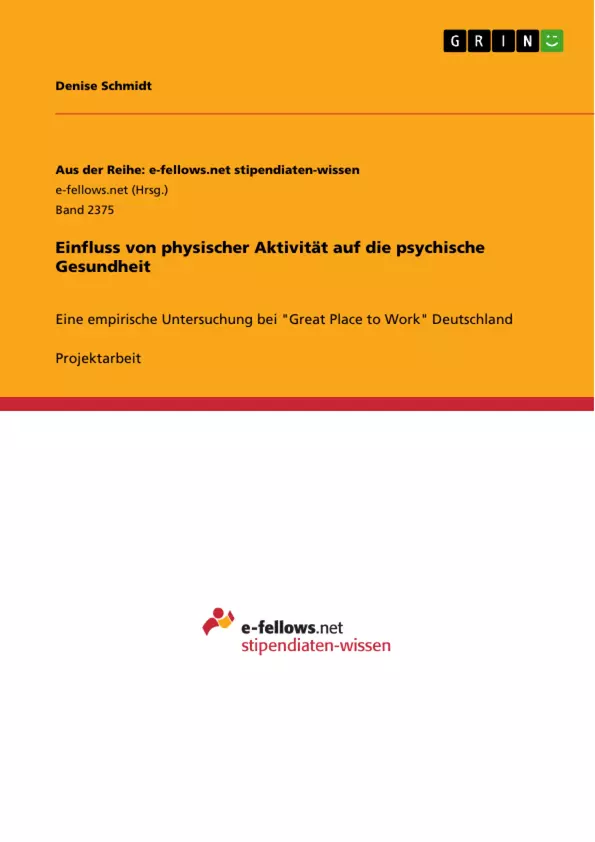Auch im Arbeitsleben wird das Thema „Gesundheit“ zunehmend präsenter, da es die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen beeinflussen kann. Durch die rasende Veränderung der Arbeitswelt und neuer Produktionsabläufe ist körperliche Arbeit bei
weitem nicht mehr so anstrengend wie früher und Dank der hohen Sicherheitsstandards kommen Arbeitsunfälle viel seltener vor. Dadurch rückt der Fokus auf die Berücksichtigung der seelischen Bedürfnisse der Mitarbeiter, um diesen besser gerecht
zu werden. Die Ausrichtung auf die Förderung der psychischen Gesundheit stellt zwar eine Herausforderung für die Wirtschaft dar, ist dafür allerdings nicht nur im Sinne der Angestellten ein wichtiger Aspekt, da seelische Leiden mittlerweile die Hauptursache für Berufsunfähigkeit und Frühverrentung darstellen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde verzeichnet einen kontinuierlichen Anstieg der Inanspruchnahme therapeutischer Leistungen bei psychischen Erkrankungen. Depression, Angst und Sucht sind zu Volkskrankheiten geworden, jeder Dritte erkrankt mindestens einmal in seinem Leben.
Neben der psychischen Gesundheit soll in dieser Hausarbeit auch die körperliche Konstitution betrachtet werden. Im Lebensstil unserer modernen Industriegesellschaft werden Bewegungen weitestgehend vermieden, körperliche Bewegungen werden immer weiter reduziert. Der neue Trend ist es, sich bewegen zu lassen – im Auto, auf der Rolltreppe oder im Fahrstuhl. Maschinen und Automaten machen körperlichen Einsatz überflüssig. Die dominierende Körperhaltung des Alltags ist mittlerweile das Sitzen. Dazu kommt das passive Erholen, z.B. vor dem Fernseher, als häufigste Form des Ausgleichs für die vielfältigen psychischen Anforderungen in Beruf und Familie. Dem gegenüber steht die körperliche Bewegung als aktive Erholungsform des Alltags.
In der folgenden Hausarbeit soll herausgestellt werden, inwiefern sich körperliche Bewegung auf die psychische Gesundheit auswirkt. Dieses Thema ist von besonders hoher Relevanz vor dem Hintergrund möglicher Präventionsmaßnahmen gegen die steigende Anzahl Betroffener von psychischen Erkrankungen wie z.B. Burnout Patienten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Bezugsrahmen
- 2.1 Aktueller Literaturstand psychischer Gesundheit
- 2.2 Theorie seelischer Gesundheit nach Becker
- 2.3 Operationalisierung seelischer Gesundheit
- 2.4 Physische Aktivität und psychische Gesundheit
- 3. Forschungsgegenstand
- 4. Methode
- 4.1 Stichprobe
- 4.2 Erhebungsverfahren
- 5. Ergebnisse
- 6. Interpretation
- 7. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss physischer Aktivität auf die psychische Gesundheit. Ziel ist es, einen empirischen Beitrag zu diesem Themenkomplex zu leisten und die Zusammenhänge zwischen körperlicher Bewegung und seelischem Wohlbefinden zu analysieren. Die Studie wurde bei Great Place to Work® durchgeführt.
- Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und psychischer Gesundheit
- Anwendung der Theorie seelischer Gesundheit nach Becker
- Empirische Untersuchung mittels Fragebogen
- Auswertung der Ergebnisse und Interpretation der Daten
- Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Relevanz der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen physischer Aktivität und psychischer Gesundheit. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die Struktur der Arbeit skizziert.
2. Theoretischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur psychischen Gesundheit. Es präsentiert die Theorie der seelischen Gesundheit nach Becker und beschreibt die Operationalisierung seelischer Gesundheit im Kontext der Studie. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des theoretischen Bezugsrahmens zwischen physischer Aktivität und psychischer Gesundheit, wobei etablierte Theorien und Modelle diskutiert werden und die Grundlage für die Hypothesenbildung bilden.
3. Forschungsgegenstand: In diesem Kapitel wird der konkrete Forschungsgegenstand der Studie detailliert beschrieben. Dies beinhaltet die Definition der relevanten Variablen, die Festlegung der Stichprobe und die Begründung der Wahl des Untersuchungskontextes (Great Place to Work®). Die spezifischen Fragestellungen der Studie werden präzisiert und die methodischen Überlegungen werden vorbereitet.
4. Methode: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Zusammensetzung der Stichprobe, die eingesetzten Erhebungsverfahren (z.B. Art des Fragebogens) und die statistischen Analyseverfahren. Die Gütekriterien der eingesetzten Messinstrumente werden kritisch bewertet und die methodischen Limitationen werden transparent dargestellt.
5. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung übersichtlich und prägnant. Die Ergebnisse werden mittels Tabellen und Grafiken visualisiert und statistisch aufbereitet. Eine Interpretation der Ergebnisse findet in einem späteren Kapitel statt.
6. Interpretation: Dieses Kapitel interpretiert die in Kapitel 5 präsentierten Ergebnisse im Kontext des theoretischen Bezugsrahmens. Die Ergebnisse werden diskutiert und im Hinblick auf die Forschungsfrage bewertet. Mögliche Limitationen der Studie und Ansatzpunkte für zukünftige Forschung werden erörtert.
Schlüsselwörter
Physische Aktivität, psychische Gesundheit, seelisches Wohlbefinden, empirische Untersuchung, Great Place to Work®, Becker-Modell, Fragebogen, Varianzanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einfluss physischer Aktivität auf die psychische Gesundheit
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss physischer Aktivität auf die psychische Gesundheit. Sie liefert einen empirischen Beitrag zu diesem Thema und analysiert die Zusammenhänge zwischen körperlicher Bewegung und seelischem Wohlbefinden. Die Studie wurde bei Great Place to Work® durchgeführt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und psychischer Gesundheit empirisch zu untersuchen. Sie wendet die Theorie der seelischen Gesundheit nach Becker an und wertet die Ergebnisse mittels Fragebogen aus. Die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis wird ebenfalls betrachtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: den Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und psychischer Gesundheit, die Anwendung des Becker-Modells der seelischen Gesundheit, eine empirische Untersuchung mittels Fragebogen, die Auswertung und Interpretation der Daten sowie die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretischer Bezugsrahmen (inkl. aktueller Literaturstand, Becker-Theorie, Operationalisierung seelischer Gesundheit und dem Zusammenhang von physischer Aktivität und psychischer Gesundheit), Forschungsgegenstand, Methode (inkl. Stichprobe und Erhebungsverfahren), Ergebnisse, Interpretation und Schlussteil.
Was beinhaltet der theoretische Bezugsrahmen?
Der theoretische Bezugsrahmen bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur psychischen Gesundheit, präsentiert die Theorie der seelischen Gesundheit nach Becker, beschreibt die Operationalisierung seelischer Gesundheit im Studienkontext und beleuchtet den theoretischen Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und psychischer Gesundheit.
Wie wurde die empirische Untersuchung durchgeführt?
Kapitel 4 beschreibt detailliert die Methodik: Es erläutert die Zusammensetzung der Stichprobe, die verwendeten Erhebungsverfahren (z.B. Art des Fragebogens) und die statistischen Analyseverfahren. Die Gütekriterien der Messinstrumente werden bewertet und methodische Limitationen transparent dargestellt.
Wie werden die Ergebnisse präsentiert und interpretiert?
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse übersichtlich mit Tabellen und Grafiken. Kapitel 6 interpretiert die Ergebnisse im Kontext des theoretischen Bezugsrahmens, bewertet sie im Hinblick auf die Forschungsfrage und diskutiert Limitationen und Ansatzpunkte für zukünftige Forschung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Physische Aktivität, psychische Gesundheit, seelisches Wohlbefinden, empirische Untersuchung, Great Place to Work®, Becker-Modell, Fragebogen, Varianzanalyse.
- Citation du texte
- Denise Schmidt (Auteur), 2016, Einfluss von physischer Aktivität auf die psychische Gesundheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369391