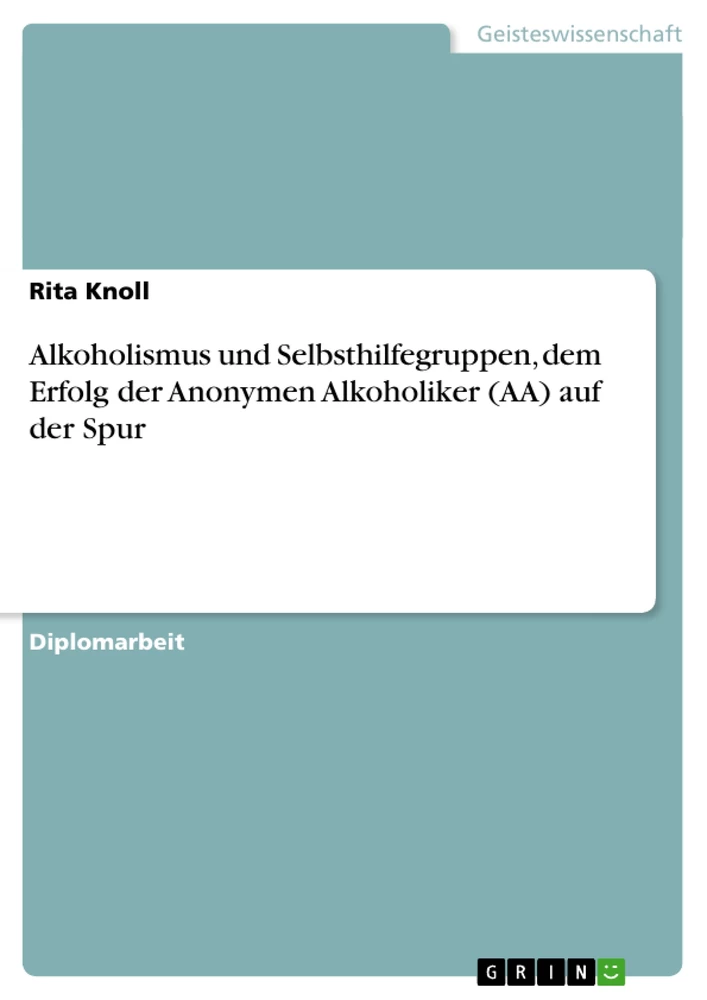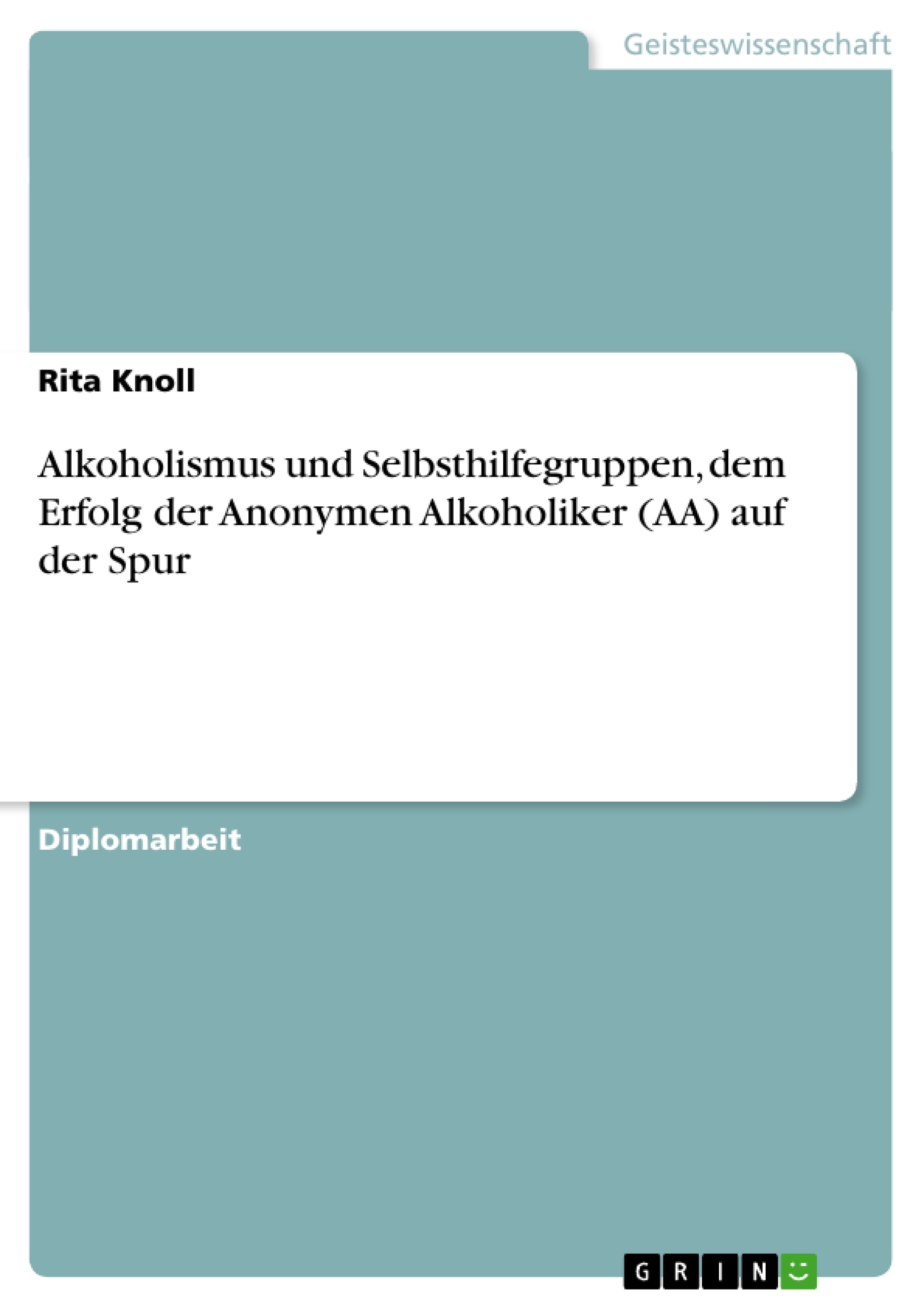"Ich persönlich habe immer Therapien abgelehnt. (...) Sie bringen absolut nichts. Und zwar weil es nur der Kopf ist ... der [Therapeut] kann mir ja gar nicht helfen, denn vom Verstand her weiß ich so viel wie der, also ohne angeben zu wollen. Der kann mir auch nichts anderes sagen, als leben sie im Jetzt oder im Hier und Heute und machen sie das Wichtigste zuerst, also alles, was ich in den Gruppen auch höre."
(Interviewpartner A, 61 Jahre alt, seit 27 Jahren trocken)
Deutschland gehört zu den Ländern mit dem höchsten Alkoholkonsum in der Welt. Pro Jahr sterben daran schätzungsweise 70 000 Menschen (Lindenmeyer 2001, S. 36). 2,65 Millionen Menschen sind in Deutschland nach Angaben der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e.V. (DHS) alkoholkrank. Zwei Drittel davon sind Männer, ein Drittel Frauen und 250 000 Jugendliche und junge Erwachsene. Das sind 6,4 % der Bevölkerung ab 18 Jahren. Das Leid einer Suchterkrankung betrifft die gesamte Familie. Fünf bis sieben Millionen Angehörige sind in Deutschland lt. DHS durch die Alkoholabhängigkeit eines Familienmitgliedes betroffen.
Somit kennt fast jeder einen Menschen, der zu viel trinkt. Er ist meist hilflos, wenn es darum geht, den Alkoholkranken zur Einschränkung des Alkoholkonsums bzw. zur Abstinenz motivieren zu wollen. Ich nutzte meine Praxisphase im Studium für die intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht im Allgemeinen und Alkoholismus im Besonderen. Für die beiden Praxissemester suchte ich mir gezielt Stellen in der Psychosomatischen Klinik Bad Herrenalb und im Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V., einer Einrichtung der Diakonie in Stuttgart.
In beiden Praktikastellen hatte ich die Möglichkeit, Alkoholabhängige jeden Alters nä-her kennenzulernen und mich mit ihren Bemühungen, abstinent zu werden, zu beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- I Vorbelegungen
- 1. Diagnostik und Deskription der Alkoholkrankheit
- 1.1 Die fünf Typen des Alkoholismus nach Jellinek
- 1.2 Die Phasen des Alkoholismus nach Jellinek
- 2. Alkoholismus als multifaktorieller Prozess
- 2.1 Individuelle Faktoren
- 2.2 Alkoholismus und Familie
- 3. Alkohol und Gesellschaft
- 3.1 Epidemiologie
- 3.2 Alkoholpolitik in Deutschland
- 3.3 Alkoholpolitik in den USA
- 3.4 Alkopops - der neue Einstieg zum Alkoholkonsum im Jugendalter
- 1. Diagnostik und Deskription der Alkoholkrankheit
- II Versorgungsstrukturen
- 1. Therapeutische Versorgung von Alkoholikern
- 1.1 Traditionelle Suchtkrankenhilfe
- 1.2 Psychosoziale/psychiatrische Basisversorgung
- 1.3 Medizinische Primärversorgung
- 1.4 Behandlungsrealität
- 2. Behandlungsergebnisse
- 2.1 Prävention
- 2.2 Rückfall und Rückfallprophylaxe
- 2.3 Genesungsverlauf
- 3. Ressourcennutzung
- 3.1 Motivierung
- 3.2 Selbsthilfegruppen-Bewegung
- 1. Therapeutische Versorgung von Alkoholikern
- III Sucht und Selbsthilfe
- 1. Alkoholiker-Selbsthilfegruppen
- 1.1 Geschichte
- 1.2 Bedeutung
- 2. Anonyme Alkoholiker (AA)
- 2.1 Entstehung der AA
- 2.2 AA-Gruppen in Deutschland
- 2.3 Persönliche Genesung (12 Schritte)
- 2.4 Genesung durch die Gruppe (12 Traditionen)
- 2.5 Genesungsverlauf
- 1. Alkoholiker-Selbsthilfegruppen
- IV Empirische Erhebung
- 1. Ausarbeitung der Fragestellung
- 1.1 Willensstärke versus Kapitulation
- 1.2 Kontrolliertes Trinken versus Abstinenz
- 1.3 Heilung versus Stillstand der Sucht
- 1.4 Expertenwissen versus Spiritualität
- 1.5 Kernfragen
- 2. Befragung
- 2.1 Qualitatives Interview (Leitfadeninterview)
- 2.1.1 Vorgehen im Interview
- 2.1.2 Interviewteilnehmer
- 2.2 Thesen
- 2.3 Ergebnis der Befragung
- 2.4 Auswertung des Interviews
- 2.4.1 These 1: Willensstärke versus Kapitulation
- 2.4.2 These 2: Kontrolliertes Trinken versus Abstinenz
- 2.4.3 These 3: Heilung versus Stillstand der Sucht
- 2.4.4 These 4: Expertenwissen versus Spiritualität
- 2.5 Stellungnahme
- 2.6 Fazit
- 2.1 Qualitatives Interview (Leitfadeninterview)
- 1. Ausarbeitung der Fragestellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Erfolg der Anonymen Alkoholiker (AA) und beleuchtet verschiedene Aspekte des Alkoholismus. Ziel ist es, die Wirksamkeit der AA-Methode im Vergleich zu anderen Behandlungsansätzen zu betrachten und die zentralen Faktoren für den Erfolg der Selbsthilfegruppen zu identifizieren.
- Diagnostik und Beschreibung des Alkoholismus
- Versorgungsstrukturen und Behandlungsansätze bei Alkoholismus
- Die Rolle von Selbsthilfegruppen, insbesondere der Anonymen Alkoholiker (AA)
- Empirische Untersuchung der AA-Methode anhand von Interviews
- Vergleich verschiedener Perspektiven auf Genesung (Willensstärke vs. Kapitulation, Abstinenz vs. kontrolliertes Trinken etc.)
Zusammenfassung der Kapitel
I Vorbelegungen: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in den Alkoholismus. Es beschreibt die verschiedenen Typen und Phasen der Erkrankung nach Jellinek und analysiert den Alkoholismus als multifaktoriellen Prozess, der sowohl individuelle Faktoren als auch gesellschaftliche und familiäre Einflüsse umfasst. Die epidemiologischen Daten und die Diskussion der Alkoholpolitik in Deutschland und den USA bieten einen wichtigen Kontext für das Verständnis der Problematik. Der Abschnitt über Alkopops beleuchtet den Aspekt des frühen Alkoholkonsums.
II Versorgungsstrukturen: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen therapeutischen, psychosozialen und medizinischen Angeboten zur Behandlung von Alkoholismus. Es analysiert die traditionelle Suchtkrankenhilfe, die psychosoziale und psychiatrische Versorgung sowie die medizinische Primärversorgung und beleuchtet die Realität der Behandlungssituation. Weiterhin werden Behandlungsergebnisse, Prävention, Rückfallprophylaxe und der Genesungsverlauf detailliert dargestellt. Schließlich wird die Rolle der Ressourcennutzung und der Motivierung von Betroffenen in Bezug auf Selbsthilfegruppen erörtert.
III Sucht und Selbsthilfe: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Bedeutung von Selbsthilfegruppen bei der Bewältigung von Alkoholismus. Es wird die Geschichte der Alkoholiker-Selbsthilfegruppen im Allgemeinen und der Anonymen Alkoholiker (AA) im Besonderen nachgezeichnet. Die zwölf Schritte und zwölf Traditionen der AA werden erläutert und ihre Bedeutung für den Genesungsprozess herausgestellt. Der Kapitel analysiert die Bedeutung persönlicher und gemeinschaftlicher Genesung innerhalb des AA-Kontexts.
Schlüsselwörter
Alkoholismus, Anonyme Alkoholiker (AA), Selbsthilfegruppen, Suchtkrankenhilfe, Behandlung, Prävention, Rückfallprophylaxe, Genesung, multifaktorieller Prozess, individuelle Faktoren, gesellschaftliche Faktoren, Epidemiologie, kontrolliertes Trinken, Abstinenz, Spiritualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: "Erfolg der Anonymen Alkoholiker (AA)"
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Erfolg der Anonymen Alkoholiker (AA) und beleuchtet verschiedene Aspekte des Alkoholismus. Das Hauptziel ist es, die Wirksamkeit der AA-Methode im Vergleich zu anderen Behandlungsansätzen zu betrachten und die zentralen Faktoren für den Erfolg der Selbsthilfegruppen zu identifizieren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Diagnostik und Beschreibung des Alkoholismus, Versorgungsstrukturen und Behandlungsansätze, die Rolle von Selbsthilfegruppen (insbesondere der AA), eine empirische Untersuchung der AA-Methode mittels Interviews, und einen Vergleich verschiedener Perspektiven auf Genesung (z.B. Willensstärke vs. Kapitulation, Abstinenz vs. kontrolliertes Trinken).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptkapitel: I. Vorbelegungen (Einführung in den Alkoholismus, inklusive Diagnostik, multifaktorieller Prozesse und gesellschaftlicher Aspekte), II. Versorgungsstrukturen (therapeutische Versorgung, Behandlungsergebnisse, Ressourcennutzung), III. Sucht und Selbsthilfe (Alkoholiker-Selbsthilfegruppen, Anonyme Alkoholiker, die 12 Schritte und 12 Traditionen), und IV. Empirische Erhebung (Fragestellung, qualitative Interviews, Auswertung und Fazit).
Welche Methoden wurden in der empirischen Erhebung verwendet?
Die empirische Erhebung basiert auf qualitativen Interviews (Leitfadeninterviews). Die Interviews untersuchten verschiedene Perspektiven auf die Genesung, wie z.B. Willensstärke versus Kapitulation, kontrolliertes Trinken versus Abstinenz, Heilung versus Stillstand der Sucht und Expertenwissen versus Spiritualität.
Welche zentralen Fragen werden in der Arbeit untersucht?
Zentrale Fragen der Arbeit sind: Die Wirksamkeit der AA-Methode im Vergleich zu anderen Ansätzen; die Bedeutung von Willensstärke und Kapitulation im Genesungsprozess; die Rolle von kontrolliertem Trinken versus Abstinenz; der Unterschied zwischen Heilung und Stillstand der Sucht; und die Bedeutung von Expertenwissen im Vergleich zu Spiritualität bei der Genesung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alkoholismus, Anonyme Alkoholiker (AA), Selbsthilfegruppen, Suchtkrankenhilfe, Behandlung, Prävention, Rückfallprophylaxe, Genesung, multifaktorieller Prozess, individuelle Faktoren, gesellschaftliche Faktoren, Epidemiologie, kontrolliertes Trinken, Abstinenz, Spiritualität.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis ist detailliert aufgebaut und gliedert die Arbeit in die vier Hauptkapitel mit zahlreichen Unterkapiteln, die die einzelnen Aspekte des Alkoholismus und der AA-Methode systematisch behandeln. Es ermöglicht eine präzise Orientierung im Text.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird im Text bereitgestellt?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet eine kurze, prägnante Übersicht über den Inhalt jedes Kapitels und hebt die wichtigsten Ergebnisse und Argumentationslinien hervor. Sie erleichtert das Verständnis des Gesamtkontextes der Arbeit.
- Quote paper
- Rita Knoll (Author), 2005, Alkoholismus und Selbsthilfegruppen, dem Erfolg der Anonymen Alkoholiker (AA) auf der Spur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36920