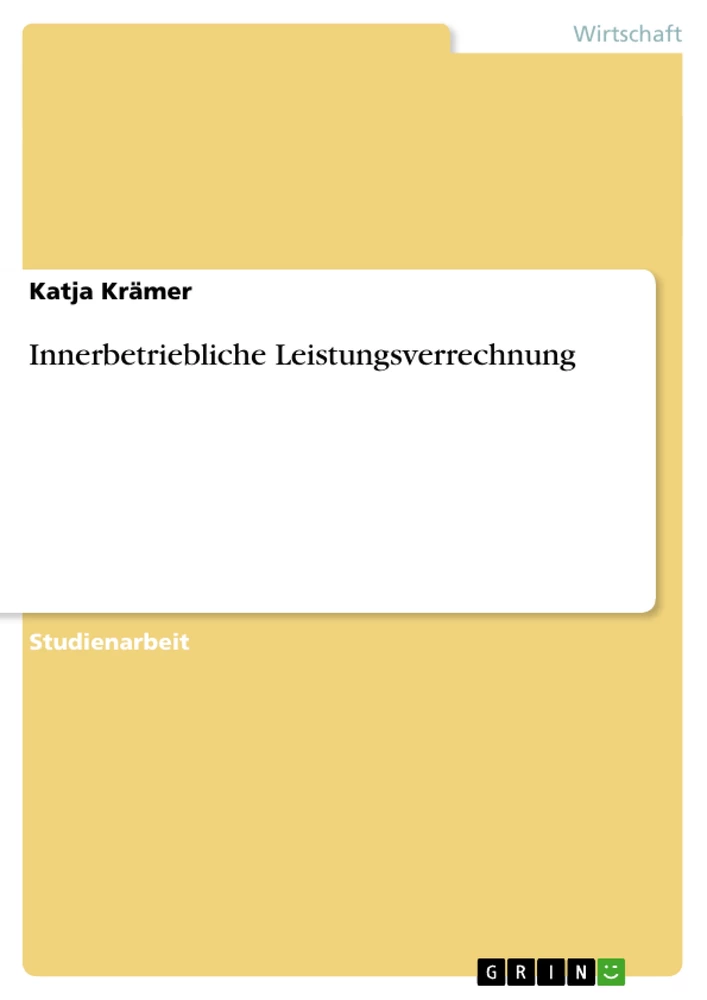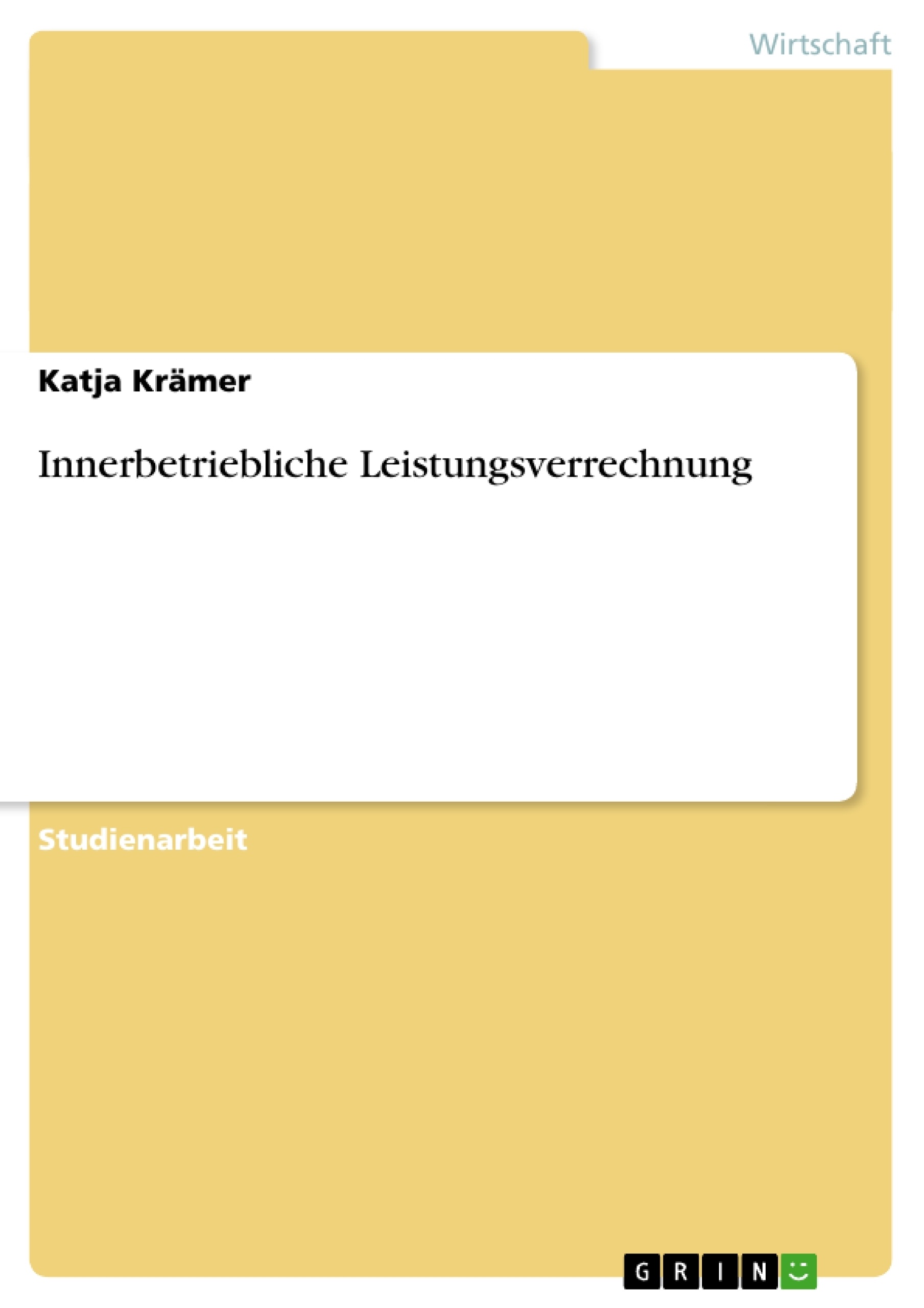Die Kosten- und Leistungsrechnung als Teilgebiet des internen Rechnungswesens dient als Instrument zur mengen- und wertmäßigen Erfassung des Verzehrs von Produktionsfaktoren und der Leistungserstellung.1 Eine saubere und korrekte Kalkulation ist für ein marktwirtschaftlich orientiertes Unternehmen unerlässlich. Nach dem Verursacherprinzip versucht man mit Hilfe der gewonnenen Informationen die Kosten möglichst genau den Kostenträgern zuzurechnen, wodurch eine Erfolgsermittlung einzelner Produkte oder des gesamten Sortiments sowie eine Rentabilitätskontrolle gewährleistet werden und letztendlich eine Entscheidung auf der Basis dieser Daten getroffen werden kann.2 Dafür ist zunächst erforderlich, dass die Kosten- und Leistungsrechnung innerhalb der Kostenartenrechnung herausstellt, welche Produktionsfaktoren in der betrachteten Periode verbraucht bzw. in Anspruchgenommen wurden, um dann im Rahmen der Kostenstellenrechnung Auskunft darüber geben zu können, wo und in welcher Höhe innerhalb des Betriebes den Endprodukten nicht zurechenbare Kosten entstanden sind. Die in der Kostenartenrechnung ermittelten Kosten können aber nur unter der Berücksichtigung, dass Kostenstellen sowohl Leistungen für den Absatzmarkt erbringen, als auch solche, die wieder im Betriebsprozess eingesetzt werden, sinnvoll diesen zugerechnet werden. Anschließend ist durch die Kostenträgerrechnung eine Verteilung der angefallenen Kosten auf die einzelnen Leistungen möglich.3 Über die Art und Weise der Verrechnung der in der Kostenartenrechnung erfassten innerbetrieblichen Leistungen muss eine Entscheidung getroffen werden. Diesbezüglich wurden unterschiedliche Verfahren und Methoden entwickelt, die sich in verschiedenen Punkten, wie z.B. der Handhabung, der Genauigkeit ihrer Ergebnisse und dem zu ihrer Durchführung nötigen Arbeitsaufwand, voneinander unterscheiden. Im Rahmen dieser Hausarbeit werden neben einer Charakterisierung innerbetrieblicher Leistungen mögliche Verrechnungsverfahren vorgestellt und bewertet.
1 vgl. Hummel/ Männel (1990), S. 7f.
2 vgl. Wöhe/ Döring (1996), S. 1277
3 vgl. Zimmermann (1998), S. 27, 67
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriff und Abgrenzung innerbetrieblicher Leistungen
- 3. Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
- 3.1 Nicht-exakte Verfahren ohne Hilfskostenstellen
- 3.1.1 Kostenartenverfahren
- 3.1.2 Kostenstellenausgleichsverfahren
- 3.1.3 Kostenträgerverfahren
- 3.2 Nicht-exakte Verfahren mit Hilfskostenstellen
- 3.2.1 Anbauverfahren
- 3.2.2 Stufenleiterverfahren
- 3.3 Exakte Verfahren mit Hilfskostenstellen
- 3.3.1 Simultanes Gleichungsverfahren
- 3.3.2 Iterationsverfahren
- 3.1 Nicht-exakte Verfahren ohne Hilfskostenstellen
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Ziel ist es, verschiedene Verfahren der Leistungsverrechnung zu charakterisieren und zu bewerten. Die Arbeit untersucht die Begrifflichkeiten und Abgrenzungen innerbetrieblicher Leistungen und analysiert verschiedene exakte und nicht-exakte Verfahren.
- Begriff und Abgrenzung innerbetrieblicher Leistungen
- Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (exakt und nicht-exakt)
- Anwendung verschiedener Verrechnungsmethoden
- Bewertung der Verfahren hinsichtlich Genauigkeit und Aufwand
- Bedeutung für die Kostenrechnung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kosten- und Leistungsrechnung ein und betont deren Bedeutung für die Kalkulation und Entscheidungsfindung in marktwirtschaftlich orientierten Unternehmen. Sie beschreibt den Ablauf der Kostenrechnung, beginnend mit der Kostenartenrechnung, über die Kostenstellenrechnung bis hin zur Kostenträgerrechnung, und hebt die Notwendigkeit der Berücksichtigung innerbetrieblicher Leistungen hervor. Die Arbeit kündigt die Vorstellung und Bewertung verschiedener Verrechnungsverfahren an.
2. Begriff und Abgrenzung innerbetrieblicher Leistungen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der innerbetrieblichen Leistungen, sowohl materieller als auch immaterieller Art, und grenzt ihn von marktorientierten Leistungen ab. Es setzt innerbetriebliche Leistungen in Beziehung zu den Begriffen der originären und derivativen Produktionsfaktoren und erklärt deren Rolle in der primären und sekundären Grundrechnung. Das Kapitel behandelt auch die Einteilung innerbetrieblicher Leistungen in aktivierbare und nicht aktivierbare Leistungen und erläutert die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kostenrechnung.
Schlüsselwörter
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung, Kostenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Verrechnungspreise, exakte Verfahren, nicht-exakte Verfahren, Hilfskostenstellen, originäre Produktionsfaktoren, derivative Produktionsfaktoren, aktivierbare Leistungen, nicht aktivierbare Leistungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition und Abgrenzung innerbetrieblicher Leistungen, eine detaillierte Beschreibung verschiedener Verfahren zur Leistungsverrechnung (exakte und nicht-exakte Verfahren mit und ohne Hilfskostenstellen), ein Fazit und ein Glossar wichtiger Schlüsselbegriffe. Die Arbeit analysiert die Verfahren hinsichtlich Genauigkeit und Aufwand und erläutert deren Bedeutung für die Kostenrechnung.
Welche Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung werden behandelt?
Die Hausarbeit beschreibt sowohl nicht-exakte Verfahren ohne Hilfskostenstellen (Kostenartenverfahren, Kostenstellenausgleichsverfahren, Kostenträgerverfahren), als auch nicht-exakte Verfahren mit Hilfskostenstellen (Anbauverfahren, Stufenleiterverfahren). Darüber hinaus werden exakte Verfahren mit Hilfskostenstellen behandelt (Simultanges Gleichungsverfahren, Iterationsverfahren).
Wie werden die Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung eingeordnet?
Die Verfahren werden nach ihrer Genauigkeit (exakt/nicht-exakt) und dem Einsatz von Hilfskostenstellen kategorisiert. Diese Kategorisierung ermöglicht einen strukturierten Vergleich der verschiedenen Methoden.
Was sind innerbetriebliche Leistungen und wie werden sie abgegrenzt?
Die Hausarbeit definiert den Begriff der innerbetrieblichen Leistungen (materielle und immaterielle) und grenzt diese von marktorientierten Leistungen ab. Der Zusammenhang zu originären und derivativen Produktionsfaktoren sowie die Einteilung in aktivierbare und nicht aktivierbare Leistungen wird ebenfalls erläutert.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, verschiedene Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung zu charakterisieren, zu bewerten und ihre Bedeutung für die Kostenrechnung aufzuzeigen. Die Analyse umfasst die Begrifflichkeiten, Abgrenzungen und die Anwendung der verschiedenen Verrechnungsmethoden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis der Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Innerbetriebliche Leistungsverrechnung, Kostenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Verrechnungspreise, exakte Verfahren, nicht-exakte Verfahren, Hilfskostenstellen, originäre Produktionsfaktoren, derivative Produktionsfaktoren, aktivierbare Leistungen, nicht aktivierbare Leistungen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von der Definition innerbetrieblicher Leistungen und einer detaillierten Darstellung der verschiedenen Verrechnungsverfahren. Sie endet mit einem Fazit, welches die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst. Ein Inhaltsverzeichnis erleichtert die Navigation.
Welche Bedeutung hat die innerbetriebliche Leistungsverrechnung für die Kostenrechnung?
Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung ist essentiell für eine genaue Kostenrechnung, da sie die Verteilung von Kosten zwischen verschiedenen Kostenstellen und Kostenträgern ermöglicht. Dies ist entscheidend für die Kalkulation und Entscheidungsfindung in Unternehmen.
- Quote paper
- Katja Krämer (Author), 2002, Innerbetriebliche Leistungsverrechnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36917