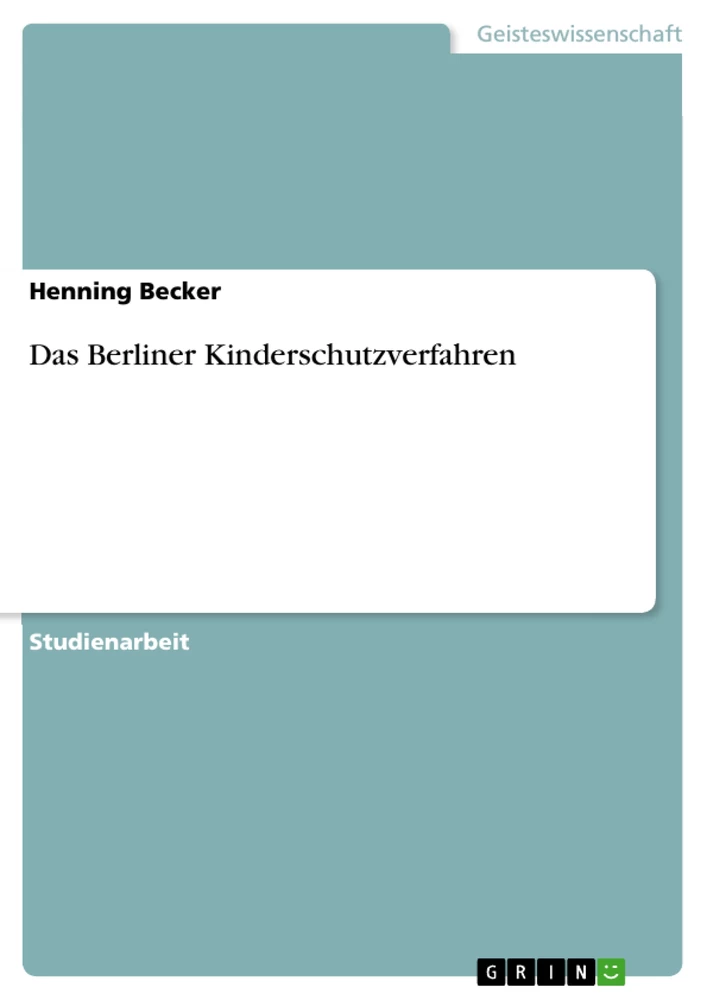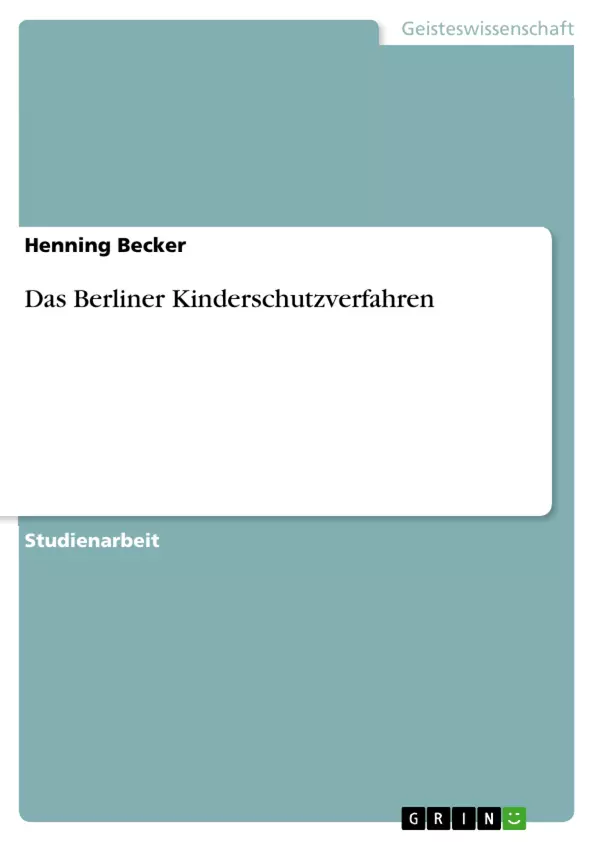In der vorliegenden Arbeit werden exemplarisch das Berliner Kinderschutzverfahren und seine "Zweistufigkeit" näher vorgestellt.
Mehrere tragische Kindeswohlgefährdungsfälle (teilweise mit Todesfolge sowie oft mit großer medialer Aufmerksamkeit) führten am 01.10.2005 zum Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK). Durch die Neudefinierung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) sollten die Handlungsmöglichkeiten und -verpflichtungen der Jugendhilfe erweitert und konkretisiert werden. Eingriffe in das grundgesetzlich geschützte Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 GG) wurden für die Familiengerichte erleichtert (§ 1666 BGB). Bundesweit wurden Kinderschutzverfahren entwickelt, die zu einer größeren Handlungssicherheit führen sollten. Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 wurden diese Verfahren noch einmal erweitert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rechtliches
- 3. Berliner Kinderschutzverfahren
- 3.1 1.Stufe - „1.Check-Bogen“
- 3.2 2. Stufe - Kinderschutzbogen
- 4. Ersteinschätzungsbögen für freie Träger von Diensten und Einrichtungen
- 5. Vorteile des Kinderschutzverfahrens anhand des „Fallbeispiels Westphal“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung beschreibt das Berliner Kinderschutzverfahren, seine rechtlichen Grundlagen und die praktische Anwendung in der ersten und zweiten Stufe. Ziel ist es, einen Überblick über das Verfahren zu geben und seine zentralen Elemente zu erläutern.
- Rechtliche Grundlagen des Kinderschutzes in Deutschland
- Das zweistufige Berliner Kinderschutzverfahren
- Die Instrumente „1. Check-Bogen“ und „Kinderschutzbogen“
- Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte und Institutionen
- Risikoabschätzung und Interventionen bei Kindeswohlgefährdung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Berliner Kinderschutzverfahrens ein und beleuchtet den historischen Kontext, der zur Entwicklung und Implementierung dieses Verfahrens führte. Sie erwähnt die tragischen Kindeswohlgefährdungsfälle und die darauf folgenden gesetzlichen Änderungen, insbesondere das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) und das Bundeskinderschutzgesetz, die die Handlungsmöglichkeiten und -verpflichtungen der Jugendhilfe erweitert und konkretisiert haben. Die Einleitung betont die Notwendigkeit von bundesweit einheitlichen Kinderschutzverfahren zur Steigerung der Handlungssicherheit.
2. Rechtliches: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen des Kinderschutzes, insbesondere mit § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung). Es beschreibt die Pflichten des Jugendamtes bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, von der Einschätzung des Gefährdungsrisikos bis hin zur Inanspruchnahme weiterer Leistungsträger und der Anrufung des Familiengerichts. Die detaillierte Darstellung des § 8a SGB VIII beleuchtet die Handlungsoptionen und -verpflichtungen der Jugendhilfe, von der Gewährung von Hilfen bis hin zur Inobhutnahme des Kindes. Die Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Absicherung der Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls.
3. Berliner Kinderschutzverfahren: Dieses Kapitel beschreibt das zweistufige Berliner Kinderschutzverfahren, das aus einer ersten Stufe mit dem „1. Check-Bogen“ und einer zweiten Stufe mit dem „Kinderschutzbogen“ besteht. Es erklärt die Aufgaben des Jugendamtes beim Ausbau früher Hilfen, der Vernetzung von Diensten und der Entwicklung einheitlicher Verfahrensstandards und Dokumentationsinstrumente zur Gewährleistung von Handlungssicherheit und Absicherung der Fachkräfte. Die Beschreibung der beiden Stufen betont die systematische Erhebung und Bewertung relevanter Informationen, die Risikoabschätzung und die Notwendigkeit von Interventionen. Der verbindliche Hausbesuch wird als wichtiges Instrument zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos erläutert, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung.
Schlüsselwörter
Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung, Jugendamt, § 8a SGB VIII, Berliner Kinderschutzverfahren, 1. Check-Bogen, Kinderschutzbogen, Risikoabschätzung, Intervention, Zusammenarbeit, Handlungssicherheit, Rechtliche Grundlagen.
Häufig gestellte Fragen zum Berliner Kinderschutzverfahren
Was ist der Inhalt dieser Ausarbeitung?
Diese Ausarbeitung bietet einen umfassenden Überblick über das Berliner Kinderschutzverfahren. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Verfahrens, seiner rechtlichen Grundlagen und der praktischen Anwendung in den einzelnen Stufen.
Welche Themen werden in der Ausarbeitung behandelt?
Die Ausarbeitung behandelt die rechtlichen Grundlagen des Kinderschutzes in Deutschland, insbesondere § 8a SGB VIII. Im Detail wird das zweistufige Berliner Kinderschutzverfahren mit dem „1. Check-Bogen“ und dem „Kinderschutzbogen“ erklärt. Weitere Themen sind die Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte und Institutionen, die Risikoabschätzung und die notwendigen Interventionen bei Kindeswohlgefährdung. Ein Fallbeispiel illustriert die Vorteile des Verfahrens.
Wie ist das Berliner Kinderschutzverfahren aufgebaut?
Das Berliner Kinderschutzverfahren ist zweistufig aufgebaut. Die erste Stufe beinhaltet den „1. Check-Bogen“, der eine erste Einschätzung der Situation ermöglicht. Die zweite Stufe verwendet den „Kinderschutzbogen“ für eine detailliertere Untersuchung und Risikobewertung. Beide Stufen zielen auf eine systematische Erhebung und Bewertung relevanter Informationen ab, um geeignete Interventionen einzuleiten.
Welche rechtlichen Grundlagen sind relevant?
Die rechtlichen Grundlagen des Kinderschutzes, insbesondere § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung), bilden die Basis des Berliner Kinderschutzverfahrens. Dieser Paragraph beschreibt die Pflichten des Jugendamtes bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, von der Einschätzung des Gefährdungsrisikos bis hin zur Inanspruchnahme weiterer Leistungsträger und der Anrufung des Familiengerichts.
Welche Instrumente werden im Berliner Kinderschutzverfahren eingesetzt?
Die zentralen Instrumente sind der „1. Check-Bogen“ und der „Kinderschutzbogen“. Diese Bögen dienen der systematischen Erfassung und Bewertung relevanter Informationen zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos. Ein verbindlicher Hausbesuch ist ein wichtiges Instrument zur situativen Einschätzung.
Welche Vorteile bietet das Berliner Kinderschutzverfahren?
Das Verfahren bietet durch seine strukturierte Vorgehensweise und die Verwendung von standardisierten Instrumenten wie dem „1. Check-Bogen“ und dem „Kinderschutzbogen“ mehr Handlungssicherheit für die beteiligten Fachkräfte. Es fördert die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen und ermöglicht eine systematische Risikoabschätzung und gezielte Interventionen zum Schutz des Kindeswohls. Die standardisierten Verfahren und Dokumentationen gewährleisten eine bessere Qualitätssicherung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Ausarbeitung?
Schlüsselwörter sind: Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung, Jugendamt, § 8a SGB VIII, Berliner Kinderschutzverfahren, 1. Check-Bogen, Kinderschutzbogen, Risikoabschätzung, Intervention, Zusammenarbeit, Handlungssicherheit, Rechtliche Grundlagen.
- Arbeit zitieren
- Henning Becker (Autor:in), 2017, Das Berliner Kinderschutzverfahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368187