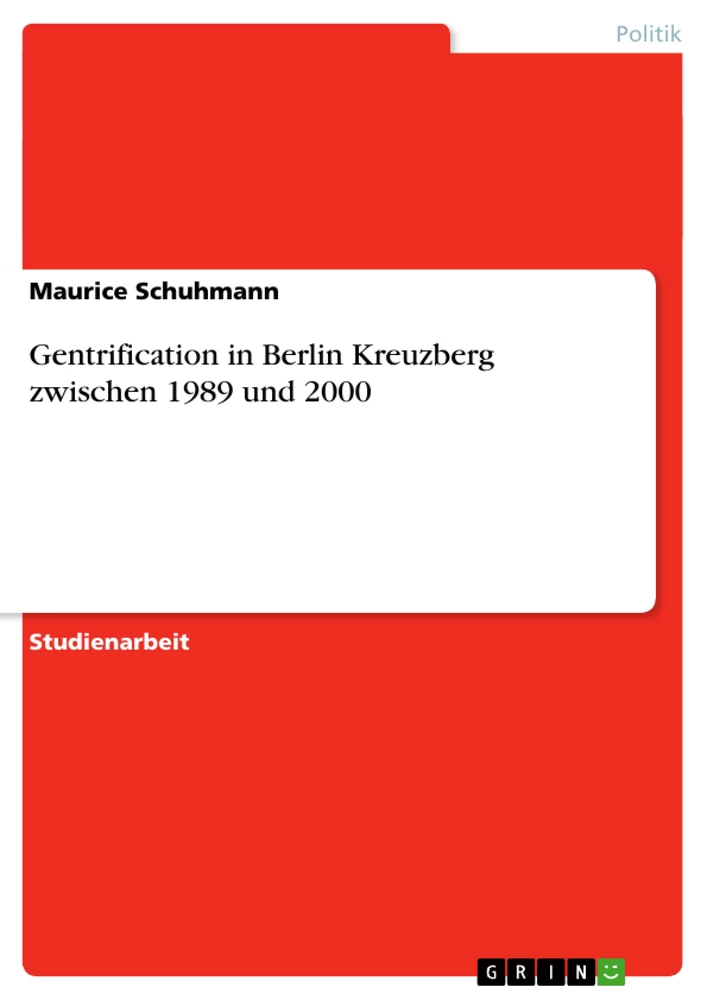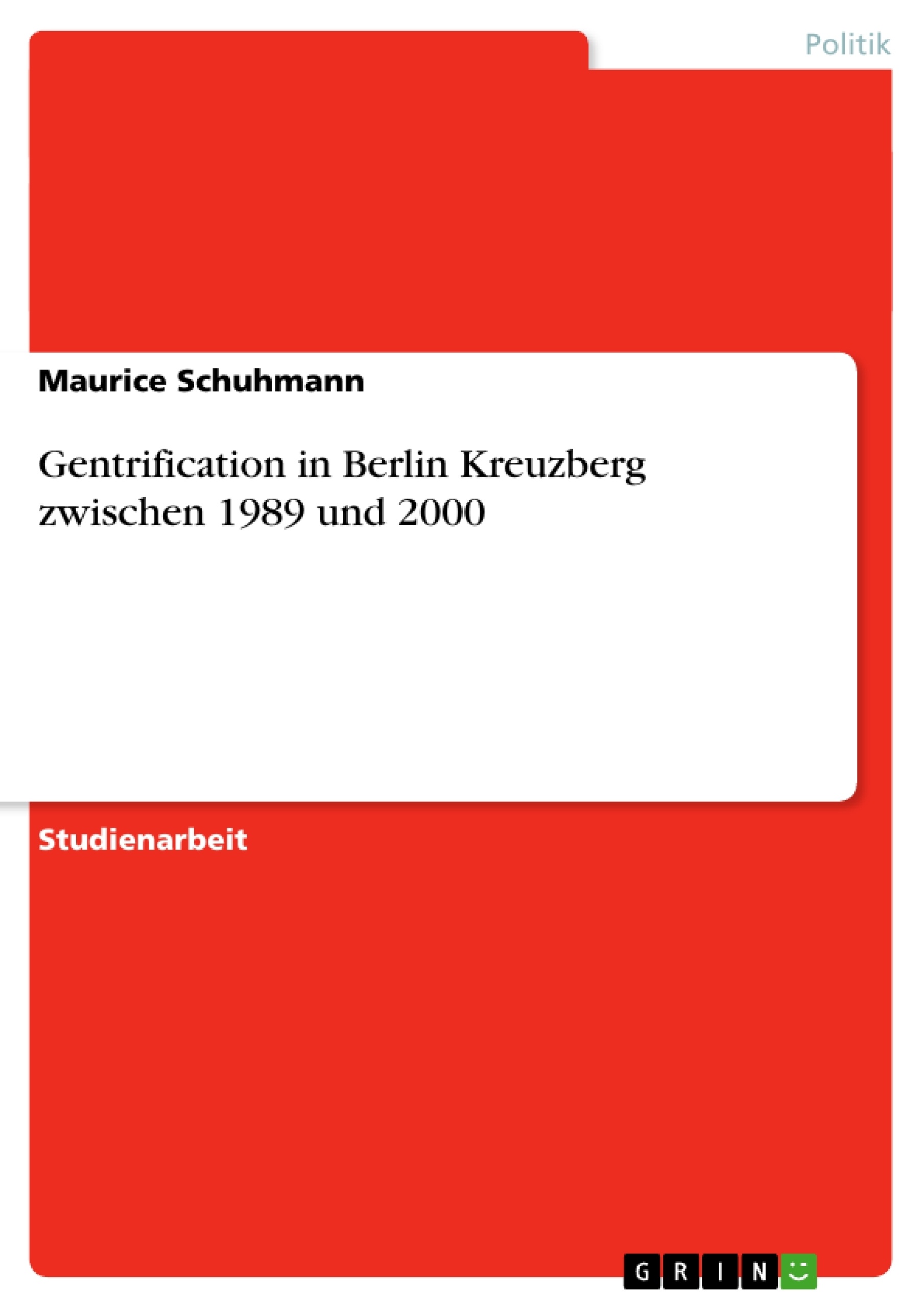Der Fall der Berliner Mauer im November 1989 und die deutsche Wiedervereinigung im Oktober des darauffolgenden Jahres führten zu einem grundlegenden Wandel in der Struktur der Stadt Berlin und seiner Bezirke. Infolge dieses Prozesses wurden in Berlin Entwicklungen nachgeholt, die andere deutsche Städte bereits hinter sich hatten. Aufgrund der politischen und geographischen „Insellage“ hatten diese Prozesse nicht stattgefunden bzw. sich verzögert. Die neue weltpolitische Situation und letztendlich die 1994 getroffene Entscheidung, daß Berlin neben der Funktion der Hauptstadt auch wieder als Regierungssitz fungieren sollte, hatten auf die Sozialstruktur und die Entwicklung der Stadt ebenfalls einen erheblichen Einfluß. Besonders stark von der veränderten Lage war im ehemaligen Westberlin der Bezirk Kreuzberg betroffen, der, während der Teilung Berlins, ein Schattendasein als Randbezirk, abgetrennt vom ehemaligen Zentrum, fristete. Die veränderte Situation des Bezirkes führte in den Jahren nach der Wiedervereinigung zu starken sozialstrukturellen Veränderungen und einer sozialen Aufwertung von Teilen des Bezirkes. Die Schattenseite dieses Gentrificationprozesses war die Verdrängung der ursprünglichen Bevölkerung und ein Auflösungsprozeß der legendären „bunten Mischung“ in diesem Bezirk. Aus dem ehemaligen Problembezirk wurde ein gefragter, an das Regierungsviertel und das neue Zentrum angrenzender Innenstadtbezirk. So schien es zumindest und so wurde es von den Medien aufgegriffen. Eine Folge von den veränderten Rahmenbedingungen hätte sein müssen, daß sich ein neuer Gentrificationprozeß in Kreuzberg in Gang setzte bzw. ein bereits eingesetzter Prozeß an Tempo gewann. Der Nachweis dieser Veränderungen steht im Mittelpunkt der vorliegenden Hausarbeit. Ausgehend von der Fragestellung, wie schnell und in welchen Schritten der Prozeß der Gentrification zwischen 1989 und 2000 verlief. Dafür werde ich das Zahlenmaterial über die Sozialstruktur des Bezirkes interpretieren. Auf eine eigene, ergänzende Erhebung mußte ich verzichten. Die Fragestellung basiert auf der Prämisse, daß es – wie in den Medien immer wieder verkündet wurde – zu einer Gentrification in Kreuzberg kam. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodische und theoretische Grundlagen
- Forschungsstandanalyse
- Gentrification
- Operationalisierung
- Kreuzberg – ein Bezirk im Wandel
- Kreuzberg vor der Wiedervereinigung
- Kreuzbergs Entwicklung seit der Wiedervereinigung
- Kreuzberg und die Gentrification
- Untersuchung der Gentrification
- Anteil der Minoritäten
- Erwerbsstruktur
- Bildungsstand
- Quellen des Lebensunterhalts
- Monatliches Nettoeinkommen
- Fazit
- Literatur- und Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Gentrificationsprozess in Kreuzberg zwischen 1989 und 2000. Das Hauptziel ist es, anhand von Veränderungen der Sozialstruktur den Verlauf und das Tempo dieses Prozesses aufzuzeigen und die These zu überprüfen, ob es in diesem Zeitraum zu einer Verstärkung der Gentrification kam. Die Arbeit stützt sich dabei auf vorhandenes statistisches Material und verzichtet auf eigene empirische Erhebungen.
- Der Einfluss der Wiedervereinigung auf die Entwicklung Kreuzbergs
- Analyse des Gentrificationsprozesses anhand sozioökonomischer Indikatoren
- Vergleich der Entwicklung Kreuzbergs mit Gesamtberlin
- Beurteilung des Tempos des Gentrificationsprozesses
- Diskussion der Forschungsliteratur zum Thema Gentrification
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den grundlegenden Wandel in Berlin nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung, mit besonderem Fokus auf Kreuzberg. Sie hebt die soziostrukturellen Veränderungen und die soziale Aufwertung von Teilen des Bezirks hervor, sowie die damit verbundene Verdrängung der ursprünglichen Bevölkerung. Die Arbeit untersucht, ob und wie schnell sich ein Gentrificationsprozess zwischen 1989 und 2000 in Kreuzberg vollzog, basierend auf der Prämisse, dass ein solcher Prozess stattgefunden hat. Die Autorin lehnt den rein kulturellen Ansatz von Barbara Lang ab und konzentriert sich auf soziale und ökonomische Indikatoren. Der gewählte Zeitraum von 1989 bis 2000 wird begründet, und die Einschränkungen bezüglich der Datenbasis und der fehlenden Unterscheidung zwischen Kreuzberg 61 und SO 36 werden erläutert. Die Arbeit basiert auf Statistiken des Statistischen Landesamtes Berlins und dem Mikrozensus sowie bereits veröffentlichten Texten. Das Ziel ist es, anhand von Veränderungen in der Sozialstruktur den Gentrificationsprozess zu belegen und dessen Tempo zu verdeutlichen.
Methodische und theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet den Forschungsstand zur Gentrification in deutschen Städten. Es wird auf frühe Studien in Hamburg, Frankfurt, München, Köln und Hannover verwiesen, sowie auf Arbeiten zu Mannheim, Kreuzberg und Prenzlauer Berg. Das Kapitel skizziert die theoretischen Grundlagen des Begriffs "Gentrification" und erläutert die Kriterien, anhand derer der Gentrificationprozess in Kreuzberg untersucht wird. Diese Kriterien orientieren sich an erfolgreichen Untersuchungen in anderen Städten, insbesondere an der Studie von Holger Stark über Prenzlauer Berg.
Kreuzberg – ein Bezirk im Wandel: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung Kreuzbergs vor und nach der Wiedervereinigung. Es beschreibt die Situation Kreuzbergs als Randbezirk vor 1989 und analysiert die Auswirkungen der Wiedervereinigung und der neuen politischen Lage auf den Bezirk. Der Fokus liegt auf den sozioökonomischen Veränderungen im Bezirk im Kontext der Gentrification.
Untersuchung der Gentrification: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung des Gentrificationsprozesses in Kreuzberg. Es analysiert verschiedene sozioökonomische Daten, wie den Anteil von Minoritäten, die Erwerbsstruktur, den Bildungsstand, die Quellen des Lebensunterhalts und das monatliche Nettoeinkommen. Der Vergleich dieser Daten mit Gesamtberlin dient zur Einordnung der Entwicklung Kreuzbergs. Die Analyse zielt darauf ab, Veränderungen zu identifizieren, die auf einen Gentrificationprozess hindeuten und dessen Tempo zu bestimmen.
Schlüsselwörter
Gentrification, Kreuzberg, Berlin, Wiedervereinigung, Sozialstruktur, Sozioökonomie, Stadtentwicklung, Wohnraum, Bevölkerungswandel, Statistische Daten, Mikrozensus, Forschungsstand.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Gentrification in Kreuzberg (1989-2000)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Gentrificationsprozess im Berliner Bezirk Kreuzberg zwischen 1989 und 2000. Sie analysiert anhand sozioökonomischer Indikatoren, wie sich die Sozialstruktur Kreuzbergs in diesem Zeitraum verändert hat und ob und wie stark eine Gentrification stattgefunden hat. Die Arbeit basiert auf bestehenden statistischen Daten und enthält keine eigenen empirischen Erhebungen.
Welche Methoden und Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Forschungsstand zur Gentrification in deutschen Städten, analysiert frühere Studien zu diesem Thema und erläutert die theoretischen Grundlagen des Begriffs „Gentrification“. Die Untersuchung des Gentrificationprozesses in Kreuzberg basiert auf der Analyse sozioökonomischer Indikatoren wie dem Anteil von Minoritäten, der Erwerbsstruktur, dem Bildungsstand, den Einkommensquellen und dem monatlichen Nettoeinkommen. Ein Vergleich mit Gesamtberlin dient der Einordnung der Entwicklung Kreuzbergs.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit verwendet statistische Daten des Statistischen Landesamtes Berlins und des Mikrozensus. Eigenständige empirische Erhebungen wurden nicht durchgeführt. Die Autorin weist auf Einschränkungen der Datenbasis hin, insbesondere die fehlende Unterscheidung zwischen den amtlichen Bezirken Kreuzberg 61 und SO 36.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Methodische und theoretische Grundlagen, Kreuzberg – ein Bezirk im Wandel, Untersuchung der Gentrification und Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Literatur- und Quellenverzeichnis.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung?
Die Arbeit analysiert die Veränderungen der Sozialstruktur in Kreuzberg zwischen 1989 und 2000 anhand der ausgewählten sozioökonomischen Indikatoren und bewertet das Tempo des Gentrificationsprozesses. Die genauen Ergebnisse sind im Kapitel „Untersuchung der Gentrification“ detailliert dargestellt. Der Vergleich mit Gesamtberlin hilft dabei, die Entwicklung Kreuzbergs einzuordnen.
Wie wird der Einfluss der Wiedervereinigung berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet die Wiedervereinigung als wichtigen Kontextfaktor für die Entwicklung Kreuzbergs und analysiert deren Auswirkungen auf die sozioökonomischen Veränderungen im Bezirk im Zusammenhang mit dem Gentrificationsprozess. Der Einfluss der Wiedervereinigung auf die Entwicklung Kreuzbergs ist ein zentraler Aspekt der Analyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gentrification, Kreuzberg, Berlin, Wiedervereinigung, Sozialstruktur, Sozioökonomie, Stadtentwicklung, Wohnraum, Bevölkerungswandel, Statistische Daten, Mikrozensus, Forschungsstand.
Welche Einschränkungen gibt es bei der Studie?
Die Arbeit weist auf die Einschränkungen der Datenbasis hin, insbesondere die fehlende Unterscheidung zwischen den amtlichen Bezirken Kreuzberg 61 und SO 36. Außerdem basiert die Studie auf bereits existierenden statistischen Daten und enthält keine eigenen empirischen Erhebungen.
- Quote paper
- Maurice Schuhmann (Author), 2004, Gentrification in Berlin Kreuzberg zwischen 1989 und 2000, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36686