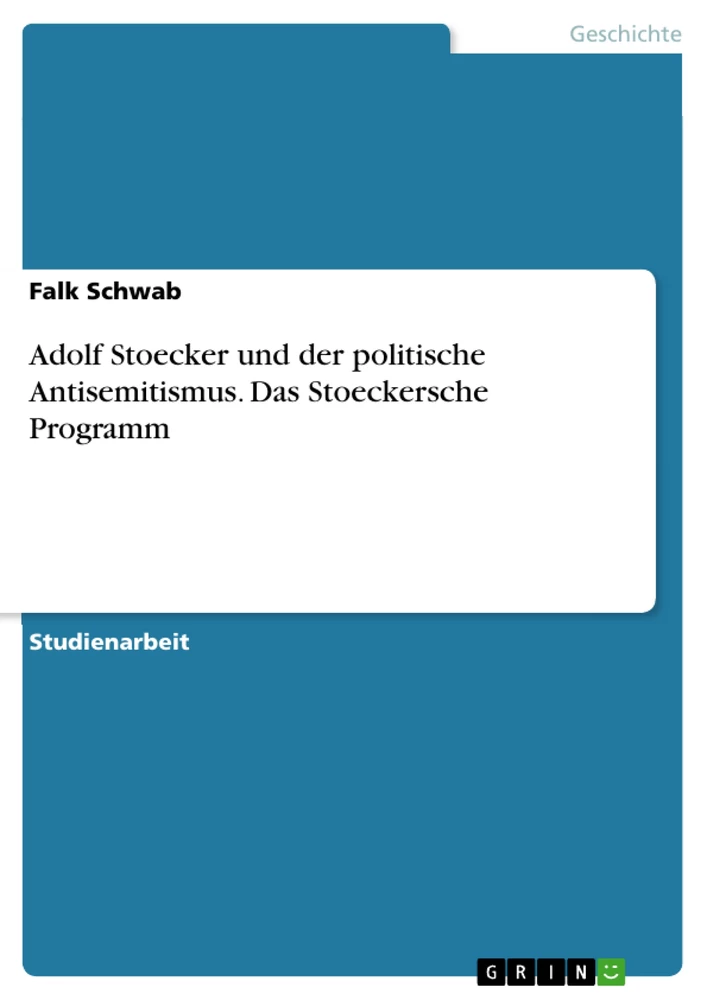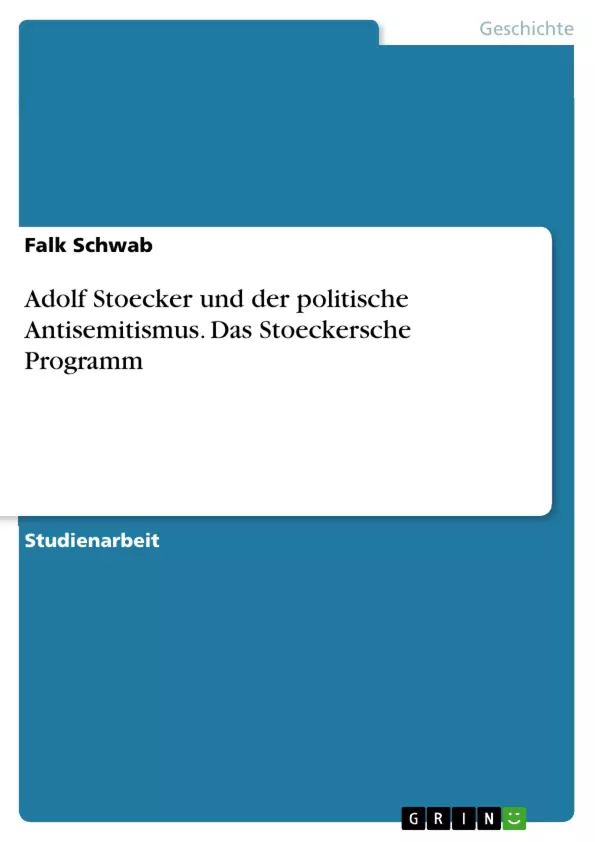Spricht man in der heutigen Zeit in Deutschland von Antisemitismus, so denkt man sofort an die zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft, aktuelle Äußerungen von rechtsextremen Politikern oder religiösen Fanatikern. Dabei wird aber oft übersehen, dass der Antisemitismus kein spezielles Phänomen des Nationalsozialismus im Dritten Reich war, sondern seinerzeit mit dem Holocaust die schlimmsten Perversionen offenbarte. Tatsächlich ist der Judenhass fast ebenso alt wie das Judentum selbst, anfänglich wurde er von religiösen Motiven, wie etwa der Schuldzuweisung an der Kreuzigung Christi, getragen. Seit der damaligen Entstehung von verschiedenen Glaubensrichtungen zieht sich ein sogenannter Antijudaismus wie eine Konstante nicht nur durch die christliche Geschichte. Das 19. Jahrhundert brachte hierin einen Wandel hervor – der Judenhass wurde in seiner modernen Form zur Zeit des Kaiserreiches als Antisemitismus „salonfähig“ und nahm politische Züge an. Allerdings sollte man auch beachten, dass die Rechtslage der Juden bereits vor 1871 im deutschsprachigen Raum angespannt und aufgrund der seit jeher föderalen Strukturen in den deutschen Staaten sehr unterschiedlich geregelt war.
Ich beschäftige mich in dieser Arbeit mit den Voraussetzungen in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft um 1871, unter denen sich der politische Antisemitismus im Kaiserreich entwickeln konnte. Zugleich werde ich anhand des Lebenslaufes eines frühen Verfechters dieser Ideologie, Adolf Stoecker, evangelischer Theologe und Hofprediger Kaiser Wilhelms II., die Transformation des alten religiösen Antijudaismus unter Einfluss von Geistesströmungen des 19. Jahrhunderts zu der uns heute bekannten Form des rassisch-völkischen Antisemitismus aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Voraussetzungen für die Entstehung des politischen Antisemitismus
- III. Adolf Stoecker und der politische Antisemitismus
- III.1. Adolf Stoecker
- III.2. Das Stoeckersche Programm
- III.3. Weitere Antisemitenparteien
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Voraussetzungen und Entwicklung des politischen Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich. Sie untersucht, wie die Emanzipationsbewegung der Juden mit der allgemeinen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage im Kaiserreich um das Jahr 1871 interagierte, und wie sich daraus der Antisemitismus entwickelte. Der Schwerpunkt liegt auf der Person Adolf Stoeckers, einem evangelischen Theologen und Hofprediger Kaiser Wilhelms II., und der Analyse seines Programms im Kontext des antijüdischen Gedankenguts des 19. Jahrhunderts.
- Die Emanzipationsbewegung der Juden im 19. Jahrhundert
- Die Rolle von Nationalismus, Rassismus und Sozialdarwinismus im Kontext des Antisemitismus
- Die Transformation des religiösen Antijudaismus in den rassisch-völkischen Antisemitismus
- Die Bedeutung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolgs jüdischer Personen
- Die Rolle des politischen Systems und der öffentlichen Meinung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des politischen Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich ein und beleuchtet den historischen Kontext des Judenhasses.
Kapitel II analysiert die Voraussetzungen für die Entstehung des politischen Antisemitismus. Hierbei wird die jüdische Emanzipationsbewegung mit ihren Auswirkungen auf die Gesellschaftsstruktur beleuchtet, sowie die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage im Kaiserreich um 1871 betrachtet.
Kapitel III widmet sich Adolf Stoecker und seinem Programm im Rahmen des politischen Antisemitismus. Der Fokus liegt auf Stoeckers Leben und Wirken sowie der Analyse seines Programms. Zudem werden weitere Antisemitenparteien der Zeit betrachtet.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, Politischer Antisemitismus, Adolf Stoecker, Deutsches Kaiserreich, Emanzipation, Nationalismus, Rassismus, Sozialdarwinismus, Judenhass, religiöser Antijudaismus, rassisch-völkischer Antisemitismus.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Adolf Stoecker?
Adolf Stoecker (1835–1909) war ein evangelischer Theologe, Hofprediger Kaiser Wilhelms II. und ein prominenter Führer des politischen Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich.
Was war das „Stoeckersche Programm“?
Es war das Programm der Christlich-sozialen Arbeiterpartei, das soziale Reformen mit einer scharfen antisemitischen Rhetorik verband, um Arbeiter von der Sozialdemokratie fernzuhalten.
Wie unterschied sich der moderne Antisemitismus vom alten Antijudaismus?
Der alte Antijudaismus war religiös motiviert. Der moderne Antisemitismus des 19. Jahrhunderts nahm politische und rassisch-völkische Züge an, beeinflusst durch Sozialdarwinismus und Nationalismus.
Welche Rolle spielte die jüdische Emanzipation für das Aufkommen des Hasses?
Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Erfolg emanzipierter Juden wurde von vielen als Bedrohung wahrgenommen, was Antisemiten wie Stoecker instrumentalisierten, um Ängste im bürgerlichen Lager zu schüren.
Warum wurde der Antisemitismus im Kaiserreich „salonfähig“?
Durch die Gründung von Antisemitenparteien und die Verbreitung antisemitischer Schriften im Bürgertum wurde die Diskriminierung von Juden zu einem akzeptierten Teil des politischen Diskurses.
- Citation du texte
- Falk Schwab (Auteur), 2017, Adolf Stoecker und der politische Antisemitismus. Das Stoeckersche Programm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/366380