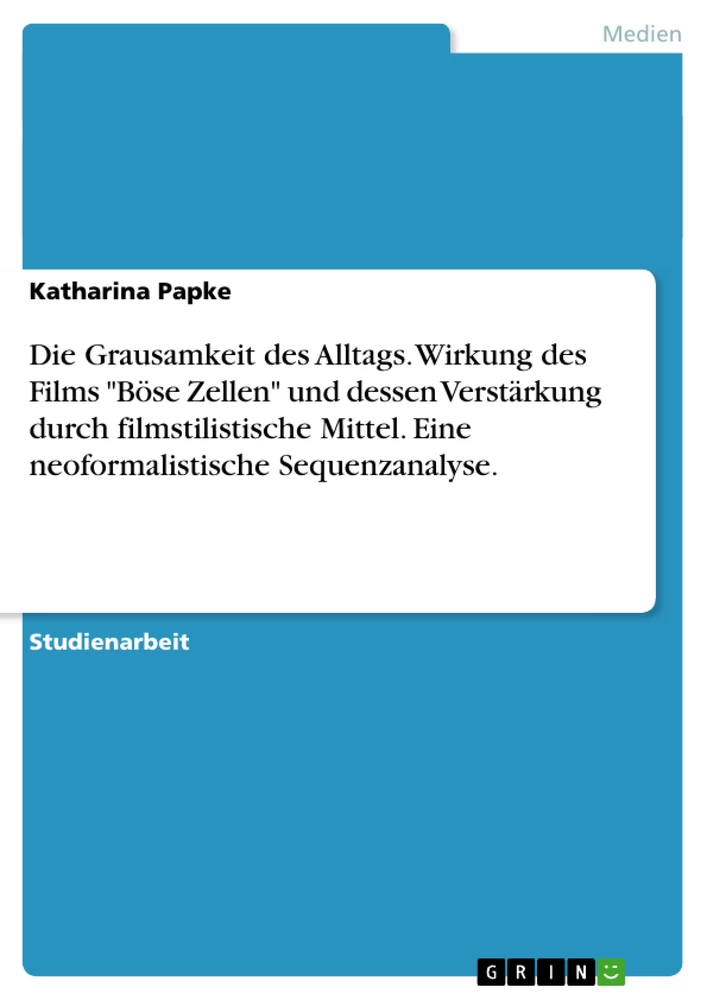Wie brutal der Alltag sein kann, der gleichzeitig doch so normal ist, bringt „Böse Zellen" von Barbara Albert zum Ausdruck. “The people in Albert´s „Free Radicals“[...] must cope with boundless grief”, schreibt Sylviane Gold und dass der Film eben düster scheint – ob er es nun ist oder nur so wahrgenommen wird bleibt bis dahin noch ungeklärt - bringt selbst diese Kritik von Erwin Heberling zum Ausdruck: „Dass der Film nicht so düster ist, wie es scheinen mag, hat viel mit der Musik zu tun, der Barbara Albert viel Raum gewährt.“ „Böse Zellen“ ist ein sehr vielschichtiger Film, der in mehreren Kritiken auch als überladen bezeichnet wurde. Zwischenmenschliche Abhängigkeiten und Einsamkeit, Chaos und Ordnung, Religion und Jenseits, Todesangst, Schuld und Verantwortung und die Suche des Glücks in der Konsumgesellschaft gehören unter anderem zu den nebeneinander existierenden, zentralen Themen des Filmes.
Doch was verwundert und erschrickt ist die Wirkung, die „Böse Zellen“ hinterlässt. Ohne den Film einer vorschnellen Wertung oder Analyse unterziehen zu wollen, wird das Gefühl bestärkt, dass die „Grausamkeit“ der Realität im Film eigentlich die wirkliche Realität darstellt. Oder wie Peter Claus formuliert: „Die verschachtelten, kargen Momentaufnahmen ganz gewöhnlichen Lebens sind von einer Klarheit, die einen frösteln lässt.“ Das dumpfe, traurige Gefühl und der Eindruck, dass Grausamkeit der wirkliche Alltag ist, mit dem viele Menschen viele Jahre ihres Lebens leben, lässt den Film zur Realität werden, auch wenn die Häufung von Schicksalsschlägen nicht immer den normalen Alltag ausmacht.
Die Hausarbeit versucht zu klären, wie diese Wirkung bei „Böse Zellen“ mit filmstilistischen Mitteln im Zusammenhang mit seiner Thematik erzeugt wird. Dabei werden die verschiedenen Aspekte und Themen des Films hauptsächlich unter diesem Gesichtspunkt betrachtet und nicht im Einzelnen untersucht. Der neoformalistische Ansatz dient dabei als Grundlage der Analyse. Zudem wird die Frage nach der Zuschauerrezeption im Zusammenhang mit dem sozialen Statutes angerissen, die Frage nach dem „typisch Österreichischen“ aufgeworfen und zu einem Fazit übergeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Leben wir nicht alle einen Film?
- 2. Neoformalismus – Entstehung und Begriffsdefinition
- 2.1 Ein Ansatz
- 2.2 Die Bedeutung des Zuschauers
- 2.3 Schlüsselkonzepte
- 3. Sequenzanalyse
- 4. Die Zuschauerfrage oder inwiefern der soziale Status eine Rolle spielt
- 5. Die Frage nach der „Austriazität“ bei Böse Zellen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Wirkung des Films „Böse Zellen“ und untersucht, wie filmstilistische Verfahren zur Verstärkung der dargestellten Grausamkeit des Alltags beitragen. Die Analyse basiert auf einem neoformalistischen Ansatz und betrachtet die Rezeption des Films im Kontext des sozialen Status des Zuschauers. Der österreichische Kontext des Films wird ebenfalls thematisiert.
- Wirkung filmstilistischer Mittel auf die Rezeption
- Neoformalistische Filmtheorie und -analyse
- Der Einfluss des sozialen Status des Zuschauers
- Die Darstellung des Alltags und seiner Grausamkeit
- Österreichischer Kontext des Films
Zusammenfassung der Kapitel
1. Leben wir nicht alle einen Film?: Dieses einleitende Kapitel stellt die These auf, dass der Film „Böse Zellen“ die oft verborgene Grausamkeit des scheinbar normalen Alltags offenbart. Es wird ein Kontrast zwischen der oberflächlichen Normalität des Alltags und der im Film dargestellten düsteren Realität hergestellt. Die Vielschichtigkeit des Films und die kritischen Reaktionen darauf werden bereits hier angedeutet, um die Notwendigkeit der folgenden Analyse zu begründen. Der Kontrast zwischen der scheinbaren Normalität des Alltags und der im Film dargestellten düsteren Realität bildet die Grundlage der gesamten Arbeit. Die Zitate von Barbara Albert und Filmkritiken verdeutlichen die kontroverse Wirkung des Films und die Komplexität seiner Themen.
2. Neoformalismus - Entstehung und Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert den neoformalistischen Ansatz, der als Grundlage der Filmanalyse dient. Es erläutert die Herkunft des Begriffs aus dem Formalismus der Literaturwissenschaft und differenziert ihn von anderen filmwissenschaftlichen Theorien. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der formalen Charakteristika des Films und der Analyse der Verarbeitungsprozesse des Rezipienten. Die Definition von Bordwell und Thompson als Ausgangspunkt der Analyse wird vorgestellt, und der kognitivistische Ansatz von Bordwell wird im Gegensatz zu psychoanalytischen Ansätzen positioniert.
Schlüsselwörter
Böse Zellen, Barbara Albert, Neoformalismus, Sequenzanalyse, Filmstilistik, Zuschauerrezeption, sozialer Status, Grausamkeit des Alltags, österreichischer Film, Realität, Filmtheorie.
Häufig gestellte Fragen zu „Böse Zellen“: Eine neoformalistische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert den Film „Böse Zellen“ von Barbara Albert unter Verwendung eines neoformalistischen Ansatzes. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, wie filmstilistische Mittel die dargestellte Grausamkeit des Alltags verstärken und wie die Rezeption des Films vom sozialen Status des Zuschauers beeinflusst wird. Der österreichische Kontext des Films wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Methode wird angewendet?
Die Analyse basiert auf dem Neoformalismus, einer filmwissenschaftlichen Theorie, die die formalen Eigenschaften eines Films und die kognitiven Prozesse des Zuschauers untersucht. Die Arbeit unterscheidet sich von psychoanalytischen Ansätzen und orientiert sich an Bordwell und Thompson.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Wirkung filmstilistischer Mittel auf die Rezeption, neoformalistische Filmtheorie und -analyse, den Einfluss des sozialen Status des Zuschauers auf die Rezeption, die Darstellung der Grausamkeit des Alltags im Film und den österreichischen Kontext des Films „Böse Zellen“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Leben wir nicht alle einen Film?), Definition des Neoformalismus, Sequenzanalyse, die Rolle des sozialen Status des Zuschauers, die „Austriazität“ in „Böse Zellen“ und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Was ist die zentrale These der Einleitung?
Die Einleitung stellt die These auf, dass „Böse Zellen“ die oft verborgene Grausamkeit des scheinbar normalen Alltags offenbart und einen Kontrast zwischen oberflächlicher Normalität und düsterer Realität herstellt. Die kontroversen Reaktionen auf den Film werden als Begründung für die Analyse angeführt.
Wie wird der Neoformalismus definiert?
Kapitel 2 definiert den neoformalistischen Ansatz, seine Ursprünge im Literaturformalismus und seine Abgrenzung von anderen filmwissenschaftlichen Theorien. Der Fokus liegt auf der Analyse der formalen Charakteristika des Films und den Verarbeitungsprozessen des Rezipienten, wobei der kognitivistische Ansatz von Bordwell im Vordergrund steht.
Welche Rolle spielt der soziale Status des Zuschauers?
Die Arbeit untersucht, inwiefern der soziale Status des Zuschauers die Rezeption von „Böse Zellen“ beeinflusst. Dies ist ein zentraler Aspekt der neoformalistischen Analyse.
Wie wird der österreichische Kontext berücksichtigt?
Die Arbeit thematisiert den österreichischen Kontext des Films „Böse Zellen“ und untersucht dessen Bedeutung für die Darstellung und die Interpretation des dargestellten Alltags und seiner Grausamkeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Böse Zellen, Barbara Albert, Neoformalismus, Sequenzanalyse, Filmstilistik, Zuschauerrezeption, sozialer Status, Grausamkeit des Alltags, österreichischer Film, Realität, Filmtheorie.
- Quote paper
- Katharina Papke (Author), 2004, Die Grausamkeit des Alltags. Wirkung des Films "Böse Zellen" und dessen Verstärkung durch filmstilistische Mittel. Eine neoformalistische Sequenzanalyse., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36504