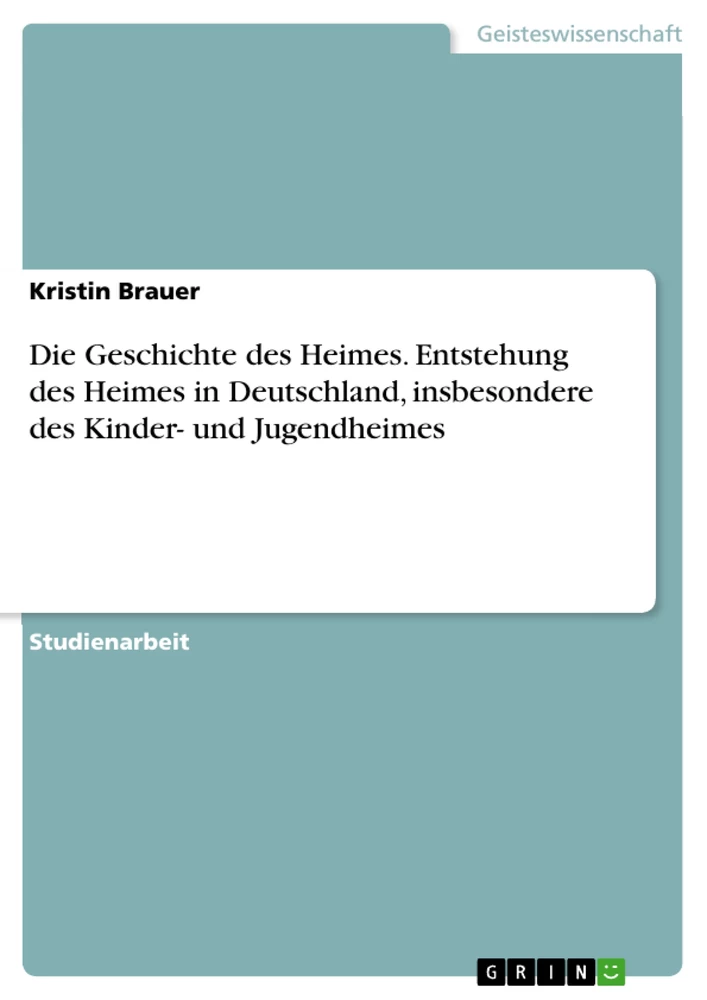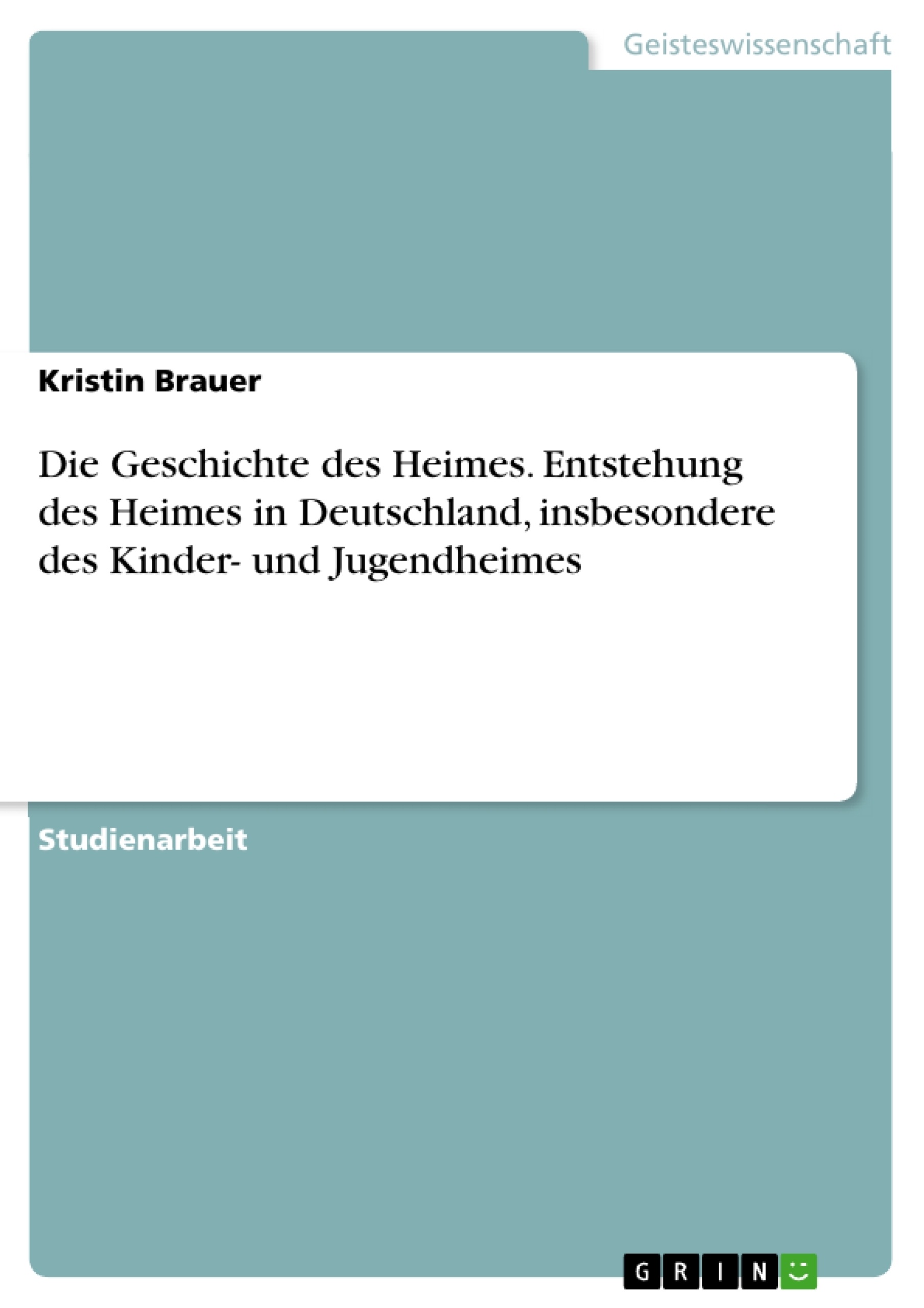Wozu gibt es Familien? Familien sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Immer anders, immer in Bewegung. Mit dem Begriff „Familie“ wird ein Ort bezeichnet für gelebte Beziehungen. Ehepaare die ein Kind erwarten; Alleinerziehende, Eltern, die mit ihren Kindern zusammenleben; Alleinerziehende, deren Kinder den elterlichen Haushalt verlassen haben und so weiter. Also ein Leben in vielen verschiedenen Formen der Familie. Einerseits wird die Familie von den meisten Menschen als die wichtigste Gemeinschaft bezeichnet und andererseits wird viel von der Krise der Familie geredet und geschrieben.
Deutliche Zeichen für die Veränderungen in der Gesellschaft sind in den letzten Jahren die immer weiter steigende Zahl der Ehescheidungen, der Singles, der Alleinerziehenden, aber auch der Rückgang der Kinderzahl. Dies alles betrifft die Familie.
Also, was tun, wenn Eltern mit den Anforderungen nicht mehr fertig werden? Wenn Partnerschafts- und Erziehungsprobleme, die berufliche Belastung, der Geldmangel, aber auch die Arbeitslosigkeit, Probleme die immer häufiger in unserer Gesellschaft auftreten, sich negativ auf das Familienleben auswirken.
Der Weg in eine familienersetzende Einrichtung kann jedes Kind oder Jugendlichen betreffen. Früher, wie auch heute.
Dahingehend möchte ich nun im Folgenden unter anderem die Entwicklung des Kinderheims in Deutschland, mit Hinsicht auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die vielfältigen, und sich veränderten Einweisungsgründe der Betroffenen aber auch die sich verändernden pädagogischen Aufgaben näher erläutern und beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Die verschiedenen Ursprünge des heutigen Heimes
- 2.1 Fürsorgeerziehung in der vorkapitalistischen Zeit
- 2.1.1 Der Ursprung der Heimerziehung
- 2.1.2 Die Waisenhäuser und Bewahrungsanstalten
- 2.1.3 Die Aufgaben der Findel und Waisenhäuser
- 2.2 Die Arbeits- und Zuchthäuser
- 2.2.1 Geschichtlicher Hintergrund.
- 2.2.2 Die Entstehung...
- 2.2.3 Woraus bestanden diese Arbeits- und Zuchthäuser?
- 2.3 Das Jugendgerichtswesen
- 2.3.1 Die Entwicklung...
- 2.3.2 Die Aufgaben
- 2.3.3 Warum wurde das Jugendgerichtswesen eingeführt?.
- 2.3.4 Wer kommt in solch eine Anstalt?
- 3. Die Einflüsse des Pietismus auf die Sozialpädagogik
- 3.1 Erziehung in den Waisenhäusern
- 4. Die Entwicklung der privatorganisierten Anstaltserziehung im 19. Jhd.
- 4.1 Die Erziehung.
- 4.2 Ein Begründer
- 4.3 Pädagogische Prinzipien
- 5. Heimerziehung nach 1945
- 5.1 Geschichtlicher Hintergrund.
- 5.2 Woraus bestanden die Heime?
- 5.3 Reformen dieser Zeit
- 6. Die Wende der Sozialpädagogik
- 6.1 Der Ausbau des Pflegekinderwesens
- 6.2 Die Heimkritik in den 80er Jahren
- 6.3 Heime in den 80er Jahren
- 7. Heimerziehung heute.
- 7.1 Was ist heutzutage ein Heimkind, und woher kommen diese?..
- 7.2 Tendenzen in der heutigen Heimerziehung..
- 7.3 Die heutigen Aufgaben in der Heimerziehung..
- 7.4 Neue Formen der Heimerziehung.
- 7.4.1 Aussenwohngruppen
- 7.4.2 Wohngruppen und Wohngemeinschaften.
- 7.4.3 Tagesgruppen.
- 7.4.4 Betreutes Wohnen
- 7.4.5 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung.
- 8. Der heutige Erzieher
- 8.1 Anforderungen an den Erzieher
- 8.2 Funktionsbereiche des Erziehers
- 8.3 Aufgaben des Erziehers im Heim
- 9. Rechtliche Voraussetzungen
- 10. Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Geschichte des Heimes in Deutschland, insbesondere die Entstehung und Entwicklung des Kinder- und Jugendheimes. Ziel ist es, die verschiedenen Ursprünge der Heimerziehung aufzuzeigen und ihren Einfluss auf die heutige Situation zu beleuchten. Zudem werden die gesellschaftlichen Veränderungen und die sich verändernden Einweisungsgründe für Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen betrachtet.
- Die Entwicklung der Heimerziehung von den Anfängen bis zur Gegenwart.
- Die verschiedenen Ursprünge der Heimerziehung (Waisenhäuser, Arbeits- und Zuchthäuser, Jugendgerichtswesen).
- Die Rolle gesellschaftlicher Veränderungen und die Einweisungsgründe für Heimerziehung.
- Die pädagogischen Aufgaben und Konzepte der Heimerziehung im Laufe der Zeit.
- Aktuelle Tendenzen und Herausforderungen in der Heimerziehung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Problematik der Familie in unserer Gesellschaft und die Notwendigkeit familienersetzender Einrichtungen. Kapitel 2 beleuchtet die Ursprünge der Heimerziehung in der vorkapitalistischen Zeit, mit Fokus auf die Waisenhäuser und Bewahrungsanstalten, die Arbeits- und Zuchthäuser, und die Entstehung des Jugendgerichtswesens. In Kapitel 3 werden die Einflüsse des Pietismus auf die Sozialpädagogik dargestellt, insbesondere die Erziehung in den Waisenhäusern. Kapitel 4 widmet sich der Entwicklung der privatorganisierten Anstaltserziehung im 19. Jahrhundert, einschließlich der pädagogischen Prinzipien. Kapitel 5 fokussiert auf die Heimerziehung nach 1945, mit Einblicken in die geschichtlichen Hintergründe und die Reformen dieser Zeit. Die Wende der Sozialpädagogik im 20. Jahrhundert, einschließlich des Ausbaus des Pflegekinderwesens, der Heimkritik und der Veränderungen der Heime in den 1980er Jahren, wird in Kapitel 6 behandelt. Kapitel 7 bietet einen Einblick in die Heimerziehung heute, einschließlich der aktuellen Aufgaben, der neuen Formen der Heimerziehung und der Herausforderungen dieser Zeit.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beleuchtet wichtige Themen wie Heimerziehung, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Fürsorgeerziehung, Waisenhäuser, Arbeits- und Zuchthäuser, Jugendgerichtswesen, Pietismus, Sozialpädagogik, gesellschaftliche Veränderungen, Einweisungsgründe, pädagogische Konzepte, aktuelle Tendenzen, Herausforderungen, Familienersatz, Pflegekinderwesen, Heimkritik, neue Formen der Heimerziehung.
- Citation du texte
- Kristin Brauer (Auteur), 2002, Die Geschichte des Heimes. Entstehung des Heimes in Deutschland, insbesondere des Kinder- und Jugendheimes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36062