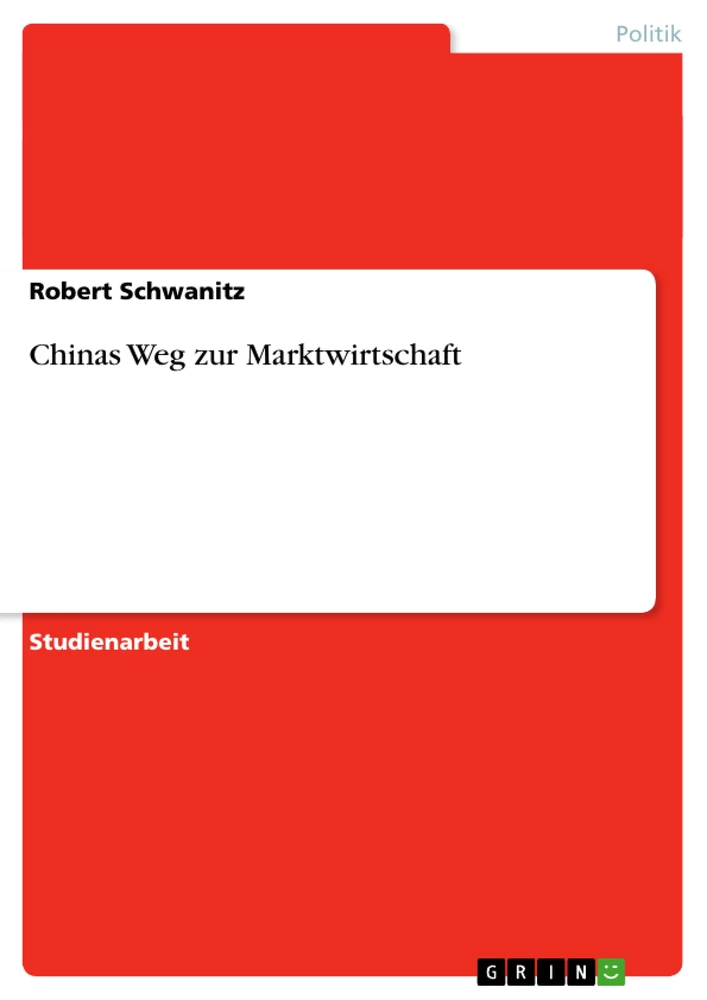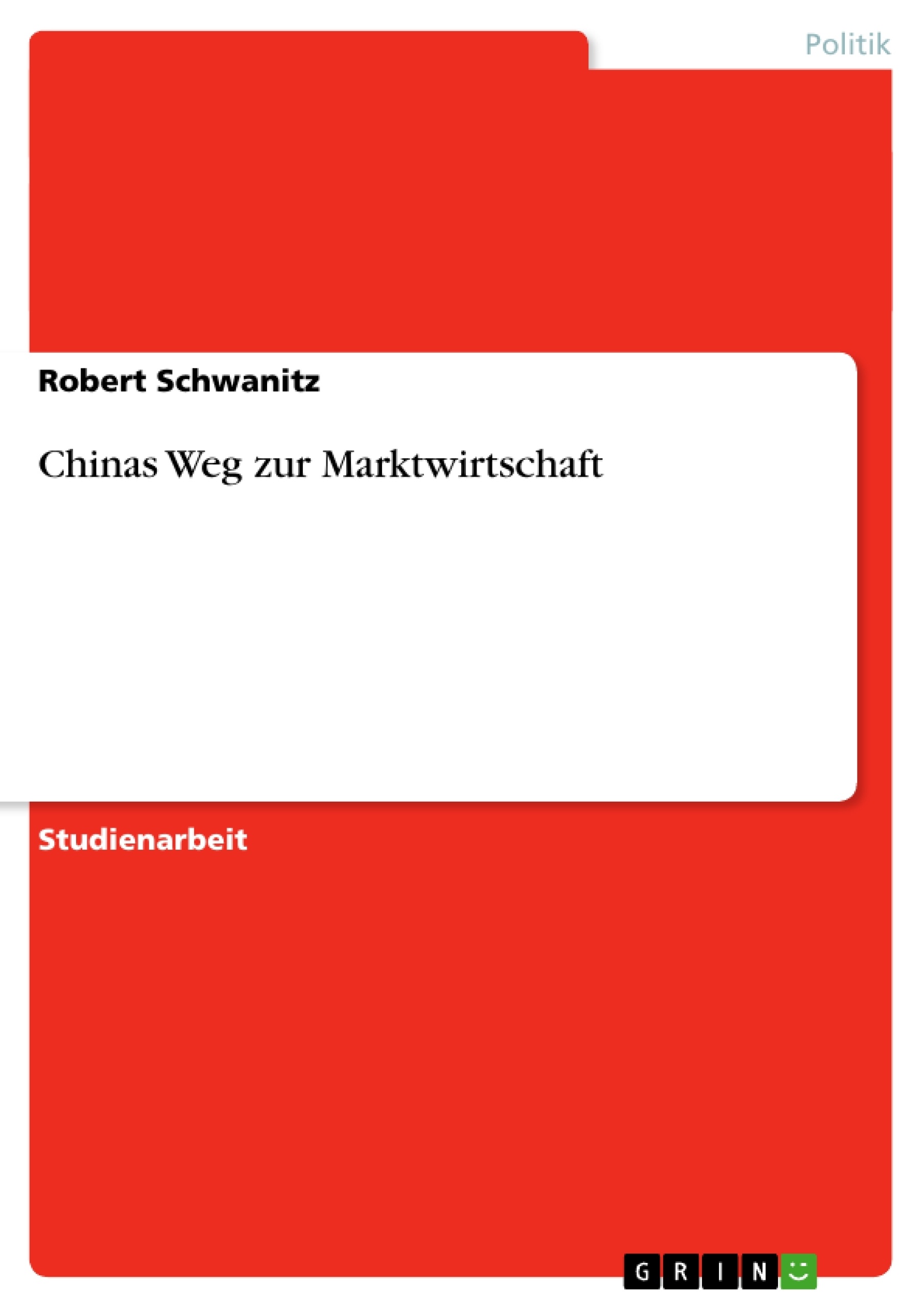1,28 Mrd. Menschen und eine Fläche von 9.597.995 Quadratkilometern, das ist China in statistischen Dimensionen ausgedrückt. Zum Vergleich: Deutschland hat eine Fläche von ca. 357.000 Quadratkilometern und eine Einwohnerzahl von ca. 82 Mill. Menschen. Allein diese Zahlen machen schon deutlich welch ein Gigant China ist, und dennoch gehörte das Land über lange Zeit zu den wirtschaftlichen Entwicklungsländern. Dies hat sich grundlegend geändert. China ist auf dem besten Wege auch wirtschaftlich ein Gigant zu werden. Mit einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 8% in den letzten 5 Jahren nimmt es die Spitzenposition unter den Industrieländern ein. China ist durch sein reichhaltiges Angebot an billigen Arbeitskräften mittlerweile zur Werkbank der Welt geworden. Jede zweite Digitalkamera, jedes dritte Handy und jede vierte Waschmaschine kommen aus China. 80% aller DVD Spieler, 70% aller Spielwaren und 50% aller Schuhe werden in China produziert. 2003 flossen ca. 53 Mrd. $ an Direktinvestitionen in die chinesische Wirtschaft. Im Verbrauch von Stahl, Kohle und Zement belegt China weltweit Platz 1. Im Erdölverbrauch rangiert nur noch die USA vor dem „Reich der Mitte“.
Wie aber kam es zu dieser Entwicklung, und wo nahm diese ihren Ursprung? Diese Arbeit soll den Prozess der Hinwendung Chinas zu mehr Marktwirtschaft und weg von der Planwirtschaft seit 1949 nachzeichnen. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, und was waren die Auslöser für diese Schritte? Zum besseren Verständnis wird dieser Prozess zumindest ansatzweise in seinen historischen Hintergrund eingebettet. Als Einführung werden die beiden Systeme der Plan- und Verkehrswirtschaft im folgenden Kapitel 2 vorgestellt und erläutert. Des Weiteren soll untersucht werden, inwiefern es China gelungen ist, planwirtschaftliche und marktwirtschaftliche Elemente zu vereinen, und welche Schwierigkeiten sich daraus ergeben haben. Kann China den Spagat zwischen Kommunismus und Marktwirtschaft tatsächlich auf Dauer aufrechterhalten? Dieser Aspekt soll in einem abschließenden Fazit näher beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zwei Systeme: Plan- und Verkehrswirtschaft
- 2.1 Planwirtschaft
- 2.2 Verkehrswirtschaft
- 2.2.1 Konstituierende Prinzipien
- 2.2.2 Regulierende Prinzipien
- 3. China: Planwirtschaftliche Phase
- 3.1 Probleme der Planwirtschaft in China
- 4. China: Marktwirtschaftliche Reformen
- 4.1 Die Idee der Sonderwirtschaftszonen
- 4.2 Kritik der Reformen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, den Übergang Chinas von einer Plan- zu einer stärker marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsordnung seit 1949 nachzuzeichnen. Es werden die eingeleiteten Maßnahmen und deren Ursachen untersucht. Der Prozess wird in seinen historischen Kontext eingebettet. Die Arbeit analysiert zudem das Zusammenspiel von planwirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Elementen in China und die daraus resultierenden Schwierigkeiten.
- Entwicklung der chinesischen Wirtschaftsordnung seit 1949
- Vergleich von Plan- und Marktwirtschaft
- Einführung und Auswirkungen marktwirtschaftlicher Reformen in China
- Herausforderungen der Verbindung von Kommunismus und Marktwirtschaft
- Analyse der Sonderwirtschaftszonen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert China als wirtschaftlichen Giganten mit beeindruckendem Wachstum, im Gegensatz zu seiner früheren Rolle als Entwicklungsland. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen dieser Entwicklung und kündigt die Analyse der chinesischen Wirtschaftsordnung an, indem sie die beiden grundlegenden Wirtschaftsordnungen, Plan- und Marktwirtschaft, einführt und deren Zusammenhang mit politischen Systemen erläutert. Der Fokus liegt auf dem Prozess der Hinwendung Chinas zur Marktwirtschaft und der Untersuchung der dabei ergriffenen Maßnahmen und deren Auslöser.
2. Zwei Systeme: Plan- und Verkehrswirtschaft: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Plan- und Marktwirtschaft. Die Planwirtschaft wird charakterisiert durch einen zentralen Wirtschaftsplan, staatliches Eigentum an Produktionsmitteln und die Notwendigkeit einer umfangreichen Bürokratie. Die Vorteile der Planwirtschaft werden im Kontext der marxistisch-leninistischen Ideologie erläutert, z.B. die Vermeidung von Ausbeutung und die Möglichkeit der langfristigen Planung. Allerdings werden auch die Nachteile, wie Ineffizienz, mangelnde Anpassungsfähigkeit und fehlende Innovationskraft, hervorgehoben, wobei Beispiele aus der Geschichte der ehemaligen DDR und der Sowjetunion angeführt werden.
3. China: Planwirtschaftliche Phase: Dieses Kapitel würde die Implementierung der Planwirtschaft in China nach der Gründung der Volksrepublik 1949 detailliert beschreiben. Der Fokus läge auf den spezifischen Herausforderungen und Problemen, die sich bei der Anwendung des sowjetischen Modells in der chinesischen Realität ergaben. Die Zusammenfassung würde die Schwierigkeiten bei der Planung und Umsetzung des wirtschaftlichen Gesamtplans analysieren und die daraus resultierenden ökonomischen und sozialen Folgen beleuchten. Es würde wahrscheinlich auch die Rolle von Mao Zedongs Politik und deren Einfluss auf die Wirtschaft behandelt werden.
4. China: Marktwirtschaftliche Reformen: Dieses Kapitel würde die Einführung marktwirtschaftlicher Reformen in China untersuchen. Es würde die Strategien und Maßnahmen Chinas zur Liberalisierung seiner Wirtschaft analysieren, wie z.B. die Einführung von Sonderwirtschaftszonen und die schrittweise Privatisierung von Unternehmen. Die Zusammenfassung würde die positiven und negativen Aspekte dieser Reformen bewerten, einschließlich der Herausforderungen und Widerstände bei ihrer Umsetzung, sowie die damit verbundenen sozialen und politischen Folgen. Die kritischen Stimmen und deren Argumente wären ebenfalls Teil der Zusammenfassung.
Schlüsselwörter
Planwirtschaft, Marktwirtschaft, China, Wirtschaftsreformen, Sonderwirtschaftszonen, Marxismus-Leninismus, Wirtschaftswachstum, Sozialismus, Kommunismus, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Chinas Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Übergang Chinas von einer Plan- zu einer marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsordnung seit 1949. Sie untersucht die eingeleiteten Maßnahmen, deren Ursachen und den historischen Kontext. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenspiel von planwirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Elementen und den daraus resultierenden Schwierigkeiten.
Welche Wirtschaftsordnungen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Planwirtschaft mit der Marktwirtschaft. Dabei werden die Charakteristika beider Systeme, ihre Vorteile und Nachteile, sowie ihre jeweiligen Zusammenhänge mit politischen Systemen erläutert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Zwei Systeme: Plan- und Marktwirtschaft, China: Planwirtschaftliche Phase, China: Marktwirtschaftliche Reformen und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Übergangs Chinas von der Plan- zur Marktwirtschaft.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt Chinas beeindruckendes Wirtschaftswachstum im Gegensatz zu seiner früheren Rolle als Entwicklungsland dar. Sie formuliert die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen dieser Entwicklung und kündigt die Analyse der chinesischen Wirtschaftsordnung an, wobei Plan- und Marktwirtschaft eingeführt und deren Zusammenhang mit politischen Systemen erläutert wird. Der Fokus liegt auf Chinas Hinwendung zur Marktwirtschaft und der Untersuchung der dabei ergriffenen Maßnahmen und deren Auslöser.
Wie wird die Planwirtschaft beschrieben?
Die Planwirtschaft wird charakterisiert durch einen zentralen Wirtschaftsplan, staatliches Eigentum an Produktionsmitteln und die Notwendigkeit einer umfangreichen Bürokratie. Ihre Vorteile (Vermeidung von Ausbeutung, langfristige Planung) werden im Kontext der marxistisch-leninistischen Ideologie erläutert, aber auch ihre Nachteile (Ineffizienz, mangelnde Anpassungsfähigkeit, fehlende Innovationskraft) werden mit historischen Beispielen (DDR, Sowjetunion) hervorgehoben.
Was wird in Kapitel 3 ("China: Planwirtschaftliche Phase") behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Implementierung der Planwirtschaft in China nach 1949. Es analysiert die Herausforderungen und Probleme bei der Anwendung des sowjetischen Modells in der chinesischen Realität, die Schwierigkeiten bei der Planung und Umsetzung des wirtschaftlichen Gesamtplans und die daraus resultierenden ökonomischen und sozialen Folgen. Die Rolle von Mao Zedongs Politik und deren Einfluss auf die Wirtschaft wird ebenfalls behandelt.
Was sind die zentralen Themen von Kapitel 4 ("China: Marktwirtschaftliche Reformen")?
Kapitel 4 untersucht die Einführung marktwirtschaftlicher Reformen in China, analysiert Strategien und Maßnahmen zur Liberalisierung (z.B. Sonderwirtschaftszonen, schrittweise Privatisierung) und bewertet die positiven und negativen Aspekte dieser Reformen. Es werden Herausforderungen, Widerstände, soziale und politische Folgen sowie kritische Stimmen und deren Argumente behandelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Planwirtschaft, Marktwirtschaft, China, Wirtschaftsreformen, Sonderwirtschaftszonen, Marxismus-Leninismus, Wirtschaftswachstum, Sozialismus, Kommunismus, Globalisierung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Übergang Chinas von der Plan- zur Marktwirtschaft nachzuzeichnen, die eingeleiteten Maßnahmen und deren Ursachen zu untersuchen und den Prozess in seinen historischen Kontext einzubetten. Sie analysiert das Zusammenspiel von Plan- und Marktwirtschaft und die daraus resultierenden Schwierigkeiten.
Wie werden die Sonderwirtschaftszonen behandelt?
Die Sonderwirtschaftszonen werden als eine der zentralen Strategien zur Liberalisierung der chinesischen Wirtschaft im Kapitel über die marktwirtschaftlichen Reformen analysiert. Ihre Einführung, Auswirkungen und die damit verbundenen Herausforderungen werden untersucht.
- Quote paper
- Robert Schwanitz (Author), 2005, Chinas Weg zur Marktwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36045