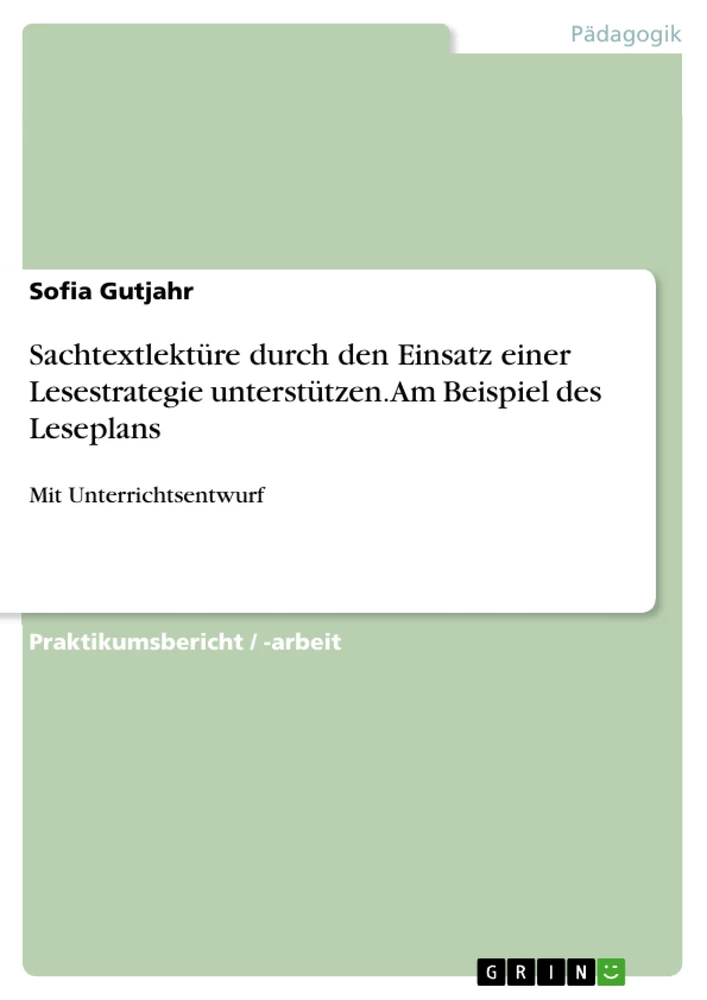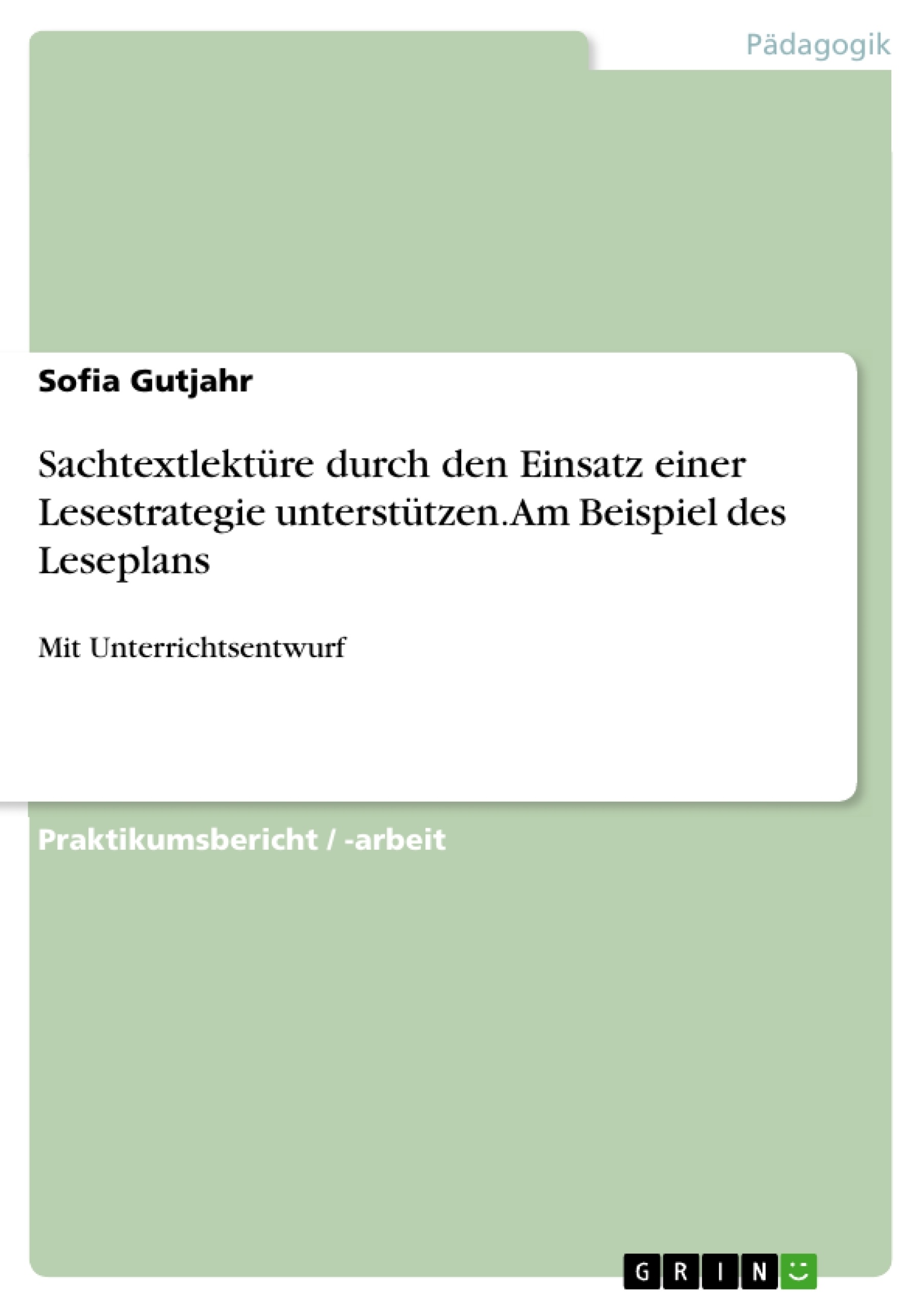Dass verschiedene Sachtexte bzw. Sachtextsorten sowie Lesestrategien schon längst den Einzug in den Deutschunterricht gefunden haben, konnte ich während meines Unterrichtspraktikums am eigenen Leibe erfahren. Meine Aufgabe bestand nämlich darin, in einer sechsstündigen Unterrichtssequenz eine Lesestrategie namens Leseplan anhand verschiedener Sachtexte einzuführen. Der Leseplan ist eine Lesestrategie, die im Rahmen eines Schulprojektes und in Anlehnung an Heinz Klipperts (1994) „Fünf-Schritte-Lesemethode“ gemeinsam mit den Schülern entwickelt worden ist.
Der Leseplan besteht im Gegenzug zu der „Fünf-Schritte Lesemethode“ nur aus drei Schritten, die wiederum in weitere Unterschritte unterteilt sind. Jeder der drei Schritte bezieht sich auf jeweils einen Aspekt der Textarbeit: Der erste Schritt bereitet die Schüler auf die Textarbeit vor. Der zweite Schritt strukturiert die Arbeit am Text. Der dritte Schritt fasst die Ergebnisse der Textarbeit zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Kategorien, Inhalte und Strukturen von Sachtexten
- 1.1 Kategorien von Sachtexten
- 1.2 Fachspezifik der Inhalte und Strukturen
- 1.2.1 Vorwissensstrukturen
- 1.2.2 Superstrukturen
- 2. Spezifik des Einsatzes einer Lesestrategie
- 2.1 Was versteht man unter Lesestrategie?
- 2.1.1 Bestimmungsversuch
- 2.1.2 Lesestrategie vs. Lesetechnik
- 2.2 Einsatzmöglichkeiten von Lesestrategien
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Vermittlung von Lesestrategien im Kontext der Sachtextlektüre im Deutschunterricht. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten, die sich aus der Vielfalt an Sachtexttypen und Lesestrategien ergeben, und sensibilisiert den Leser für mögliche Probleme bei der Unterrichtsplanung. Das Ziel ist nicht die Definition allgemeingültiger Begriffe, sondern die Aufdeckung von Problemen und die Vorstellung existierender didaktischer Konzepte.
- Kategorisierung von Sachtexten und ihre didaktische Relevanz
- Der Einfluss domänenspezifischen Vorwissens auf die Sachtextlektüre
- Unterscheidung zwischen Lesestrategie und Lesetechnik
- Einsatzmöglichkeiten von Lesestrategien im Unterricht
- Analyse des Leseplans als Beispiel einer Lesestrategie
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lesekompetenz und ihrer Bedeutung im Deutschunterricht ein. Sie beschreibt den Kontext des Autors, der eine Lesestrategie ("Leseplan") in einer Unterrichtssequenz einführte und dabei auf die Komplexität der Begriffe "Sachtext" und "Lesestrategie" stieß. Die Arbeit soll nicht definitive Definitionen liefern, sondern auf die Probleme bei der Anwendung von Lesestrategien zur Unterstützung der Sachtextlektüre hinweisen und bereits vorhandene Lösungen aufzeigen. Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert: der erste Teil behandelt die Kategorisierung und die Fachspezifik von Sachtexten, der zweite Teil die Spezifik des Einsatzes von Lesestrategien.
1. Kategorien, Inhalte und Strukturen von Sachtexten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Vielfalt an Sachtexten und den Herausforderungen ihrer Kategorisierung. Es betont die Bedeutung der Sachanalyse für die Unterrichtsplanung und die Notwendigkeit, den didaktischen Schwerpunkt bewusst zu setzen. Die Kategorisierung von Sachtexten nach ihrer Funktion (informierend, persuasiv, regulativ) wird diskutiert, wobei unterschiedliche Ansätze verglichen werden. Der Autor argumentiert für eine Vereinfachung der Kategorisierung und konzentriert sich in seinen weiteren Ausführungen auf informierende Sachtexte. Die Bedeutung des domänenspezifischen Vorwissens des Lesers und die strukturelle Vielfalt von Sachtextmustern werden als wichtige Aspekte für die Leseförderung hervorgehoben.
2. Spezifik des Einsatzes einer Lesestrategie: Das Kapitel widmet sich der Definition und Abgrenzung von Lesestrategie und Lesetechnik. Es analysiert die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Lesestrategien auf der Ebene der Sachtextlektüre. Die Ausführungen konzentrieren sich auf die Differenzierung beider Begriffe, die für die Diskussion der Einsatzmöglichkeiten von entscheidender Bedeutung ist. Der Fokus liegt auf dem zweiten Schritt des Leseplans, der die unmittelbare Arbeit mit dem Text während des Leseprozesses beschreibt.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, Sachtexte, Lesestrategie, Lesetechnik, Sachtextanalyse, Unterrichtsplanung, Deutschdidaktik, domänenspezifisches Vorwissen, Textstruktur, Leseplan, Informationsentnahme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vermittlung von Lesestrategien im Kontext der Sachtextlektüre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Vermittlung von Lesestrategien im Deutschunterricht, insbesondere im Kontext der Sachtextlektüre. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten, die sich aus der Vielfalt an Sachtexttypen und Lesestrategien ergeben, und sensibilisiert den Leser für mögliche Probleme bei der Unterrichtsplanung. Das Ziel ist nicht die Definition allgemeingültiger Begriffe, sondern die Aufdeckung von Problemen und die Vorstellung existierender didaktischer Konzepte.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kategorisierung von Sachtexten und deren didaktische Relevanz, den Einfluss von Vorwissen auf die Sachtextlektüre, die Unterscheidung zwischen Lesestrategie und Lesetechnik, Einsatzmöglichkeiten von Lesestrategien im Unterricht und die Analyse eines konkreten Beispiels einer Lesestrategie (der "Leseplan").
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, zwei Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 1 befasst sich mit Kategorien, Inhalten und Strukturen von Sachtexten, einschließlich der Kategorisierung von Sachtexten nach ihrer Funktion und der Bedeutung von Vorwissen. Kapitel 2 widmet sich der Spezifik des Einsatzes von Lesestrategien, insbesondere der Unterscheidung zwischen Lesestrategie und Lesetechnik und der Analyse des "Leseplans".
Welche Arten von Sachtexten werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich primär auf informierende Sachtexte, obwohl die Herausforderungen der Kategorisierung von Sachtexten allgemein (informierend, persuasiv, regulativ) diskutiert werden. Die Arbeit argumentiert für eine vereinfachte Kategorisierung im didaktischen Kontext.
Was ist der Unterschied zwischen Lesestrategie und Lesetechnik?
Die Arbeit betont die Unterscheidung zwischen Lesestrategie und Lesetechnik als entscheidend für den effektiven Einsatz von Lesestrategien. Während der genaue Unterschied detailliert im Text erläutert wird, wird die Bedeutung dieser Unterscheidung für die Unterrichtsplanung hervorgehoben.
Welches Beispiel für eine Lesestrategie wird analysiert?
Die Arbeit analysiert den "Leseplan" als Beispiel einer Lesestrategie, wobei der Fokus auf dem zweiten Schritt liegt, der die unmittelbare Arbeit mit dem Text während des Leseprozesses beschreibt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lesekompetenz, Sachtexte, Lesestrategie, Lesetechnik, Sachtextanalyse, Unterrichtsplanung, Deutschdidaktik, domänenspezifisches Vorwissen, Textstruktur, Leseplan, Informationsentnahme.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Vermittlung von Lesestrategien im Kontext der Sachtextlektüre komplex ist und diverse Herausforderungen mit sich bringt. Die Arbeit weist auf diese Probleme hin und zeigt existierende didaktische Konzepte auf, ohne jedoch allgemeingültige Definitionen zu liefern.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Deutschlehrer, Deutschdidaktiker, und alle, die sich mit der Förderung der Lesekompetenz und dem Unterricht von Sachtexten beschäftigen.
- Quote paper
- Sofia Gutjahr (Author), 2016, Sachtextlektüre durch den Einsatz einer Lesestrategie unterstützen. Am Beispiel des Leseplans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/359072