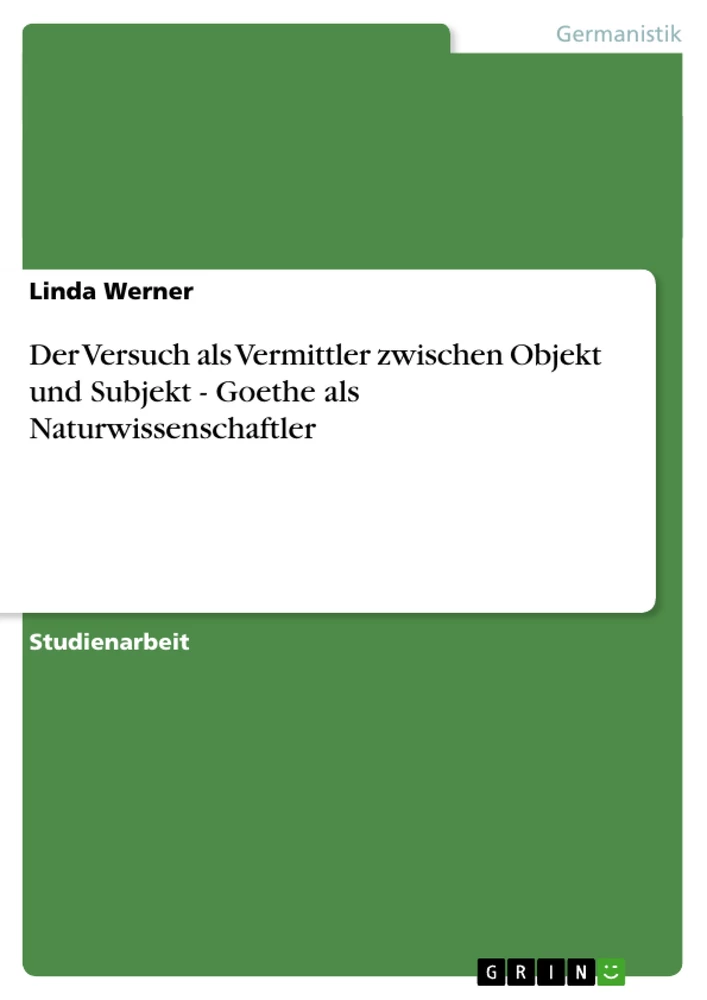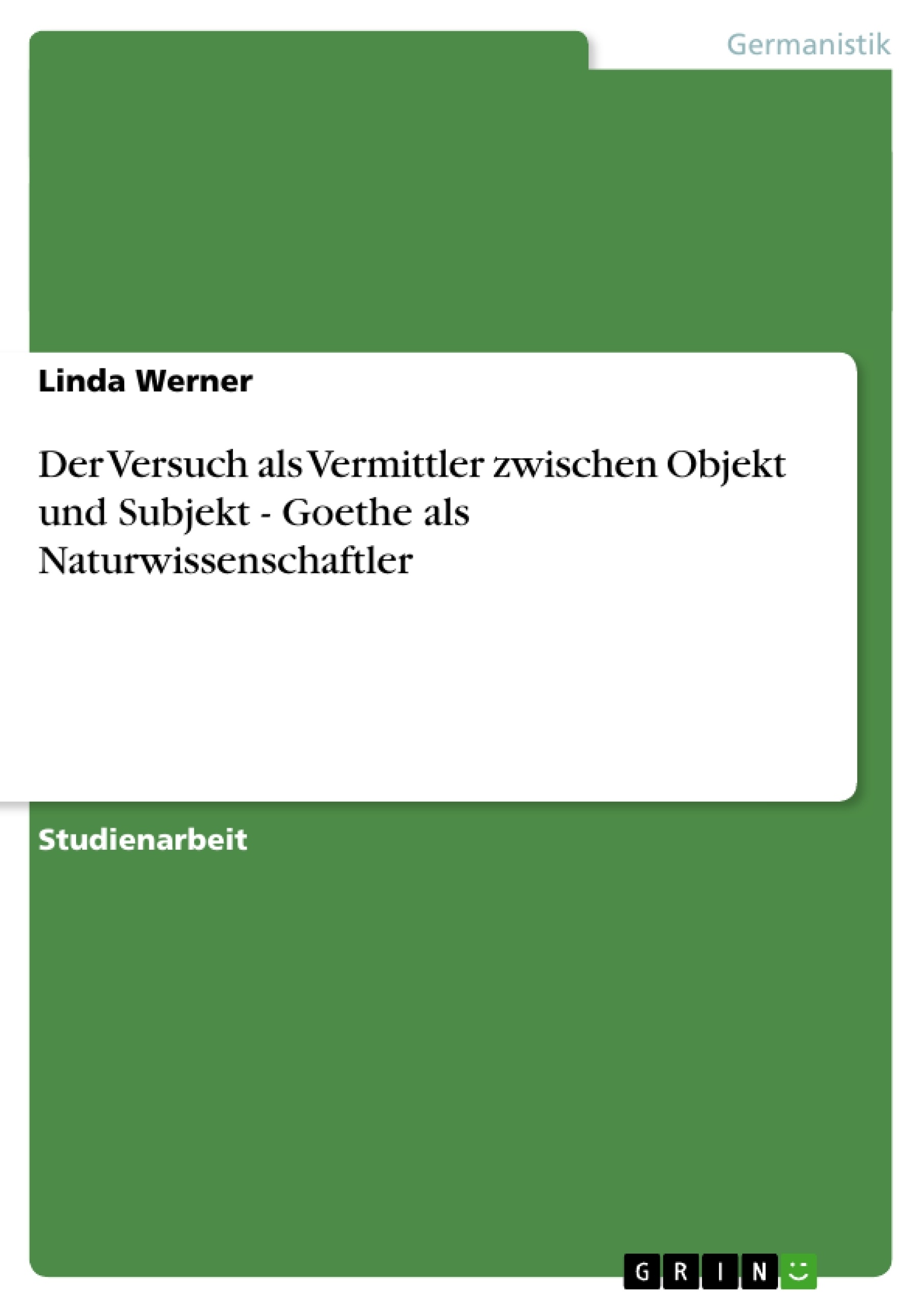Einleitung
Das zu betrachtende Untersuchungsobjekt - der kleine Aufsatz Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt stammt aus dem Frühjahr 1792. Erstmalig wurde er 1793 in der Zeitschrift Zur Naturwissenschaft überhaupt gedruckt. Man kann möglicherweise davon ausgehen, dass Goethe diesen Aufsatz als Einleitung zu einem größeren naturwissenschaftlichen Werk geplant hat. Ich werde im Verlauf dieser Hausarbeit zunächst auf Goethes Verhältnis zur Natur eingehen und dabei kurz die Naturwissenschaft seiner Zeit beleuchten. Im Anschluss beginne ich mit der Analyse des Aufsatzes. Dabei versuche ich möglichst textnah zu agieren. Abschließend werde ich mich der Frage nähern, in wie weit Goethes Aufsatz einen Aktualitätsbezug zu der modernen Naturwissenschaft hat. ***
Goethes Verhältnis zur Natur und die (Natur-) Wissenschaft
Man sollte bei dieser Betrachtung die jeweiligen Zeitumstände, in denen Goethe lebte nicht vergessen. Die Naturwissenschaft als solche wie sie heute existiert, war noch nicht herausgebildet. Zwar war die Methodik der Wissenschaft vorhanden, die Konzeption an den Universitäten selbst aber noch nicht. Zum Beispiel bringt Goethe die Tätigkeit in der Bergwerkskommission1 dazu, sich mit der Analyse von Gesteinsproben zu beschäftigen. Schon bald legt er umfangreiche Mineraliensammlungen an. Das zieht theoretische Auseinandersetzungen über die Geschichte der Erdentstehung nach sich, die man damals aus Gesteinsformationen und Schichtenbildungen zu entziffern beginnt. Die Diskussion der Ergebnisse ist aber von besonderer Brisanz, da sie dazu angetan ist, die noch weitgehend im Banne der biblischen Schöpfungsmythen stehende Naturgeschichte durch historisierende, entwicklungsgeschichtliche Modelle abzulösen. Goethe lebte also in einer Zeit großen Umbruchs. ***
1 Im Laufe des Jahres 1777 wurde ihm die Leitung der Bergwerkskommission mit dem Ziel übertragen, den Betrieb des Ilmenauer Silber- und Kupferbergwerks wieder aufzunehmen und damit eine staatliche Einnahmequelle zu eröffnen. (Metzler Goethe Lexikon, Stuttgart 2004, S.13.)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Einleitung
- 1.2. Goethes Verhältnis zur Natur und die (Natur-) Wissenschaft
- 2. Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt
- 2.1. Nahe am Text
- 2.2. Forschergemeinschaft
- 2.3. Zum Versuch
- 2.4. Die Gewalt des Geistes- ein despotischer Hof
- 2.5. Der Versuch als winziges Glied einer großen Kette
- 2.6. Der Vergleich mit der Mathematik
- 2.7. Zur Erfahrung höherer Art
- 3. Schluss
- 4. Literaturverzeichnis
- 4.1. Primärliteratur
- 4.2. Sekundärliteratur
- 4.3. Lexikon
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Goethes Aufsatz "Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt" aus dem Jahr 1792. Ziel ist es, Goethes Verhältnis zur Naturwissenschaft seiner Zeit zu beleuchten und den Aufsatz im Kontext der damaligen wissenschaftlichen Debatten zu untersuchen. Dabei wird die Aktualität von Goethes Überlegungen für die moderne Naturwissenschaft diskutiert.
- Goethes Naturverständnis und seine Methode
- Die Rolle des Versuchs in Goethes wissenschaftlichem Denken
- Die Bedeutung der Forschergemeinschaft für wissenschaftlichen Fortschritt
- Der Vergleich zwischen künstlerischem und wissenschaftlichem Schaffen
- Die Herausforderungen der objektiven Naturbeobachtung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Aufsatz "Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt" als Ausgangspunkt der Analyse. Sie skizziert den weiteren Verlauf der Arbeit, der Goethes Verhältnis zur Natur, die Naturwissenschaft seiner Zeit und schließlich eine Analyse des Aufsatzes selbst umfasst. Die Einleitung deutet bereits die Fragestellung nach der Aktualität von Goethes Ansatz für die moderne Naturwissenschaft an.
1.2. Goethes Verhältnis zur Natur und die (Natur-) Wissenschaft: Dieses Kapitel beleuchtet Goethes umfassendes und vielschichtiges Verhältnis zur Natur, wobei der Kontext seiner Zeit – geprägt vom Übergang von der bibelzentrierten Naturgeschichte zu historisierenden, entwicklungsgeschichtlichen Modellen – hervorgehoben wird. Goethes „schwärmerischen, dabei auf Ganzheitlichkeit ausgerichteten Naturkult“, gepaart mit detaillierten Kenntnissen und Beobachtungen, wird beschrieben. Sein zunehmender Pantheismus und die damit verbundene Identifizierung von „Gott“ und „Natur“ werden als richtungsweisend für seine naturwissenschaftlichen Erkundungen dargestellt. Goethes differenziertes Verhältnis zu den rationalen Naturwissenschaften seiner Zeit, seine Kritik an reinem Benennen und Kategorisieren sowie das Problem der vom Beobachter geprägten Hypothesenbildung werden ausführlich erläutert, was die Grundlage für die spätere Analyse seines Aufsatzes bildet.
2.1. Nahe am Text: Dieses Kapitel beginnt mit einer Analyse des Aufsatzes selbst. Goethes anfängliche, später aber widerlegte, These, dass außerwissenschaftliche Welterkenntnis durch Interessen geprägt sei, wird diskutiert. Der Vergleich mit der Sonne, die Pflanzen hervorbringt, ohne selbst Nutzen daraus zu ziehen, wird analysiert und relativiert. Die damit verbundene Betonung der Veränderung des Beobachters im Gegensatz zur Unveränderlichkeit der Sonne und die Entwicklung von Geschicklichkeit und Klugheit im Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnis werden hervorgehoben. Die Herausforderungen der naturwissenschaftlichen Forschung, insbesondere die Gefahr, sich in Theorien zu verstricken oder einen Mangel an adäquaten Korrektoren zu haben, werden als zentrale Probleme herausgestellt.
2.2. Forschergemeinschaft: Dieses Kapitel untersucht Goethes Auffassung von der Bedeutung einer Forschergemeinschaft für den wissenschaftlichen Fortschritt. Die Notwendigkeit von gemeinschaftlicher Arbeit, konstruktiver Kritik und gegenseitiger Unterstützung unter Forschern wird betont. Goethe argumentiert, dass nur das gemeinsame, auf einen Punkt gerichtete Interesse zu einem guten Forschungsergebnis führt. Die Bedeutung von „Verbündeten und Gleichgesinnten“ unter Naturforschern und Medizinern sowie der Einfluss von Zeit und Mensch auf neue Entdeckungen werden thematisiert.
2.3. Zum Versuch: In diesem Kapitel wird der wissenschaftliche Versuch als zentrales Element von Goethes naturwissenschaftlicher Methode analysiert. Im Gegensatz zur Präsentation fertiger Werke durch Künstler, betont Goethe den Charakter des wissenschaftlichen Versuchs als etwas Unfertiges, das andere Forscher zur Mitteilung ihrer Erkenntnisse und zur Überprüfung des Versuchsablaufs anregen soll. Goethes Verständnis von Forschung als gemeinsames Unternehmen, "Materialien" zu gewinnen und einen "Plan" zu entwickeln, aus dem ein "wissenschaftliches Gebäude" entsteht, wird hervorgehoben. Das Kapitel schließt mit Goethes Definition des wissenschaftlichen Versuchs ab.
Schlüsselwörter
Goethe, Naturwissenschaft, Versuch, Objektivität, Subjektivität, Forschergemeinschaft, Wissenschaftsgeschichte, Naturbeobachtung, Pantheismus, Methodologie.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Goethes Aufsatz "Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt" von 1792. Sie untersucht Goethes Verhältnis zur Naturwissenschaft seiner Zeit und den Aufsatz im Kontext der damaligen wissenschaftlichen Debatten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Aktualität von Goethes Überlegungen für die moderne Naturwissenschaft.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Goethes Naturverständnis und Methode, die Rolle des Versuchs in seinem wissenschaftlichen Denken, die Bedeutung der Forschergemeinschaft für den wissenschaftlichen Fortschritt, den Vergleich zwischen künstlerischem und wissenschaftlichem Schaffen sowie die Herausforderungen der objektiven Naturbeobachtung.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Goethes Verhältnis zur Natur und der Naturwissenschaft seiner Zeit, ein Kapitel zur Analyse des Aufsatzes "Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt" (unterteilt in Unterkapitel zu verschiedenen Aspekten des Aufsatzes wie der Rolle der Forschergemeinschaft und dem Wesen des wissenschaftlichen Versuchs), sowie einen Schluss und ein Literaturverzeichnis.
Welche Aspekte von Goethes Aufsatz werden im Detail analysiert?
Die Analyse des Aufsatzes umfasst Goethes These (später widerlegt) über außerwissenschaftliche Welterkenntnis, den Vergleich mit der Sonne als Beispiel für unveränderliches Objekt, die Betonung der Veränderung des Beobachters im wissenschaftlichen Prozess, die Herausforderungen der naturwissenschaftlichen Forschung, die Bedeutung der Forschergemeinschaft für den wissenschaftlichen Fortschritt, und Goethes Verständnis des wissenschaftlichen Versuchs als unfertiges, gemeinschaftliches Unternehmen.
Welches ist Goethes Verständnis des wissenschaftlichen Versuchs?
Goethe versteht den wissenschaftlichen Versuch im Gegensatz zur Präsentation fertiger Werke als etwas Unfertiges, das andere Forscher zur Mitteilung ihrer Erkenntnisse und zur Überprüfung anregen soll. Forschung ist für ihn ein gemeinsames Unternehmen, "Materialien" zu gewinnen und einen "Plan" zu entwickeln, aus dem ein "wissenschaftliches Gebäude" entsteht.
Welche Rolle spielt die Forschergemeinschaft in Goethes wissenschaftlichem Denken?
Goethe betont die Notwendigkeit von gemeinschaftlicher Arbeit, konstruktiver Kritik und gegenseitiger Unterstützung unter Forschern. Nur das gemeinsame, auf einen Punkt gerichtete Interesse führt zu guten Forschungsergebnissen. "Verbündete und Gleichgesinnte" unter Naturforschern und Medizinern sind essentiell, ebenso wie der Einfluss von Zeit und Mensch auf neue Entdeckungen.
Wie wird Goethes Verhältnis zur Naturwissenschaft seiner Zeit dargestellt?
Die Arbeit beschreibt Goethes umfassendes und vielschichtiges Verhältnis zur Natur im Kontext des Übergangs von der bibelzentrierten Naturgeschichte zu historisierenden, entwicklungsgeschichtlichen Modellen. Sein „schwärmerischer, auf Ganzheitlichkeit ausgerichteter Naturkult“ wird ebenso beleuchtet wie seine detaillierten Kenntnisse und Beobachtungen, sein zunehmender Pantheismus und seine differenzierte, kritische Auseinandersetzung mit den rationalen Naturwissenschaften seiner Zeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Naturwissenschaft, Versuch, Objektivität, Subjektivität, Forschergemeinschaft, Wissenschaftsgeschichte, Naturbeobachtung, Pantheismus, Methodologie.
- Citar trabajo
- Linda Werner (Autor), 2005, Der Versuch als Vermittler zwischen Objekt und Subjekt - Goethe als Naturwissenschaftler, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35886