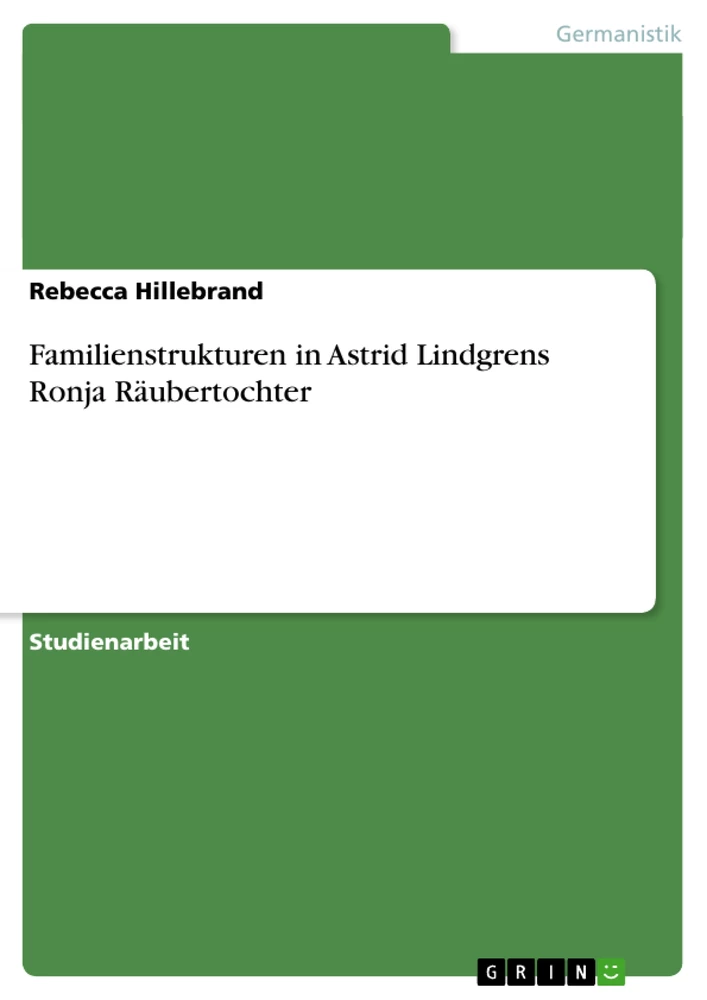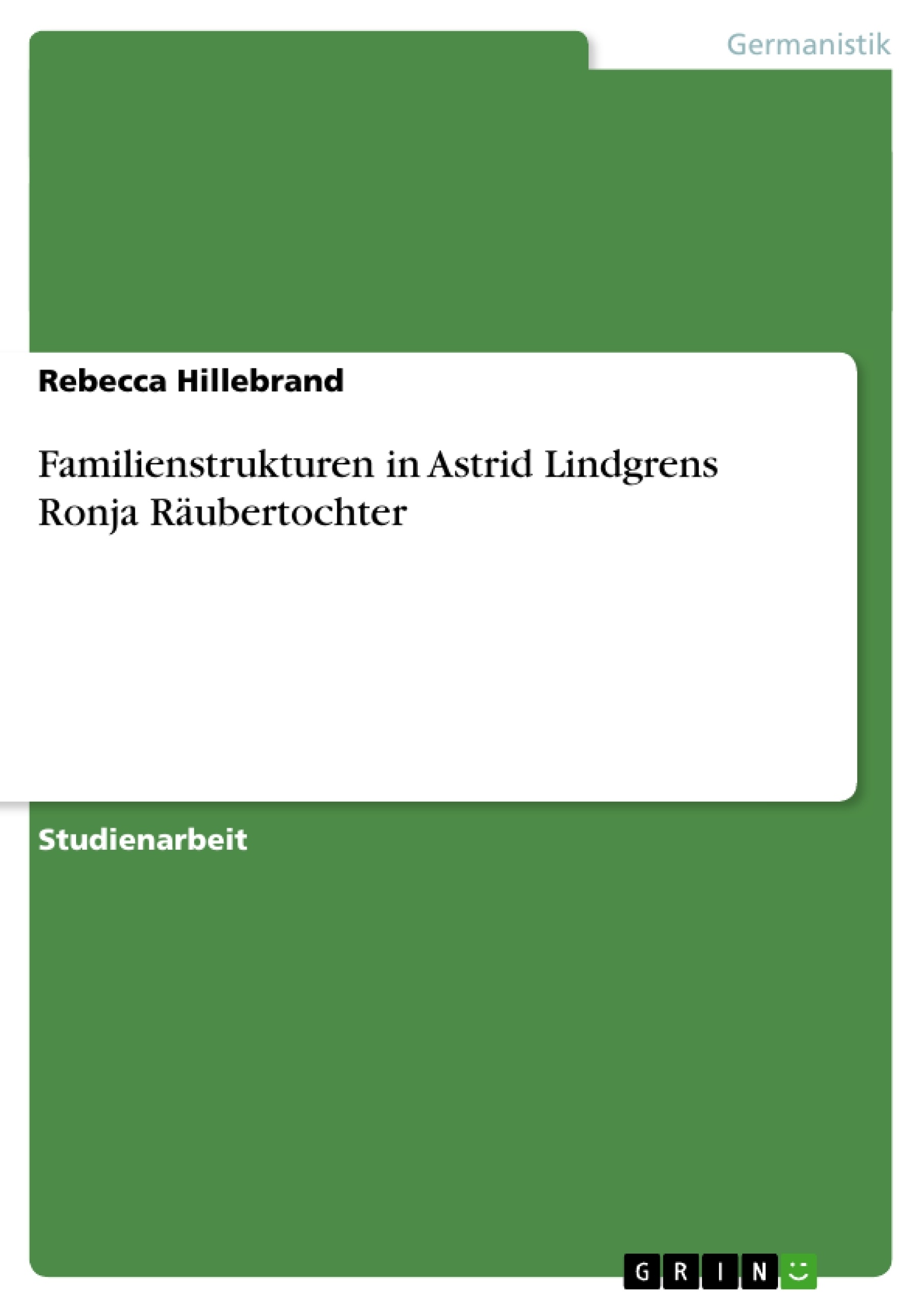In unserer Arbeit befassen wir uns mit Astrid Lingren´s Kinderroman „Ronja Räubertochter“. In Schweden erscheint er erstmals 1981 unter dem Titel „Ronja Rövardotter“ beim Stockholmer Verlag Rabén & Sjögren. Ein Jahr später, 1982, erscheint beim Hamburger Friedrich Oetinger Verlag die Deutsche Ausgabe, übersetzt von Anna-Liese Kornitzky. Mit Ronja Räubertochter veröffentlicht Astrid Lindgren ihr letztes literarisch bedeutsames Werk. Gattungsgemäß lässt es sich typisch für Astrid Lindgren´s Werke nicht eindeutig zuordnen. Die Autorin schafft mit Ronja Räubertochter in den 80-er Jahren, völlig quer zum Trend, ein Räubermärchen, das zahlreiche phantastische Elemente aufweist: Z.B. die fabelhaften „Waldbewohner“, das sogenannte „Dunkelvolk“. Da sind z.B. Graugnome, Rumpelwichte und die furchterregenden Wilddruden. Auch typisch für die Gattung Märchen ist es, dass die Zeit, in der die Geschichte von Ronja erzählt wird, nicht historisch datierbar ist. Dafür lässt sich der Handlungsort erschließen: Naturschilderungen und Volksmystik sind bei Ronja Räubertochter ganz in der skandinavischen Tradition anzusiedeln.
[...] Es erschließen sich verschiedene Zugehensweisen zu diesem Roman. Zum einen ist es eine Räubergeschichte und ein Märchen. Dann ist es aber auch die Geschichte einer Vater-Tochter-Beziehung oder die realistische Darstellung eines Adoleszenzprozesses, der eine Variante des Romeo- und Juliastoffes und eines Robinsonadenmotivs in sich trägt. Ronja Räubertochter ist sicherlich auch eine Geschichte über das Leben in der Natur und mit der Natur. Unser Augenmerk liegt allerdings auf der Beobachtung der zwischenmenschlichen Beziehungen. [...]
„Ihr fragt immer soviel danach, was ich meine und was dahintersteckt. Wißt ihr, ich werde euch mal was sagen. Ich denke überhaupt nicht soviel. ich denke gar nicht. Ich schreibe einfach. Das Einzige, was ich mit meinen Büchern beabsichtige, ist, das Kind in mir selbst zufriedenzustellen und den Kindern ein Leseerlebnis zu schenken. Ich schreibe Märchen, und der Mensch braucht Märchen, hat sie immer gebraucht. So ist das. Ich versuche nicht, die Kinder, die meine Bücher lesen, bewußt zu erziehen oder zu beeinflussen; das Einzige, worauf ich zu hoffen wage, ist, daß sie den Kindern vielleicht ein klein wenig zu einer menschenfreundlichen, lebensbejahenden und demokratischen Einstellung verhelfen.“ (Astrid Lindgren bei der Präsentation von Ronja Räubertochter 1981 vor Journalisten)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Familienstrukturen
- Feinanalyse einer ausgewählten Textstelle
- Der Familienkonflikt
- Ablösungsprozess
- Emanzipation
- Romeo- und Juliamotiv/ Robinsonadenmotiv
- Kinder als Verkörperung der Vernunft
- Ronja Räubertochter als Entwicklungs-/ Adoleszenzroman
- Das Entwicklungsmodell nach Erik H. Erikson
- Die einzelnen Stufen in Ronjas Entwicklung
- Feinanalyse einer ausgewählten Textstelle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Astrid Lindgrens Kinderroman „Ronja Räubertochter“ mit Fokus auf die Darstellung der Familienstrukturen und dem darin stattfindenden Ablösungsprozess.
- Analyse der Familienstrukturen in „Ronja Räubertochter“ und ihre Darstellung als Großfamilie
- Die Vater-Tochter-Beziehung zwischen Mattis und Ronja
- Der Konflikt zwischen den Familien Mattis und Borka
- Ronjas Entwicklungsprozess als Adoleszenzroman
- Die Rolle der Natur und des Waldes als Spiegelbild der menschlichen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt den Kontext von Astrid Lindgrens literarischem Werk im Kontext der Kinderliteratur dar. Im zweiten Kapitel erfolgt eine Analyse der Familienstrukturen innerhalb des Romans. Die Fokus liegt auf der Darstellung der „Mattissippe“ und der „Borkasippe“ als Großfamilie, insbesondere aber auf den Beziehungen innerhalb der „leiblichen“ Familie. In den Kapiteln 3 und 6 werden ausgewählte Textstellen detailliert analysiert, um die im Roman dargestellten Familienbeziehungen und Ronjas Entwicklungsprozess zu beleuchten.
Das Kapitel „Der Familienkonflikt“ analysiert die Konfliktpunkte zwischen den beiden Familien, die durch Ronjas und Birks Freundschaft ausgelöst werden. Es untersucht die Themen des Ablösungsprozesses, der Emanzipation und die Parallelen zum Romeo- und Juliamotiv sowie zum Robinsonadenmotiv. Des Weiteren beleuchtet es die Rolle der Kinder als Verkörperung der Vernunft im Konflikt. Das Kapitel „Ronja Räubertochter als Entwicklungs-/ Adoleszenzroman“ untersucht Ronjas Entwicklungsprozess im Kontext des Entwicklungsmodells nach Erik H. Erikson. Dabei werden die einzelnen Stufen in Ronjas Entwicklung näher beleuchtet.
Schlüsselwörter
Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter, Familienstrukturen, Großfamilie, Vater-Tochter-Beziehung, Ablösungsprozess, Emanzipation, Romeo- und Juliamotiv, Robinsonadenmotiv, Adoleszenzroman, Entwicklungsmodell nach Erik H. Erikson.
- Quote paper
- Rebecca Hillebrand (Author), 2000, Familienstrukturen in Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35435