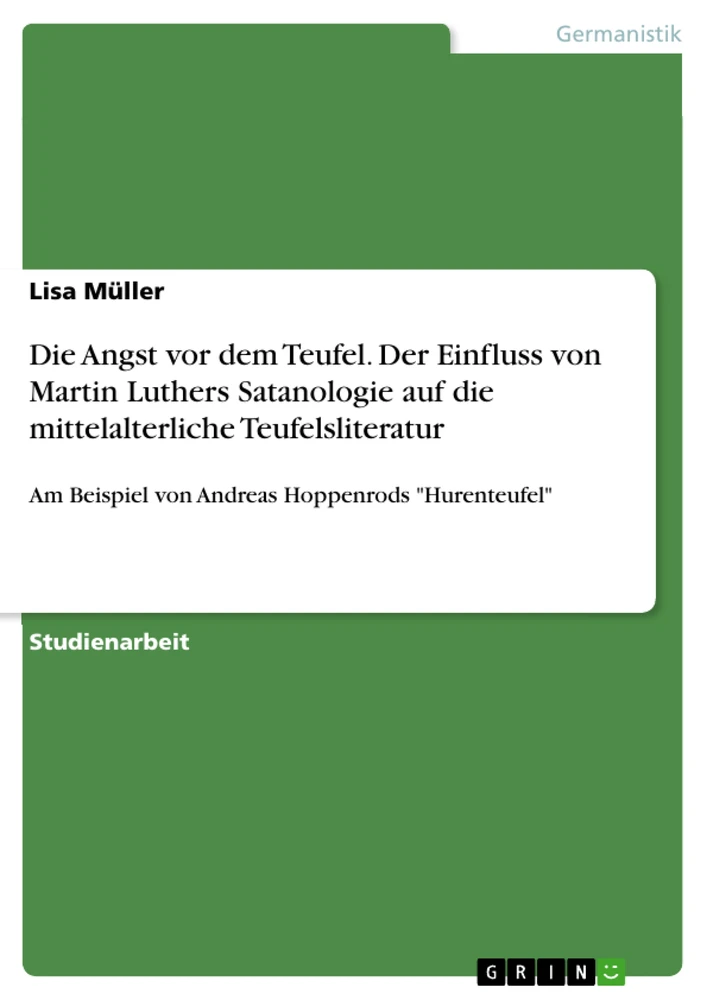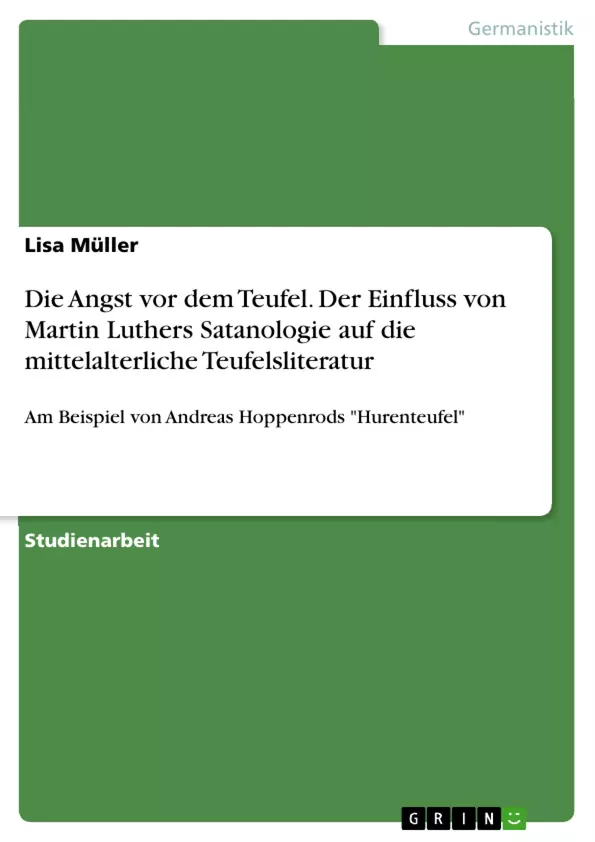Im Mittelalter fürchteten viele Menschen den Teufel. Dieser nahm als Gottes Widersacher im christlichen Glauben eine wichtige Rolle ein – er galt als Anfechter der christlichen Ordnung. Martin Luther (1483-1546) war ein Kind seiner Zeit und traf mit seinen Gedanken und Vorstellungen vom Teufel meist auf allgemeine Zustimmung seiner Zeitgenossen. Nach der lutherischen Satanologie ist es des Gläubigen Aufgabe, den Kampf mit dem Satan aufzunehmen, um die göttliche Ordnung im Gleichgewicht zu erhalten.
Luthers Lehre prägte viele protestantische Prediger und gab Anstoß zum Verfassen einzelner Spezialteufel-Traktate, die später als "Theatrum Diabolorum" veröffentlicht wurden. Eines der Spezialteufel-Traktate nennt sich "Der Hurenteufel". Hierbei handelt es sich um ein Werk von Andreas Hoppenrod (1524-1584), das mit einer Vorrede von M. Cyriacus Spangenberg zunächst im Jahre 1565 veröffentlicht wurde und vier Jahre später in der Sammlung des "Theatrum Diabolorum" erneut erschien.
Das "Theatrum Diabolorum" sei ein Sammelwerk evangelischer Theologen, das den Teufelsglauben Luthers und dessen Anhänger widerspiegelt. Diese These gilt es in folgender Arbeit zu bestätigen oder zu widerlegen. Hierzu werden einzelne Aspekte aus Luthers Glauben exemplarisch dem Werk von Hoppenrod gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Teufel und dessen Darstellung
- 3. Die Sünde und dessen Ursache
- 4. Abwendung des Teufels
- 5. Bewusstwerdung und Vergebung der Sünde
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Martin Luthers Teufelsglauben auf die mittelalterliche Teufelsliteratur, insbesondere anhand von Andreas Hoppenrods „Hurenteufel“. Ziel ist es, Luthers Satanologie mit der Darstellung des Teufels in diesem spezifischen Traktat zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten.
- Luthers Vorstellung vom Teufel und dessen hierarchische Struktur
- Die Personifikation des Teufels in der Spezialteufel-Literatur
- Der „Hurenteufel“ als Beispiel für die Verbindung von Luthers Lehre und populärer Teufelsliteratur
- Die Rolle des Teufels im Kontext von Sünde und Heilslehre
- Die belehrende und appellierende Funktion der Teufelsliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss Luthers auf die Darstellung des Teufels in der mittelalterlichen Teufelsliteratur dar. Sie präsentiert Martin Luther als einen maßgeblichen Akteur im Verständnis des Teufels im Mittelalter, dessen Lehre die Entstehung von Spezialteufel-Traktaten beeinflusste, wie beispielsweise den „Hurenteufel“ von Andreas Hoppenrod, der im Kontext des Theatrum Diabolorum eine zentrale Rolle spielt. Die Einleitung unterstreicht die Bedeutung des Werkes und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
2. Der Teufel und dessen Darstellung: Dieses Kapitel analysiert Luthers komplexe und ambivalente Sichtweise auf den Teufel. Luther beschreibt den Teufel sowohl als hierarchisch Gott untergeordnete Instanz als auch als einen Gott ebenbürtigen Widersacher. Das Kapitel beleuchtet die von Luther postulierte Aufteilung des Teufels in verschiedene Spezialteufel, die konkreten Bereichen wie der Hurerei zugeordnet sind, im Gegensatz zu seiner gleichzeitigen Auffassung des Teufels als transzendentes Wesen ohne körperliche Eigenschaften. Luthers Erfahrung der ständigen Anwesenheit des Teufels und die Rückführung allen Leids auf dessen Wirken werden ebenfalls diskutiert. Schließlich thematisiert das Kapitel die lutherische Erwartung des baldigen Jüngsten Gerichts und den damit verbundenen verstärkten Einfluss des Teufels auf die Versuchung der Menschen zur Sünde, besonders im Kontext der Ehe als Grundpfeiler der christlichen Ordnung.
Schlüsselwörter
Martin Luther, Teufelsglaube, Mittelalter, Teufelsliteratur, Andreas Hoppenrod, Hurenteufel, Theatrum Diabolorum, Satanologie, Sünde, Heilslehre, Spezialteufel, kirchliche Tradition, Volksglaube.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Einflusses Martin Luthers auf die mittelalterliche Teufelsliteratur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Martin Luthers Teufelsglauben auf die mittelalterliche Teufelsliteratur, insbesondere anhand von Andreas Hoppenrods „Hurenteufel“. Der Fokus liegt auf dem Vergleich von Luthers Satanologie mit der Darstellung des Teufels in diesem Traktat und der Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem Luthers Vorstellung vom Teufel und dessen hierarchische Struktur, die Personifikation des Teufels in der Spezialteufel-Literatur, den „Hurenteufel“ als Beispiel für die Verbindung von Luthers Lehre und populärer Teufelsliteratur, die Rolle des Teufels im Kontext von Sünde und Heilslehre sowie die belehrende und appellierende Funktion der Teufelsliteratur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz darstellt. Kapitel 2 analysiert Luthers komplexe Sichtweise auf den Teufel, einschließlich seiner hierarchischen Struktur und der Zuordnung von Spezialteufeln. Weitere Kapitel befassen sich mit der Abwendung des Teufels, der Bewusstwerdung und Vergebung der Sünde, und einem abschließenden Fazit.
Wer ist Andreas Hoppenrod und welche Bedeutung hat sein Werk "Hurenteufel"?
Andreas Hoppenrod ist der Autor des Traktats "Hurenteufel", welches als Beispiel für die populäre Teufelsliteratur des Mittelalters dient und im Kontext des "Theatrum Diabolorum" eine zentrale Rolle spielt. Die Arbeit analysiert den "Hurenteufel", um den Einfluss Luthers auf diese Art von Literatur zu belegen.
Wie wird Luthers Teufelsglaube in der Arbeit dargestellt?
Luthers Teufelsglaube wird als komplex und ambivalent dargestellt. Er sah den Teufel sowohl als hierarchisch Gott untergeordnete Instanz als auch als ebenbürtigen Widersacher. Die Arbeit beleuchtet Luthers Vorstellung von Spezialteufeln, seine Erfahrung der ständigen Anwesenheit des Teufels und die Rückführung allen Leids auf dessen Wirken. Die lutherische Erwartung des baldigen Jüngsten Gerichts und der verstärkte Einfluss des Teufels auf die Versuchung zur Sünde, insbesondere im Kontext der Ehe, werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Martin Luther, Teufelsglaube, Mittelalter, Teufelsliteratur, Andreas Hoppenrod, Hurenteufel, Theatrum Diabolorum, Satanologie, Sünde, Heilslehre, Spezialteufel, kirchliche Tradition, Volksglaube.
- Quote paper
- Lisa Müller (Author), 2014, Die Angst vor dem Teufel. Der Einfluss von Martin Luthers Satanologie auf die mittelalterliche Teufelsliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354125