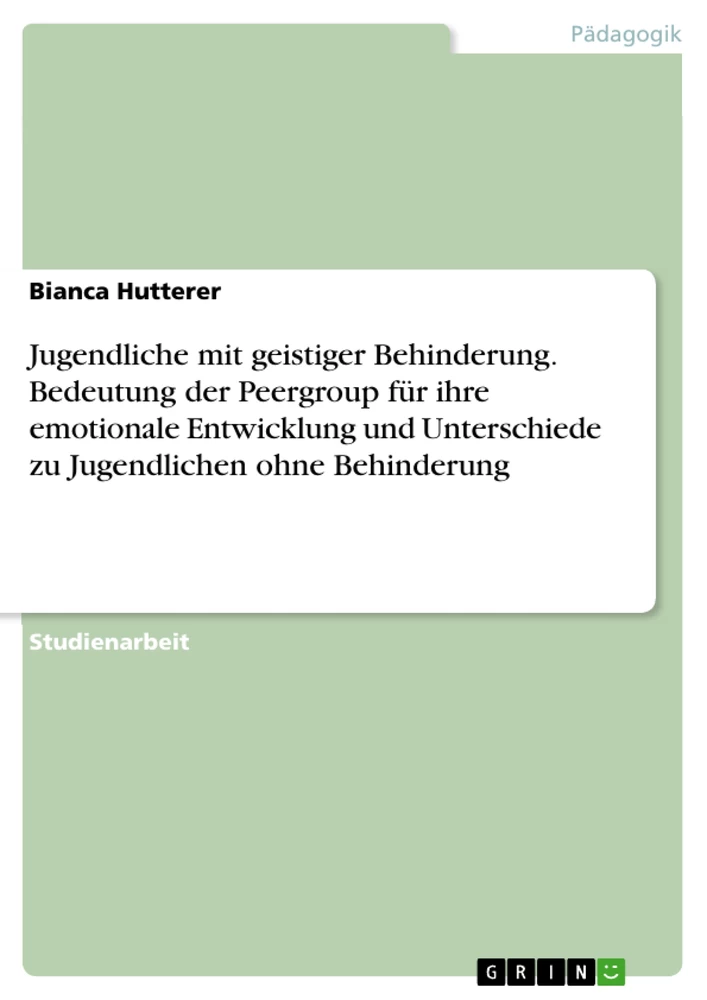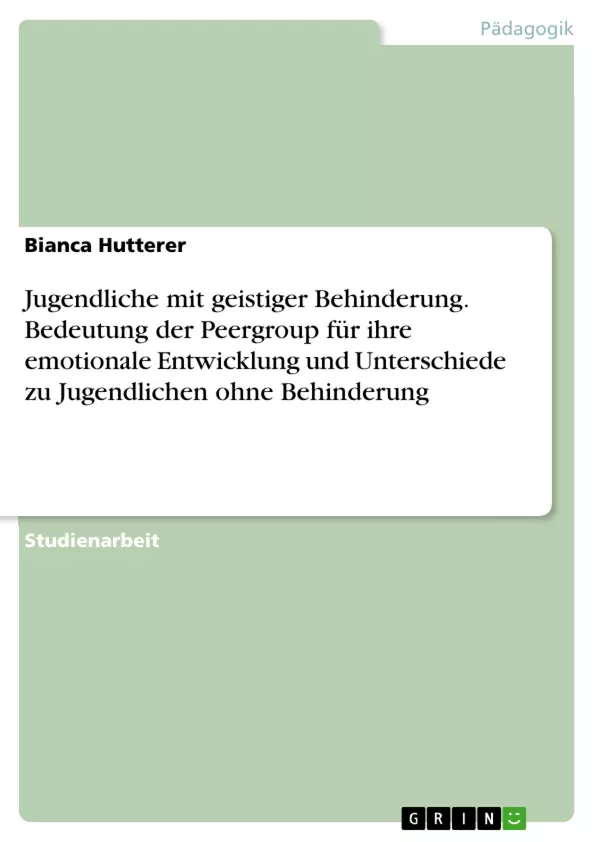Diese Arbeit setzt sich mit der Bedeutung der Peergroup für Menschen mit leichten geistigen Behinderungen auseinander. Ebenso wird der Bezug zur emotionalen Entwicklung hergestellt. Es werden Unterschiede in der Bedeutsamkeit der Peergroup und im Verlauf der Entwicklung der Emotionalität von Jugendlichen mit und ohne geistige Behinderung aufgezeigt.
Zu Beginn sollen die Begrifflichkeiten „leichte geistige Behinderung“ und „Peergroup“ zum besseren Verständnis geklärt werden. Danach folgt die zeitliche Eingrenzung des Jugendalters. Im Anschluss wird der Verlauf der emotionalen Entwicklung in den drei Phasen der Kindheit und dann im Jugendalter zu erklären sein, um dann Bezug auf die Abweichungen in der Entwicklung bei Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung zu nehmen. Der darauffolgende Teil behandelt die Bedeutung der Peergroup. Hier stellt sich auch die Frage, ob es Unterschiede in der Bedeutung der Gleichaltrigengruppe für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen gibt und wie sich diese zeigen. In diesen Punkten werden auch die Risikofaktoren einer Peergroup herausgearbeitet. Anschließend werden die Aufgaben der Sozialen Arbeit in diesem Bereich erläutert. Um einen guten Überblick zu schaffen, wird zu Beginn jedes Kapitels kurz erwähnt, worauf als nächstes eingegangen wird.
Jugendliche verbringen ab einem gewissen Alter immer mehr Zeit mit ihren FreundInnen, die sie aus der Schule, aus dem Sportverein oder aus der Nachbarschaft kennen. Das Jugendalter ist der entscheidende Schritt ins Erwachsenenleben. Auch die Peergroup spielt in dieser Zeit eine große Rolle. Ebenso ist die Entwicklung der Emotionalität im Jugendalter sehr wichtig.
Doch das ist nicht nur bei normalentwickelten Heranwachsenden so. Auch Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen haben das Bedürfnis nach Freundschaften zu Gleichaltrigen und nach Zugehörigkeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1. geistige Behinderung
- 2.2. Peergroup
- 3. Einteilung und zeitliche Eingrenzung des Jugendalters
- 4. Verlauf der emotionalen Entwicklung
- 4.1. Verlauf im Säuglingsalter
- 4.2. Verlauf im Kindesalter
- 4.2.1. Verlauf in der frühen Kindheit
- 4.2.2. Verlauf in der mittleren und späten Kindheit
- 4.3. Verlauf im Jugendalter
- 4.4. Abweichungen bei Menschen mit leichten geistigen Behinderungen
- 5. Unterschiede in der Bedeutung der Peergroup im Jugendalter
- 5.1. allgemeine Bedeutung der Peergroup im Jugendalter
- 5.2. Bedeutung für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen
- 5.3. Risikofaktoren einer Peergroup
- 6. Aufgaben der Sozialen Arbeit
- 7. Fazit und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Peergroup für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen im Kontext ihrer emotionalen Entwicklung. Ziel ist es, Unterschiede in der Bedeutung der Peergroup und im Verlauf der emotionalen Entwicklung zwischen Jugendlichen mit und ohne geistige Behinderung aufzuzeigen.
- Begriffsbestimmung von „leichte geistige Behinderung“ und „Peergroup“
- Verlauf der emotionalen Entwicklung im Jugendalter und Abweichungen bei Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen
- Bedeutung der Peergroup im Jugendalter allgemein und speziell für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen
- Risikofaktoren im Zusammenhang mit der Peergroup
- Aufgaben der Sozialen Arbeit in diesem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung der Peergroup im Jugendalter für Jugendliche mit und ohne leichte geistige Behinderung. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf behandelt werden. Die Bedeutung von Freundschaften und Zugehörigkeit im Jugendalter wird als zentraler Aspekt hervorgehoben, der sowohl für Jugendliche mit als auch ohne geistige Behinderung relevant ist.
2. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe "leichte geistige Behinderung" und "Peergroup". Es werden verschiedene Definitionen aus der Fachliteratur vorgestellt, darunter die Definition der WHO und die von Speck (2016), um ein umfassendes Verständnis der Begrifflichkeiten zu ermöglichen. Die Schwierigkeiten bei der Definition von geistiger Behinderung werden angesprochen und verschiedene Klassifizierungen nach dem Intelligenzquotienten (IQ) gemäß ICD-10 erläutert. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Peergroup – als Altersgruppe, Clique oder Gruppe mit ähnlichen Werten und Normen – werden ebenfalls beleuchtet, um den Begriff für die spätere Analyse zu präzisieren.
3. Einteilung und zeitliche Eingrenzung des Jugendalters: Dieses Kapitel beschreibt die zeitliche Eingrenzung und die Einteilung des Jugendalters in Entwicklungsphasen. Es legt den Rahmen für die spätere Betrachtung der emotionalen Entwicklung und der Bedeutung der Peergroup in dieser Lebensphase fest. Die Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen und deren charakteristische Merkmale, die für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel essentiell sind.
4. Verlauf der emotionalen Entwicklung: Das Kapitel beschreibt den Verlauf der emotionalen Entwicklung in den verschiedenen Phasen der Kindheit (Säuglingsalter, frühe, mittlere und späte Kindheit) und im Jugendalter. Es werden die typischen Entwicklungsschritte und Meilensteine in der emotionalen Entwicklung detailliert dargestellt. Ein besonderer Fokus liegt auf den Abweichungen in der emotionalen Entwicklung bei Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen und wie sich diese von der Entwicklung bei Gleichaltrigen ohne Behinderung unterscheiden. Die Unterschiede werden im Detail analysiert und mit Beispielen belegt.
5. Unterschiede in der Bedeutung der Peergroup im Jugendalter: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der Peergroup im Jugendalter, sowohl im Allgemeinen als auch speziell für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen. Es untersucht, welche Rolle die Peergroup für die soziale und persönliche Entwicklung spielt, welche Funktionen sie erfüllt und welche Herausforderungen sich daraus ergeben können. Der Fokus liegt auf den spezifischen Bedürfnissen und Erfahrungen von Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen in Peergruppen und wie diese sich von den Erfahrungen von Jugendlichen ohne Behinderung unterscheiden. Es werden mögliche Risikofaktoren im Kontext der Peergroup diskutiert, die für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen relevant sein können.
6. Aufgaben der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Aufgaben der Sozialen Arbeit im Umgang mit Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen und ihren Peergruppen. Es beschreibt die verschiedenen Unterstützungsangebote und Interventionen, die Sozialarbeiter anbieten können, um die positive Entwicklung der Jugendlichen zu fördern und die Herausforderungen zu bewältigen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Sozialen Arbeit im Hinblick auf die Gestaltung von inklusiven Peergruppen und die Unterstützung von Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen und der Bewältigung von Schwierigkeiten im Umgang mit Peers.
Schlüsselwörter
Leichte geistige Behinderung, Peergroup, emotionale Entwicklung, Jugendalter, soziale Integration, Risikofaktoren, Soziale Arbeit, Inklusion, Gleichaltrige, Entwicklungsphasen, IQ, ICD-10.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bedeutung der Peergroup für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Peergroup für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen im Kontext ihrer emotionalen Entwicklung. Sie beleuchtet Unterschiede in der Bedeutung der Peergroup und im Verlauf der emotionalen Entwicklung zwischen Jugendlichen mit und ohne geistige Behinderung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Begriffsbestimmung von „leichte geistige Behinderung“ und „Peergroup“, Verlauf der emotionalen Entwicklung im Jugendalter und Abweichungen bei Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen, Bedeutung der Peergroup im Jugendalter allgemein und speziell für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen, Risikofaktoren im Zusammenhang mit der Peergroup und Aufgaben der Sozialen Arbeit in diesem Kontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmungen (leichte geistige Behinderung und Peergroup), Einteilung und zeitliche Eingrenzung des Jugendalters, Verlauf der emotionalen Entwicklung (inkl. Abweichungen bei Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen), Unterschiede in der Bedeutung der Peergroup im Jugendalter, Aufgaben der Sozialen Arbeit und Fazit/Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird detailliert zusammengefasst.
Wie werden „leichte geistige Behinderung“ und „Peergroup“ definiert?
Das Kapitel „Begriffsbestimmungen“ klärt diese zentralen Begriffe. Es werden verschiedene Definitionen aus der Fachliteratur vorgestellt (u.a. WHO, Speck 2016), unterschiedliche Klassifizierungen nach dem IQ gemäß ICD-10 erläutert und verschiedene Sichtweisen auf die Peergroup (Altersgruppe, Clique, Gruppe mit ähnlichen Werten) beleuchtet.
Wie wird die emotionale Entwicklung beschrieben?
Kapitel 4 beschreibt den Verlauf der emotionalen Entwicklung vom Säuglingsalter bis ins Jugendalter, inklusive typischer Entwicklungsschritte und Meilensteine. Es analysiert detailliert die Abweichungen in der emotionalen Entwicklung bei Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen im Vergleich zu Gleichaltrigen ohne Behinderung.
Welche Bedeutung hat die Peergroup für Jugendliche mit und ohne leichte geistige Behinderung?
Kapitel 5 analysiert die Bedeutung der Peergroup für die soziale und persönliche Entwicklung von Jugendlichen, sowohl allgemein als auch speziell für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen. Es untersucht die Rolle der Peergroup, die erfüllten Funktionen und mögliche Herausforderungen. Spezifische Bedürfnisse und Erfahrungen von Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen in Peergruppen werden im Vergleich zu Jugendlichen ohne Behinderung betrachtet. Mögliche Risikofaktoren werden diskutiert.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit?
Kapitel 6 beleuchtet die Aufgaben der Sozialen Arbeit im Umgang mit Jugendlichen mit leichten geistigen Behinderungen und ihren Peergruppen. Es beschreibt Unterstützungsangebote und Interventionen zur Förderung der positiven Entwicklung und Bewältigung von Herausforderungen. Die Bedeutung der Sozialen Arbeit für die Gestaltung inklusiver Peergruppen und die Unterstützung bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Leichte geistige Behinderung, Peergroup, emotionale Entwicklung, Jugendalter, soziale Integration, Risikofaktoren, Soziale Arbeit, Inklusion, Gleichaltrige, Entwicklungsphasen, IQ, ICD-10.
- Quote paper
- Bianca Hutterer (Author), 2016, Jugendliche mit geistiger Behinderung. Bedeutung der Peergroup für ihre emotionale Entwicklung und Unterschiede zu Jugendlichen ohne Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353470