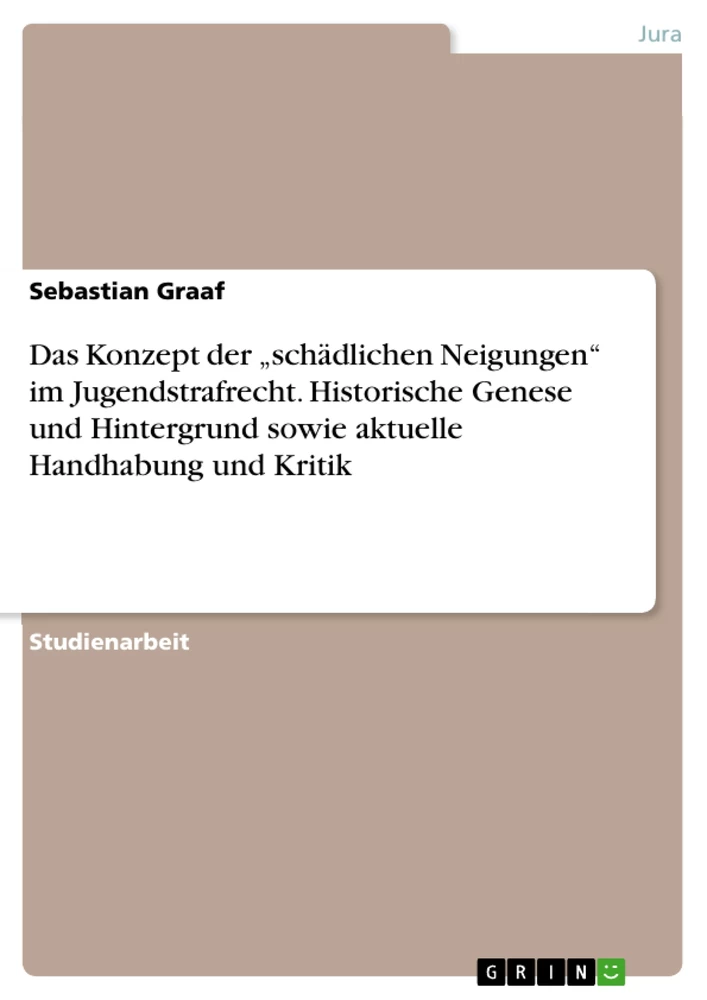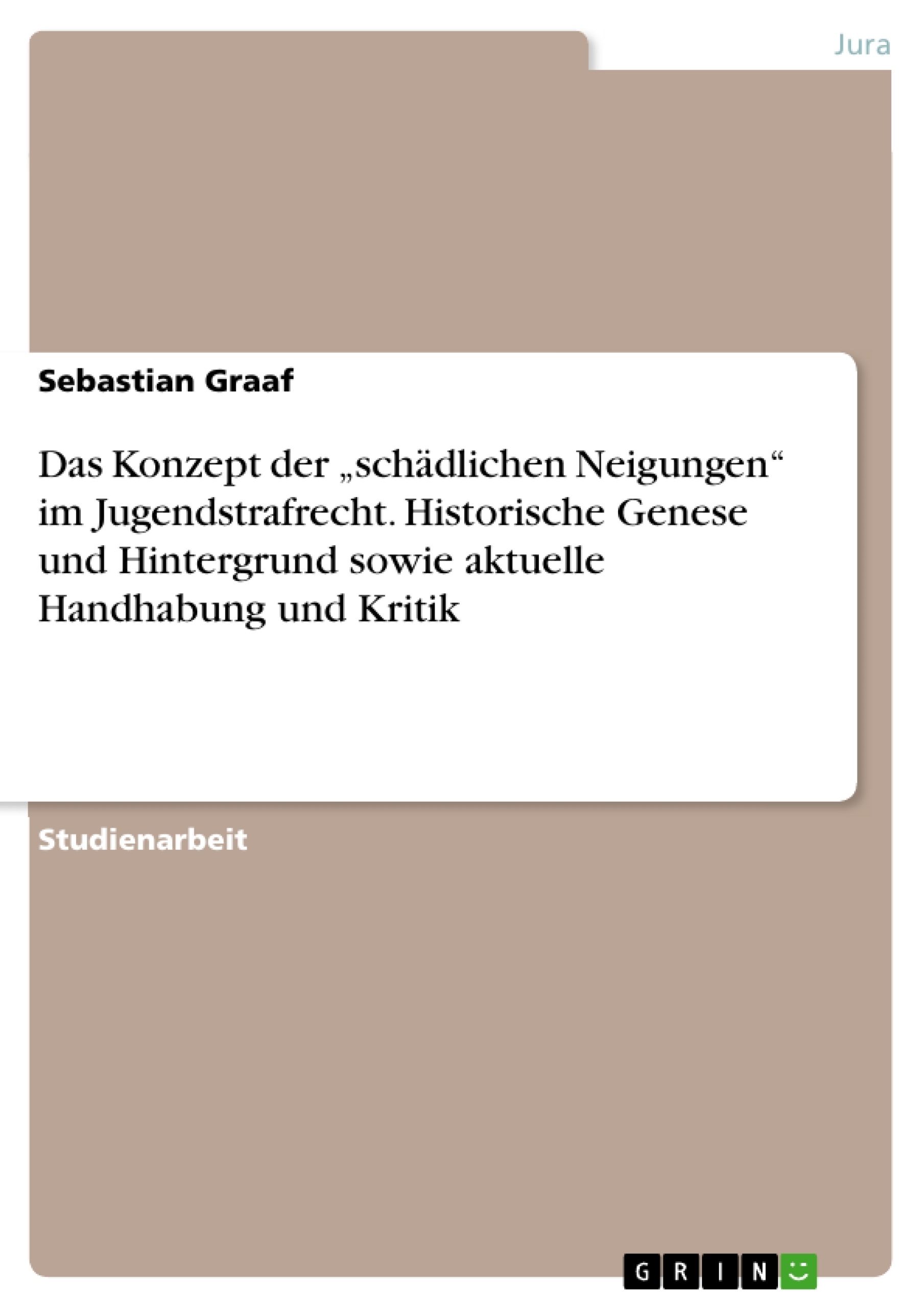Die Seminararbeit behandelt den Ursprung und den Hintergrund des Konzepts der „schädlichen Neigungen“ und prüft, inwieweit es als Relikt aus der Zeit des Nationalsozialismus zu diffamieren ist. Neben dem heutigen Verständnis nach höchstrichterlicher Rechtsprechung geht es insbesondere auch um die Kritik, die dem Konzept vorgehalten wird, um dann auf die Versuche zur Neuregelung der Jugendstrafe einzugehen.
Die Jugendstrafe wegen „schädlicher Neigungen“ steht schon seit Jahrzehnten in der Kritik. Dennoch sind die „schädlichen Neigungen“ bis dato die noch am häufigsten angewendete Anordnungsvoraussetzung der Jugendstrafe im Vergleich zur „Schwere der Schuld“. Sie stellen nicht nur nach § 17 II Alt. 1 JGG eine Anordnungsvoraussetzung für die Jugendstrafe dar, sondern sind auch für die Aussetzung der Strafverhängung nach § 27 JGG von Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Historische Entwicklung des Konzepts der „schädlichen Neigungen“
- Aktuelle Handhabung und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die historische Entwicklung und die aktuelle Handhabung des Konzepts der „schädlichen Neigungen“ im Jugendstrafrecht. Sie analysiert die Kritik an diesem Konzept und beleuchtet dessen Bedeutung im Kontext des deutschen Jugendstrafrechts.
- Historische Genese des Konzepts „schädliche Neigungen“
- Rechtsdogmatische Einordnung und Auslegung
- Aktuelle Rechtsprechung und Praxis
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept
- Zukünftige Entwicklungen und Reformbedarf
Zusammenfassung der Kapitel
Historische Entwicklung des Konzepts der „schädlichen Neigungen“: Diese Kapitel analysiert die historische Entwicklung des Begriffs "schädliche Neigungen" im Jugendstrafrecht, beginnend mit den frühen Konzepten und deren Wandel über die Zeit. Es werden die verschiedenen gesetzlichen und gesellschaftlichen Einflüsse auf die Definition und Anwendung des Begriffs untersucht. Dabei wird besonders auf die unterschiedlichen Interpretationen und die damit verbundenen Herausforderungen eingegangen, die sich über die Jahrzehnte hinweg ergeben haben. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich die Definition und die rechtliche Handhabung von „schädlichen Neigungen“ im Laufe der Geschichte verändert haben und welche Faktoren diese Veränderungen beeinflusst haben. Es wird ein umfassender Überblick über die juristische und gesellschaftliche Debatte um den Begriff gegeben und dessen Bedeutung im Kontext der jeweiligen Epoche herausgestellt.
Aktuelle Handhabung und Kritik: Dieses Kapitel befasst sich mit der gegenwärtigen Anwendung des Konzepts „schädliche Neigungen“ im deutschen Jugendstrafrecht. Es werden aktuelle Rechtsprechungsfälle und Praxisbeispiele analysiert, um die Anwendung des Begriffs in der heutigen Zeit zu beleuchten. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept. Die Arbeit beleuchtet die Probleme und die Herausforderungen, die mit der Verwendung von „schädlichen Neigungen“ als Grundlage für Jugendstrafen verbunden sind, darunter die Schwierigkeiten bei der Prognose zukünftigen Verhaltens und die Gefahr von Diskriminierung und Stigmatisierung. Der Kapitel diskutiert mögliche Alternativen und Reformansätze, um den Umgang mit Jugendlichen mit problematischem Verhalten zu verbessern und die Menschenrechte der Betroffenen zu wahren.
Schlüsselwörter
Jugendstrafrecht, schädliche Neigungen, Jugendstrafe, Generalprävention, Spezialprävention, Rechtsprechung, Kritik, Prognose, Reformbedarf, Jugendschutz, Erziehung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: "Schädliche Neigungen" im Jugendstrafrecht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Konzept der „schädlichen Neigungen“ im deutschen Jugendstrafrecht. Sie beleuchtet sowohl die historische Entwicklung als auch die aktuelle Handhabung und Kritik an diesem Konzept.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die historische Genese des Konzepts „schädliche Neigungen“, dessen rechtsdogmatische Einordnung und Auslegung, die aktuelle Rechtsprechung und Praxis, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept sowie mögliche zukünftige Entwicklungen und Reformbedarf. Konkret werden die verschiedenen gesetzlichen und gesellschaftlichen Einflüsse auf die Definition und Anwendung des Begriffs untersucht, inklusive der Herausforderungen über die Jahrzehnte hinweg.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur historischen Entwicklung des Konzepts der „schädlichen Neigungen“ und zur aktuellen Handhabung und Kritik. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse und Diskussion der jeweiligen Thematik.
Was wird im Kapitel zur historischen Entwicklung behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung des Begriffs "schädliche Neigungen" im Jugendstrafrecht von den frühen Konzepten bis zur Gegenwart. Es untersucht die verschiedenen Interpretationen und Herausforderungen im Laufe der Geschichte und beleuchtet die juristische und gesellschaftliche Debatte um den Begriff.
Worüber handelt das Kapitel zur aktuellen Handhabung und Kritik?
Das Kapitel befasst sich mit der gegenwärtigen Anwendung des Konzepts im deutschen Jugendstrafrecht. Es analysiert aktuelle Rechtsprechungsfälle und Praxisbeispiele und kritisiert die damit verbundenen Probleme, wie Schwierigkeiten bei der Prognose zukünftigen Verhaltens und die Gefahr von Diskriminierung und Stigmatisierung. Es diskutiert auch mögliche Alternativen und Reformansätze.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Zu den Schlüsselwörtern gehören Jugendstrafrecht, schädliche Neigungen, Jugendstrafe, Generalprävention, Spezialprävention, Rechtsprechung, Kritik, Prognose, Reformbedarf, Jugendschutz und Erziehung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, die historische Entwicklung und aktuelle Handhabung des Konzepts der „schädlichen Neigungen“ zu untersuchen, die Kritik daran zu analysieren und dessen Bedeutung im Kontext des deutschen Jugendstrafrechts zu beleuchten.
- Citation du texte
- Sebastian Graaf (Auteur), 2016, Das Konzept der „schädlichen Neigungen“ im Jugendstrafrecht. Historische Genese und Hintergrund sowie aktuelle Handhabung und Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352491