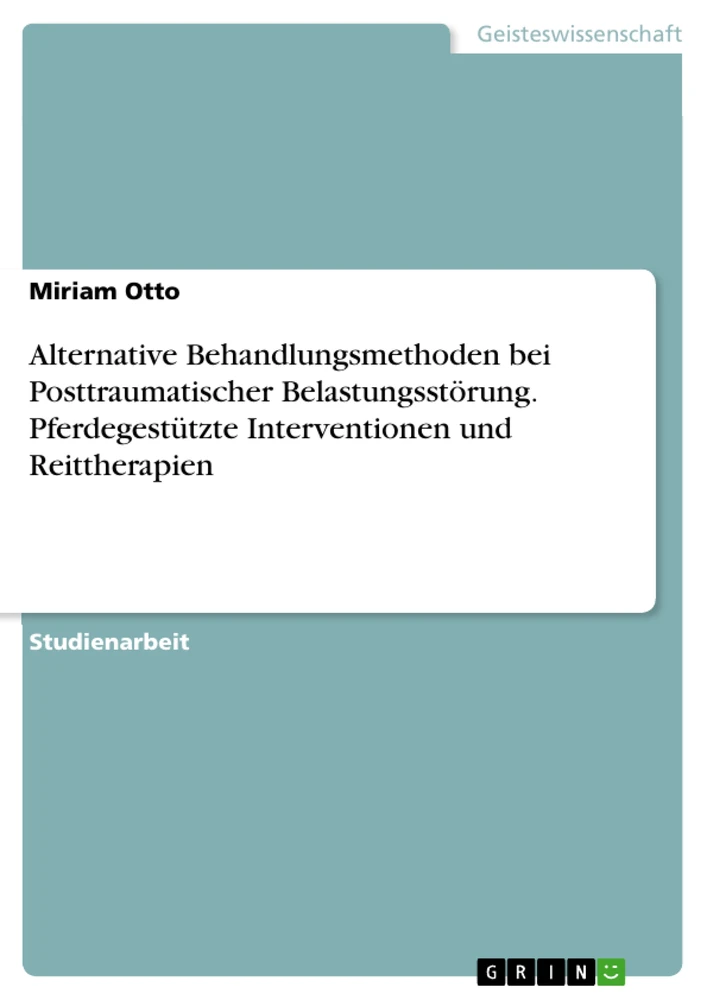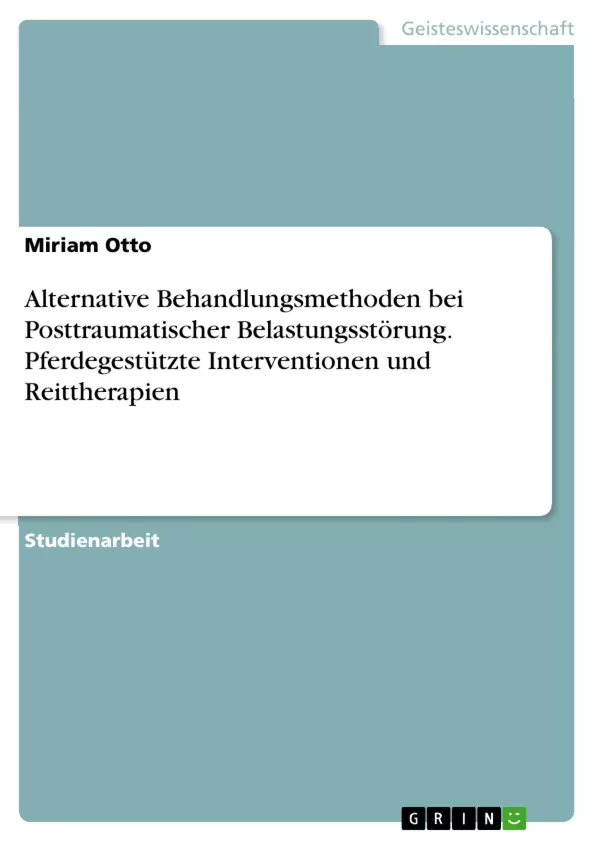Die vorliegende Arbeit behandelt mögliche Interventions- und Therapiemethoden einer Posttraumatischen Belastungsstörung mit dem Fokus auf Unterstützung durch Pferde.
Der Begriff Trauma (griechisch für Verletzung, Wunde) beschreibt die Schädigung des Körpers durch äußere Einflüsse, schließt aber auch seelische Verletzungen mit ein. Laut Fischer und Riedesser äußert sich ein Trauma als Diskrepanzerlebnis zwischen einer bedrohlichen Situation und den individuellen Bewältigungsmechanismen mit dieser. Es bewirkt Gefühle von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe und erschüttert das Selbst- und Weltverständnis dauerhaft.
Als Folge eines Traumas kann (muss aber nicht!) eine Posttraumatische Belastungsstörung entstehen, um welche es in dieser Arbeit gehen wird. Nach einer Beschreibung der Epidemiologie und Ätiologie der Posttraumatischen Belastungsstörung gehe ich gezielter auf ihre Symptomatik ein.
Die Symptome unterscheiden sich teilweise zwischen Kindern und Erwachsenen. Bei beiden Gruppen ist es jedoch von großer Bedeutung, die Symptome mit und durch ihren Ursprung, das Trauma, zu verstehen, um angemessen mit ihnen umgehen und sie behandeln zu können. Dieser Umgang wird unter anderem im Kapitel zur Traumapädagogik behandelt. Denn Trauma ist ein sensibles Thema, welches einen bewussten und sensiblen Umgang fordert. Damit (pferdegestützte) Interventionen ihre volle Wirkung entfalten können, ist eine entsprechende pädagogische Grundhaltung bei der durchführenden Person Voraussetzung.
Zuvor wird die klassische Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen im Sinne von Medikamenten und Psychotherapie beschrieben, welche zum Teil auch Bedingung für pferdegestützte Interventionen sind.
Im Kapitel Pferdegestützte Interventionen werden alternative und unterstützende Möglichkeiten der Behandlung besprochen. Es wird thematisiert, welche Rahmenbedingungen nötig sind, aber auch wie eine pferdegestützte Therapie bei Posttraumatischen Belastungsstörungen konkret aussehen kann. Ein Fallbeispiel rundet diesen Eindruck ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Epidemiologie Posttraumatischer Belastungsstörungen
- 3. Ätiologie Posttraumatischer Belastungsstörungen
- 4. Symptomatik Posttraumatischer Belastungsstörungen
- 4.1 Besonderheiten der posttraumatischen Entwicklung bei Kindern
- 4.2 Erläuterung einzelner traumabezogener Symptome und der Umgang mit ihnen
- 5. Diagnostik Posttraumatischer Belastungsstörungen
- 5.1 Differenzialdiagnosen zur Posttraumatischen Belastungsstörung
- 6. Klassische Behandlung Posttraumatischer Belastungsstörungen
- 7. Die Grundhaltung Traumapädagogik als Voraussetzung für gelingende Pferdegestützte Interventionen
- 8. Pferdegestützte Interventionen bei Posttraumatischen Belastungsstörungen
- 8.1 Rahmenbedingungen
- 8.2 Konkrete Ideen für Pferdegestützte Interventionen mit Menschen mit traumatisierenden Erfahrungen
- 8.3 Fallbeispiel
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik der pferdegestützten Interventionen bei Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). Der Fokus liegt auf der Beschreibung und Einordnung von PTBS im Kontext der Traumaforschung und der Erörterung der Möglichkeiten, wie Pferdegestützte Interventionen Menschen mit Traumatisierungen unterstützen können.
- Epidemiologie und Ätiologie von PTBS
- Symptome und Besonderheiten bei Kindern und Erwachsenen
- Die Bedeutung der Traumapädagogik für gelingende Interventionen
- Rahmenbedingungen und konkrete Ansätze für pferdegestützte Interventionen
- Fallbeispiele zur Illustration der Anwendung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Trauma und PTBS ein. Sie stellt die Relevanz des Themas und den Aufbau der Arbeit dar. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Epidemiologie von PTBS. Hierbei werden verschiedene Traumen und ihre Häufigkeit sowie die Prävalenz und Inzidenz von PTBS in Abhängigkeit vom Trauma betrachtet.
Im dritten Kapitel geht es um die Ätiologie von PTBS. Es werden sowohl biologische als auch psychologische Faktoren beleuchtet, die die Entstehung der Erkrankung beeinflussen können. Der Fokus liegt auf den Veränderungen im Gehirn und der Aufrechterhaltung der psychopathologischen Symptomatik.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Symptomatik von PTBS. Es wird auf die Besonderheiten der posttraumatischen Entwicklung bei Kindern eingegangen und die einzelnen Symptome und ihre Entstehung in Bezug zum Trauma erklärt. Darüber hinaus werden konkrete Strategien zum Umgang mit den Symptomen vorgestellt.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Diagnostik von PTBS. Es werden verschiedene Methoden der Diagnostik beschrieben und die Bedeutung der Differenzialdiagnostik hervorgehoben.
Im sechsten Kapitel werden klassische Behandlungsmethoden von PTBS wie Medikamententherapie und Psychotherapie vorgestellt. Es wird betont, dass diese Behandlungsformen eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg pferdegestützter Interventionen darstellen können.
Das siebte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Traumapädagogik für gelingende pferdegestützte Interventionen. Es wird verdeutlicht, dass eine empathische und respektvolle Grundhaltung sowie ein tiefes Verständnis der Traumatik essenziell sind für den Erfolg der Arbeit mit traumatisierten Menschen.
Im achten Kapitel werden pferdegestützte Interventionen bei PTBS im Detail betrachtet. Es werden die Rahmenbedingungen für solche Interventionen beschrieben und konkrete Ideen für die Umsetzung in der Praxis vorgestellt. Ein Fallbeispiel illustriert die Anwendung der Interventionen in der realen Welt.
Schlüsselwörter
Posttraumatische Belastungsstörung, Trauma, Traumapädagogik, Pferdegestützte Interventionen, Therapie, Symptome, Epidemiologie, Ätiologie, Diagnostik, Behandlung, Fallbeispiele
Häufig gestellte Fragen
Wie helfen Pferde bei Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS)?
Pferde bieten eine vorurteilsfreie Interaktion; die pferdegestützte Therapie hilft bei der emotionalen Stabilisierung und dem Aufbau von Vertrauen nach einem Trauma.
Was ist Traumapädagogik?
Traumapädagogik ist eine pädagogische Grundhaltung, die Symptome als Überlebensstrategien versteht und einen sicheren Rahmen für die Entwicklung der Betroffenen schafft.
Unterscheiden sich PTBS-Symptome bei Kindern und Erwachsenen?
Ja, Kinder zeigen Traumata oft durch regressives Verhalten, Spielwiederholungen oder spezifische Ängste, während Erwachsene häufiger unter Flashbacks und Vermeidungsverhalten leiden.
Welche Voraussetzungen gelten für pferdegestützte Interventionen?
Neben geeigneten Rahmenbedingungen (Pferdeausbildung, Sicherheit) ist oft eine begleitende klassische Psychotherapie oder medikamentöse Behandlung sinnvoll.
Was ist der Unterschied zwischen Trauma und PTBS?
Ein Trauma ist das belastende Ereignis selbst (seelische Wunde), während die PTBS eine mögliche langfristige psychische Erkrankung als Folge dieses Ereignisses darstellt.
- Citar trabajo
- Miriam Otto (Autor), 2016, Alternative Behandlungsmethoden bei Posttraumatischer Belastungsstörung. Pferdegestützte Interventionen und Reittherapien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351503