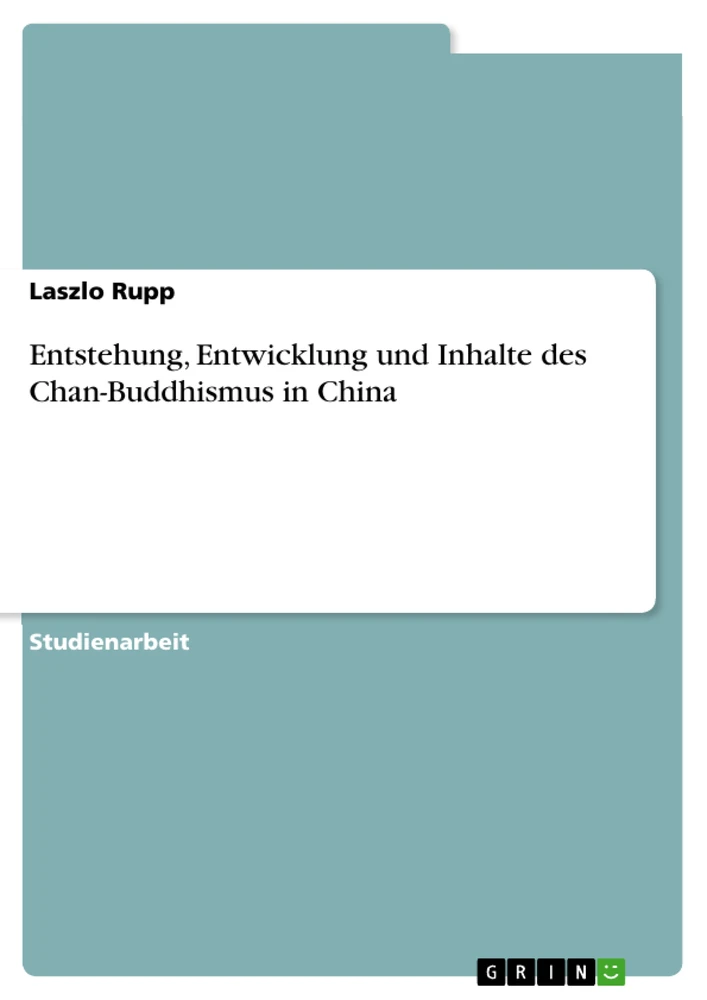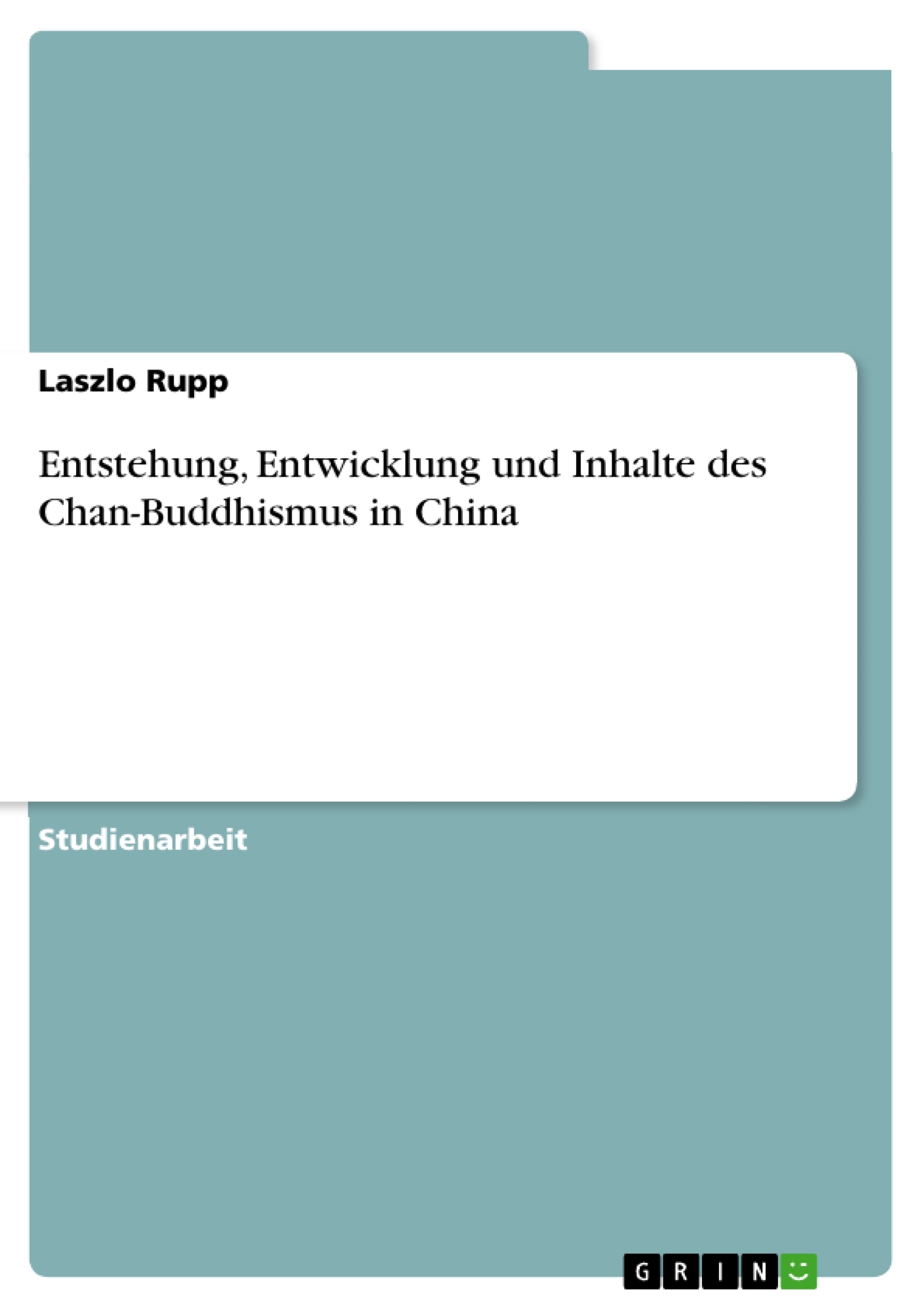Zen-Gärten - Zen-Meditation - Zen-Philosophie. In der westlichen Welt geht von diesen Begriffen eine gewisse Faszination aus. Wir verbinden sie mit Japan, mit sorgsam geharkten Gärten und einer östlichen und deshalb mystischen, schwer durchdringbaren Lebens- und Denkweise. Dass diese Begriffe etwas mit der Lehre des Buddhismus zu tun haben, ist wahrscheinlich noch weitgehend bekannt. Doch dass der Buddhismus zunächst nach China gelangte, dort eine beachtliche Transformation vollzog und erst dann Verbreitung in Japan fand, dürfte so manchem neu sein. In dieser Verschriftlichung meines Vortrags soll die Entstehung des Chan-Buddhismus nachvollziehbar gemacht werden und grundlegende Elemente der Glaubenslehre thematisiert werden.
Einleitend möchte ich die Geschichte des Chan-Buddhismus und seinen Weg von Indien nach China betrachten. Hierbei soll ein besonderes Augenmerk auf die Integration buddhistischer Lehren in die chinesische Kultur und das Zusammentreffen mit den Lehren des Daoismus und des Konfuzianismus gelegt werden. Anschließend erfolgt eine Einordnung des Chan-Buddhismus in die Schule des Mahayana-Buddhismus.
Die prominente Rolle der Glaubensväter des Chan-Buddhismus, der Patriarchen, wird anhand von den zwei herausragenden Chan-Meistern Bodhidharma und Hui Neng veranschaulicht, wobei ich im Falle von Hui Neng auch auf seine prägende reformatorische Arbeit für seine Glaubensrichtung eingehen will, die als Grundstein für die Herausbildung der Chan-Schule des Buddhismus angesehen wird. Im letzten abschließenden Kapitel soll die Praxis des Chan mittels der Sitzmeditation und dem Lösen paradoxer Lehrsätze behandelt werden, um verständlich zu machen, welche Umsetzung der wichtige Chan-Grundsatz der „unorthodoxen Lehre“ erfährt. Zuletzt möchte ich die neugewonnenen Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen und einen Ausblick zu möglichen weiteren Forschungsfeldern auf dem Gebiet des Chan-Buddhismus geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1) EINLEITUNG
- 2) VOM INDISCHEN „DHYANA“ ZUM CHINESISCHEN CHAN-BUDDHISMUS
- 3) VERORTUNG DES CHAN IN DEN SCHULEN DES BUDDHISMUS
- 4) DIE PATRIARCHEN DES CHAN
- 4.1) Der erste Patriarch Bodhidharma
- 4.2) Der sechste Patriarch Hui Neng
- 5) DIE PRAXIS DES CHAN
- 5.1) Die Sitzmeditation - Tso Chan
- 5.2) Das Lösen paradoxer Lehrsätze - Gongan
- 6) ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entstehung und Entwicklung des Chan-Buddhismus in China nachzuvollziehen und grundlegende Elemente seiner Lehre zu beleuchten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Integration buddhistischer Lehren in die chinesische Kultur und dem Zusammenspiel mit Daoismus und Konfuzianismus.
- Die Entwicklung des Chan-Buddhismus von Indien nach China.
- Die Integration des Buddhismus in die chinesische Kultur und sein Verhältnis zu Daoismus und Konfuzianismus.
- Die Rolle der Patriarchen des Chan-Buddhismus, insbesondere Bodhidharma und Hui Neng.
- Die Praxis des Chan, einschließlich Sitzmeditation und dem Lösen paradoxer Lehrsätze.
- Die verschiedenen Schulen und Strömungen innerhalb des Chan-Buddhismus.
Zusammenfassung der Kapitel
1) EINLEITUNG: Die Einleitung beschreibt die Faszination des Zen-Buddhismus im Westen und führt in die Thematik der Entstehung des Chan-Buddhismus in China ein. Sie umreißt die Ziele der Arbeit: die Nachverfolgung der Geschichte des Chan, die Betrachtung seiner Integration in die chinesische Kultur und die Erläuterung grundlegender Lehren. Der Fokus liegt auf der Integration buddhistischer Lehren in den chinesischen Kontext und dem Einfluss von Daoismus und Konfuzianismus. Die Arbeit verspricht eine detaillierte Untersuchung der Rolle der Patriarchen, der Chan-Praxis (Sitzmeditation und Gongan) und einen abschließenden Ausblick auf mögliche Forschungsfelder.
2) VOM INDISCHEN „DHYANA“ ZUM CHINESISCHEN CHAN-BUDDHISMUS: Dieses Kapitel behandelt die Ausbreitung des Mahayana-Buddhismus in China während der Han-Dynastie über die Seidenstraße. Es beleuchtet die Herausforderungen der Integration des Buddhismus in den bereits etablierten Daoismus und Konfuzianismus und die Notwendigkeit der Anpassung an die lokalen Gegebenheiten. Der Text beschreibt die Schwierigkeiten der Übersetzung buddhistischer Sutren und die Übernahme von Elementen des Daoismus, wie den Verzicht auf theoretische Erörterungen zugunsten von Beispielen und Anekdoten. Die Rolle von Meister Dao An als wichtiger Reformer wird hervorgehoben, der den Buddhismus an den Konfuzianismus anpasste und das Mönchsleben reformierte, was zur flächendeckenden Verbreitung des Buddhismus in China beitrug. Die Entwicklung der zwei Hauptströmungen des Chan (Südliche und Nördliche Schule) um 700 n. Chr. wird ebenfalls erörtert, wobei die Südliche Schule des Hui Neng mit ihrem Fokus auf plötzlichem Erwachen im Vordergrund steht. Die spätere Teilung in die „Fünf Häuser des Chan“ und deren unterschiedliche Praktiken werden kurz angerissen.
Schlüsselwörter
Chan-Buddhismus, Mahayana-Buddhismus, China, Daoismus, Konfuzianismus, Bodhidharma, Hui Neng, Sitzmeditation (Tso Chan), Gongan, Integration, Transformation, Patriarchen, Buddhistische Praxis, religiöse Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Chan-Buddhismus in China
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Chan-Buddhismus in China. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Entstehung und Entwicklung des Chan-Buddhismus, seiner Integration in die chinesische Kultur und seinen zentralen Praktiken.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entwicklung des Chan-Buddhismus von seinen indischen Wurzeln (Dhyana) bis zu seiner chinesischen Ausprägung. Es untersucht die Rolle wichtiger Patriarchen wie Bodhidharma und Hui Neng, die Integration des Buddhismus in den chinesischen Kontext (im Verhältnis zu Daoismus und Konfuzianismus), die wichtigsten Praktiken des Chan (Sitzmeditation – Tso Chan und das Lösen paradoxer Lehrsätze – Gongan), und die verschiedenen Schulen und Strömungen innerhalb des Chan-Buddhismus. Die Herausforderungen der Übersetzung buddhistischer Texte und die Anpassung an die chinesische Kultur werden ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Vom indischen „Dhyana“ zum chinesischen Chan-Buddhismus, Verortung des Chan in den Schulen des Buddhismus, Die Patriarchen des Chan (mit Unterkapiteln zu Bodhidharma und Hui Neng), Die Praxis des Chan (mit Unterkapiteln zu Sitzmeditation und Gongan) und Zusammenfassung und Ausblick.
Wer waren die wichtigsten Patriarchen des Chan-Buddhismus?
Das Dokument hebt insbesondere Bodhidharma (den ersten Patriarchen) und Hui Neng (den sechsten Patriarchen) hervor. Ihre Rolle in der Entwicklung und Ausprägung des Chan-Buddhismus wird detailliert untersucht.
Welche Praktiken des Chan-Buddhismus werden beschrieben?
Die wichtigsten beschriebenen Praktiken sind die Sitzmeditation (Tso Chan) und das Lösen paradoxer Lehrsätze (Gongan).
Wie ist der Chan-Buddhismus in die chinesische Kultur integriert worden?
Das Dokument untersucht die Integration des Chan-Buddhismus in die bereits bestehende chinesische Kultur, insbesondere sein Verhältnis zu Daoismus und Konfuzianismus. Es beschreibt die Herausforderungen der Übersetzung und Anpassung buddhistischer Lehren an den chinesischen Kontext und die Übernahme von Elementen aus dem Daoismus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen: Chan-Buddhismus, Mahayana-Buddhismus, China, Daoismus, Konfuzianismus, Bodhidharma, Hui Neng, Sitzmeditation (Tso Chan), Gongan, Integration, Transformation, Patriarchen, Buddhistische Praxis, religiöse Geschichte.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument verfolgt das Ziel, die Entstehung und Entwicklung des Chan-Buddhismus in China nachzuvollziehen und grundlegende Elemente seiner Lehre zu beleuchten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Integration buddhistischer Lehren in die chinesische Kultur und dem Zusammenspiel mit Daoismus und Konfuzianismus.
- Quote paper
- Laszlo Rupp (Author), 2016, Entstehung, Entwicklung und Inhalte des Chan-Buddhismus in China, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351307