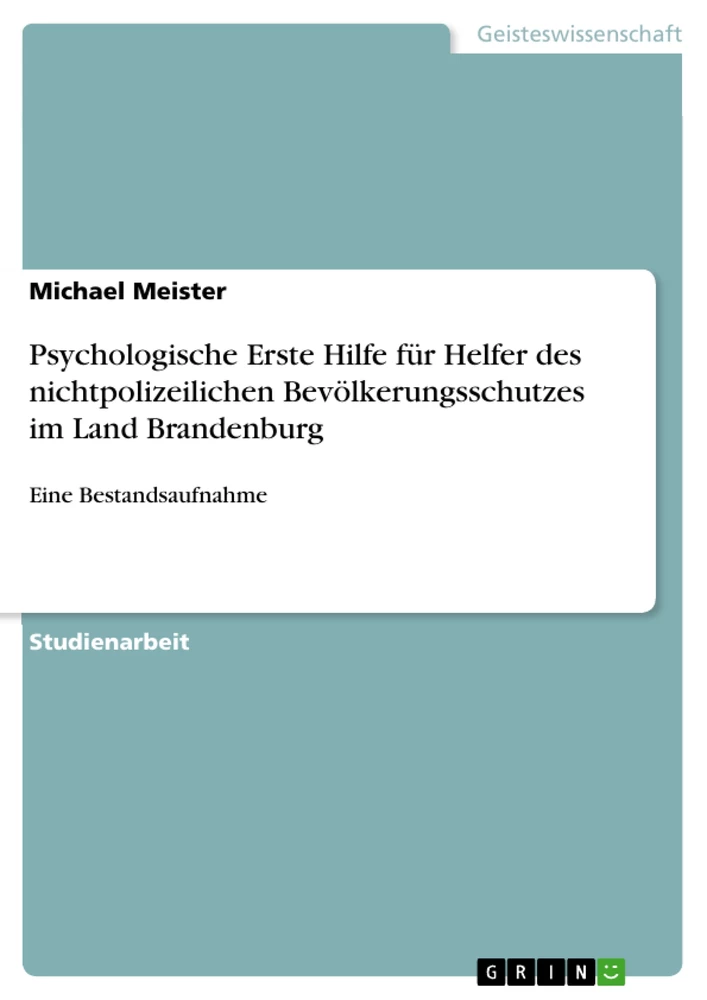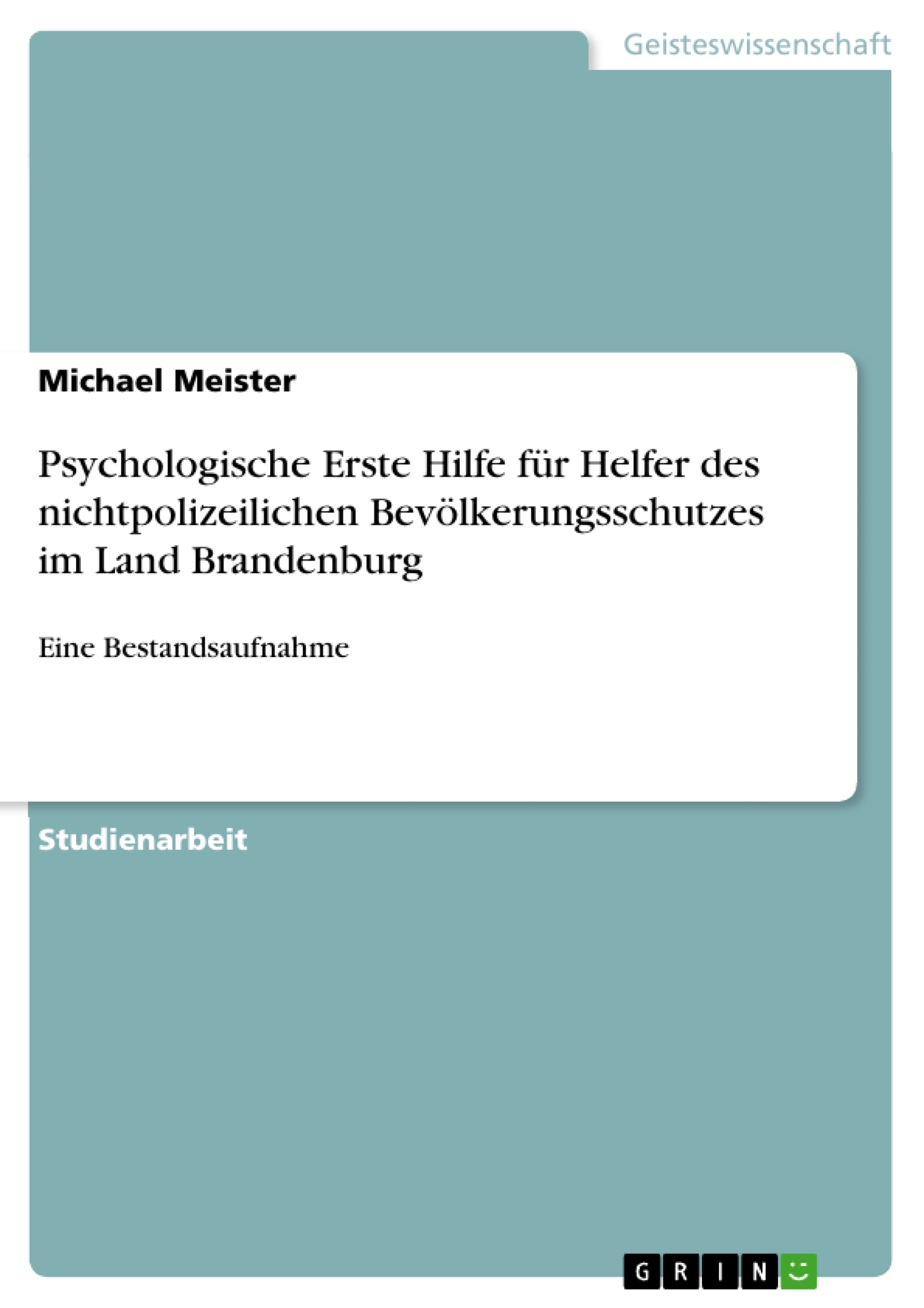Besonders nach schweren Unglücken, Großschadenslagen oder anderen, potentiell belastenden Einsätzen, sind es die Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz oder der Johanniter Unfallhilfe, die den Erstkontakt zu Überlebenden haben.
Die Notwendigkeit psychosozialer Notfallversorgung und Nothilfe von Betroffenen, also der Betrachtung und der Behandlung der Psyche eines Menschen, kann inzwischen als unbestritten angesehen werden und „sollte schon aus rein humanen Gründen [...] berücksichtigt werden“ (Lasogga & Okoniewski 2013, S.72). Jede Notfallsituation stellt für alle Betroffenen, also die direkten Notfallopfer, aber auch deren Angehörige, einen direkten Eingriff in das Leben dar. Auf einen Schlag kann sich der gesamte Alltag der Opfer ändern und weitere Konsequenzen für die Zukunft haben.
„Auch die Belastungen der Helfer, insbesondere die der Rettungsdienstmitarbeiter und Ärzte sowie die daraus resultierenden Folgen wurden in den 1980-er und 90-er Jahren zunehmend thematisiert [...]“ (Gasch & Lasogga 2011, S. 5). Dass auch Helfer nach Notfällen und Einsatzlagen Hilfe benötigen können, ist, Bernd Gasch zufolge, eine Ansicht, die sich immer weiter durchsetzt. So förderte beispielsweise das BMI Forschungsprojekte, welche der Prävention der Einsatzkräfte dienen sollen. Auch Frank Lasogga und Annalena Okoniewski stellten 2013 fest, dass es zwar Strukturen, Pläne und Konzepte für die PSNV von Notfallopfern nach Großschadenslagen und auch bei Individualnotfällen gibt, deren Umsetzung erfolgt in Deutschland aber zum Teil nur mangelhaft. Dies deckt sich mit den Eindrücken des Autors dieser Arbeit im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, die er durch eigene Tätigkeit in der Wasserrettung und durch Gespräche gewann. Seit Beginn der 2000er Jahre spricht die Berichterstattung in den Medien auch von den möglichen Belastungen der Helfer. Dennoch ist es fraglich, inwieweit die Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen im Land Brandenburg mit den Möglichkeiten der Psychologischen Ersten Hilfe und deren Anwendung vertraut sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgehensweise
- Psychische Erste Hilfe und Psychosoziale Notfallversorgung
- Psychische Erste Hilfe
- Psychosoziale Notfallversorgung
- PSNV und Einsatznachsorge im Land Brandenburg
- Helfergruppen
- PTBS-Prävalenzen verschiedener Helfergruppen
- Spontanhelfer
- Ehrenamtliche Helfer im Bevölkerungsschutz
- Professionelle Kräfte im Bevölkerungsschutz
- Zusammenfassung
- Psychologische Aspekte in der Ausbildung von Helfern
- Psychologische Aspekte in der Grundausbildung ehrenamtlicher Helfer
- Psychologische Aspekte in der Ausbildung zum Rettungssanitäter
- Psychologische Aspekte in der Ausbildung zum Notfallsanitäter
- Fazit
- PTBS-Prävalenzen verschiedener Helfergruppen
- Diskussion
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bereitstellung und Akzeptanz psychologischer Unterstützung im Bereich des nichtpolizeilichen Bevölkerungsschutzes im Land Brandenburg. Dabei wird insbesondere auf die psychische Belastung von Einsatzkräften, insbesondere ehrenamtlicher Helfer und Spontanhelfer, sowie die Notwendigkeit der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) fokussiert.
- Bestandsaufnahme der PSNV für Einsatzkräfte und Betroffene im Land Brandenburg
- Analyse von PTBS-Prävalenzen bei verschiedenen Helfergruppen, einschließlich Spontanhelfer
- Bewertung des Stellenwerts psychologischer Aspekte in der Ausbildung von Rettungskräften
- Identifizierung von Schwachstellen im System der PSNV im Land Brandenburg
- Entwicklung von Lösungsansätzen zur Verbesserung der Akzeptanz von PSNV-Angeboten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Relevanz der PSNV im Kontext von belastenden Einsätzen für Einsatzkräfte und Betroffene dar und beschreibt die Forschungslücke im Bereich der psychischen Unterstützung von Helfern im Land Brandenburg. Das Kapitel "Vorgehensweise" stellt den methodischen Ansatz der Arbeit dar, der auf einer Bestandsaufnahme des PSNV-Angebotes, der Analyse von Studien zu PTBS-Prävalenzen und dem Vergleich verschiedener Ausbildungsinhalte basiert. Das Kapitel "Psychische Erste Hilfe und Psychosoziale Notfallversorgung" definiert die beiden zentralen Konzepte und beleuchtet die Rolle der Einsatzkräfte in der PSNV. Anschließend werden in "Helfergruppen" verschiedene Helfergruppen, darunter Spontanhelfer, Ehrenamtliche und Professionelle, in Bezug auf PTBS-Prävalenzen und ihre Bedeutung im Bevölkerungsschutz untersucht. "Psychologische Aspekte in der Ausbildung von Helfern" befasst sich mit der Integration psychologischer Inhalte in unterschiedlichen Ausbildungsprogrammen. Die Diskussion und der Ausblick sollen schließlich Schwachstellen im System der PSNV im Land Brandenburg aufzeigen und Lösungsansätze für eine bessere Akzeptanz von PSNV-Angeboten vorstellen.
Schlüsselwörter
Psychische Erste Hilfe, Psychosoziale Notfallversorgung, PSNV, Bevölkerungsschutz, Einsatzkräfte, Ehrenamtliche, Spontanhelfer, PTBS, Ausbildung, Notfallpsychologie, Belastungen, Land Brandenburg
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Psychischer Erster Hilfe und PSNV?
Psychische Erste Hilfe umfasst die unmittelbare Betreuung nach einem Ereignis, während Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) ein umfassenderes Konzept für Betroffene und Einsatzkräfte zur Bewältigung traumatischer Erlebnisse ist.
Warum benötigen auch Helfer psychologische Unterstützung?
Einsatzkräfte sind oft mit schweren Unglücken und Leid konfrontiert, was zu posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) führen kann. Studien zeigen hohe Prävalenzraten bei verschiedenen Helfergruppen.
Welche Rolle spielen Spontanhelfer im Bevölkerungsschutz?
Spontanhelfer sind oft als Erste vor Ort, verfügen aber meist nicht über die psychologische Schulung professioneller Kräfte, was sie besonders vulnerabel für Belastungsfolgen macht.
Wie ist die Situation der PSNV im Land Brandenburg?
Die Arbeit untersucht die bestehenden Strukturen im Land Brandenburg und stellt fest, dass die Umsetzung und Akzeptanz von PSNV-Angeboten teilweise noch lückenhaft ist.
Werden psychologische Aspekte in der Rettungsdienst-Ausbildung gelehrt?
Ja, die Arbeit vergleicht die Ausbildungsinhalte von Rettungssanitätern und Notfallsanitätern hinsichtlich psychologischer Kompetenzen und identifiziert Verbesserungspotenzial.
- Citar trabajo
- Michael Meister (Autor), 2016, Psychologische Erste Hilfe für Helfer des nichtpolizeilichen Bevölkerungsschutzes im Land Brandenburg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351218