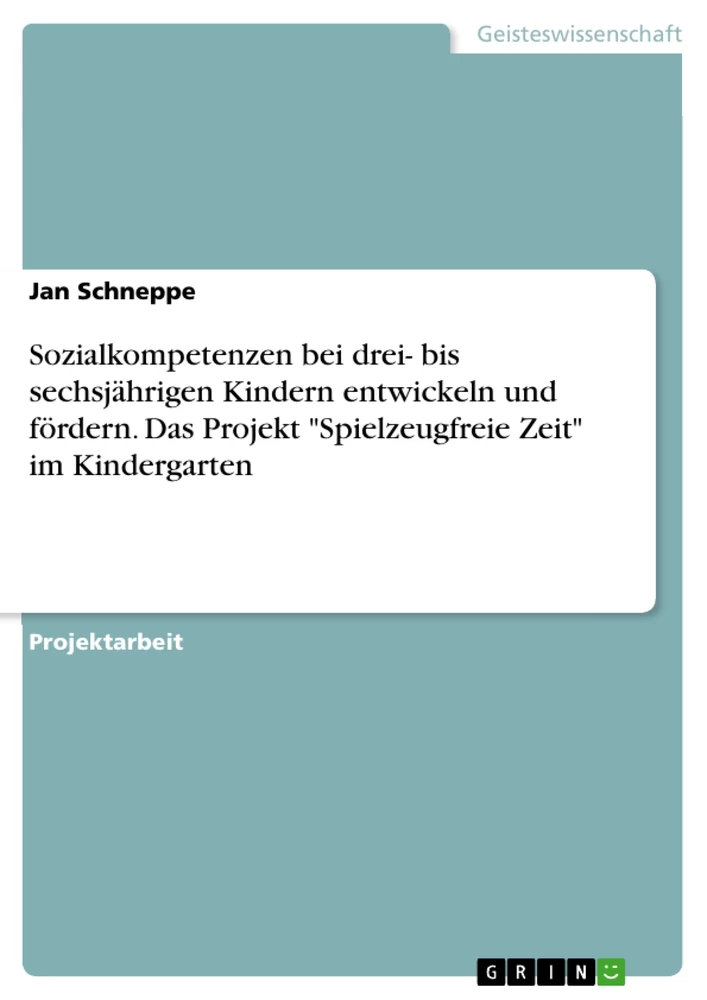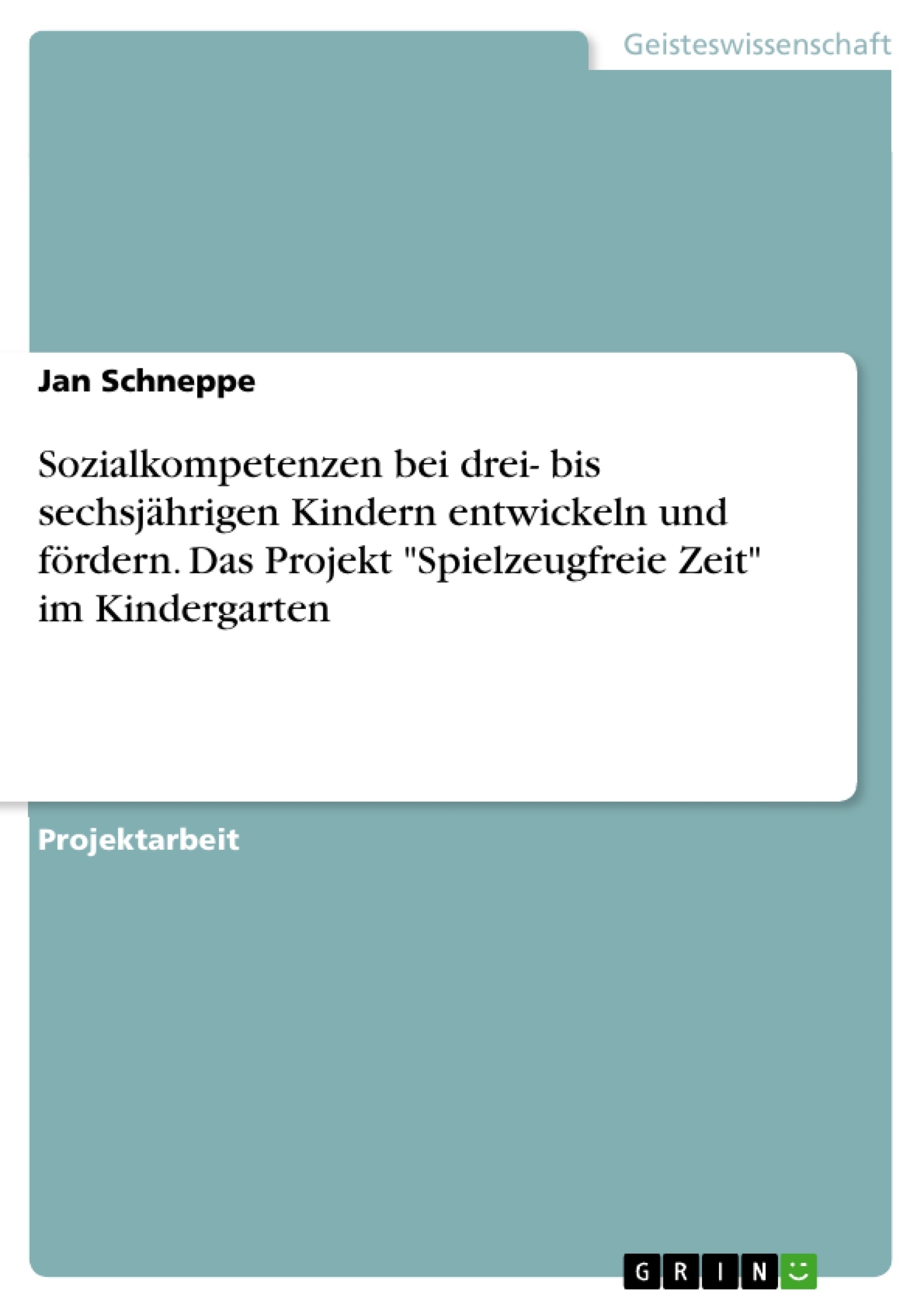Eine wesentliche Stellung in der modernen Pädagogik nimmt das Spiel ein. Was kann es bewirken und wie wichtig ist es für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder? In diesem Zusammenhang spielt die Entwicklung und Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen eine wichtige Rolle, wie auch die Herausbildung von Lebenskompetenzen im Kindergartenalter. Was ist das alles überhaupt und welche Sichtweisen gibt es zu diesen Themen? Ganz eng verbunden mit dem Spiel ist die Frage nach dem, dem kindlichen Entwicklungsstand angemessenes Spielzeug, also den Gegenständen mit denen gespielt wird. Stellen wir immer das "Richtige" zur Verfügung und wie und warum wird ohne Spielzeug gespielt?
Die Facharbeit nimmt im theoretischen Teil Bezug auf alle diese Fragen. Im Anschluss wird vom Projekt "Spielzeugfreier Kindergarten" berichtet, über Sinn und Herkunft der Idee aufgeklärt und die konkrete Durchführung in einem Berliner Kindergarten beschrieben, um dann in der Auswertung die Ergebnisse darzustellen. Sie belegen zweifelsfrei, wie wichtig und pädagogisch hilfreich dieses Projekt bei der Förderung und Entwicklung von sozialen Kompetenzen in der Elementarpädagogik sein kann, stellen aber auch dar, welche Bedingungen dafür gegeben sein müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ziel der Facharbeit und Themenbegründung
- 1.2 Sozialpädagogische Fragestellung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Die Bedeutung der Kompetenzentwicklung in der Elementarpädagogik
- 2.1 Erläuterungen von Sozialkompetenzen und emotionalem Verhalten
- 2.1.1 Bindungsverhalten
- 2.1.2 Emotion und Empathie
- 2.1.3 Zusammenhang von sozialer und emotionaler Kompetenz
- 2.2 Lebenskompetenzen, oder die Fähigkeit zum Handeln - Basis für die Schulfähigkeit
- 3. Die Bedeutung des „Spielens“ für die kindliche Entwicklung
- 3.1 Zum Begriff Spielen und Formen des Spiels
- 3.2 Zur Qualität des Spielzeugs im Hinblick auf Lernprozesse
- 3.3 Entwicklungsförderndes oder -hemmendes Spielzeug und zu Fragen des Überangebots
- 4. Entwicklungsimpuls „Spielzeugfreie Zeit“ (SFZ) im Kindergarten
- 4.1 Allgemeine Betrachtungen zur SFZ
- 4.2 Die Rolle der Erzieherinnen im Konzept der SFZ
- 4.3 Förderung der sechs Bildungsbereiche des BBP (2014)
- 4.4 Die SFZ - Gelegenheit zur Partizipation für Kinder und Eltern
- 5. Durchführung der SFZ nach der Methode von Anna Winner
- 5.1 Rahmenbedingungen im Kindergarten in einer großen Stadt
- 5.2 Erfahrung mit der Methode der SFZ in der Einrichtung
- 5.3 Die Zusammenarbeit des Teams während des Projektes
- 6. Darstellung der Beobachtungsergebnisse während des Projektes und danach (Dokumentationen)
- 6.1 Fragebögen und Interviews
- 6.2 Auswertung und Abbildung der gruppenspezifischen Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit untersucht die Auswirkungen der „Spielzeugfreien Zeit“ (SFZ) nach Anna Winner auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren in einer städtischen Kindertagesstätte. Ziel ist es, die Methode in ihrer praktischen Anwendung darzustellen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis zu ziehen. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie die SFZ die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen fördert.
- Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Kindern
- Die Rolle des Spiels ohne vorgefertigtes Spielzeug
- Anwendung der SFZ-Methode nach Anna Winner
- Beobachtung und Auswertung der Ergebnisse
- Implikationen für die pädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Facharbeit, die Untersuchung der „Spielzeugfreien Zeit“ (SFZ) nach Anna Winner in einer konkreten Kindertagesstätte. Der Fokus liegt auf der Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Autorin erläutert ihre Motivation für die Wahl dieses Themas, basierend auf ihren Erfahrungen im Praktikum und ihrer vorherigen Tätigkeit in der Abenteuerpädagogik. Die sozialpädagogischen Fragestellungen werden formuliert: Kann die SFZ das sozial-emotionale Verhalten nachhaltig positiv beeinflussen und haben Kinder ein natürliches Interesse am Spiel ohne vorgefertigtes Spielzeug?
2. Die Bedeutung der Kompetenzentwicklung in der Elementarpädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Kompetenzentwicklung in der Elementarpädagogik. Es definiert den umfassenden Begriff „Kompetenz“, der nicht nur Wissen und Können, sondern auch Haltungen, Gefühle, Werte und Motivationen umfasst. Der Zusammenhang zwischen Kompetenzentwicklung und dem Berliner Bildungsprogramm wird hergestellt. Das Kapitel betont die Bedeutung von Kompetenzen für selbständiges und verantwortliches Handeln.
3. Die Bedeutung des „Spielens“ für die kindliche Entwicklung: Kapitel 3 befasst sich mit der Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung. Es untersucht den Begriff „Spielen“ und seine verschiedenen Formen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Qualität von Spielzeug und den potenziellen Auswirkungen von Überangebot an Spielzeug auf die Entwicklung. Der Abschnitt analysiert, wie Spielzeug die Entwicklung fördern oder hemmen kann.
4. Entwicklungsimpuls „Spielzeugfreie Zeit“ (SFZ) im Kindergarten: Dieses Kapitel stellt das Konzept der „Spielzeugfreien Zeit“ (SFZ) vor. Es beleuchtet allgemeine Aspekte der SFZ, die Rolle der Erzieherinnen und die Förderung der sechs Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms im Kontext der SFZ. Weiterhin wird die Partizipation von Kindern und Eltern an der SFZ thematisiert.
5. Durchführung der SFZ nach der Methode von Anna Winner: Kapitel 5 beschreibt die praktische Durchführung der SFZ in der untersuchten Kindertagesstätte. Es werden die Rahmenbedingungen, die Erfahrungen mit der Methode und die Zusammenarbeit im Team während des Projekts detailliert dargestellt.
Häufig gestellte Fragen zur Facharbeit: Auswirkungen der Spielzeugfreien Zeit (SFZ) nach Anna Winner
Was ist das Thema der Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die Auswirkungen der „Spielzeugfreien Zeit“ (SFZ) nach Anna Winner auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren in einer städtischen Kindertagesstätte. Ziel ist es, die Methode in ihrer praktischen Anwendung darzustellen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis zu ziehen.
Welche Fragestellungen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Frage ist, ob und wie die SFZ die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen fördert. Weitere Fragestellungen betreffen die Bedeutung der Kompetenzentwicklung in der Elementarpädagogik, die Rolle des Spiels ohne vorgefertigtes Spielzeug, die praktische Anwendung der SFZ-Methode und die Auswertung der Beobachtungsergebnisse.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit kombiniert Literaturrecherche mit einer empirischen Untersuchung in einer Kindertagesstätte. Es wurden Beobachtungen durchgeführt und die Ergebnisse mithilfe von Fragebögen und Interviews dokumentiert und ausgewertet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Bedeutung der Kompetenzentwicklung in der Elementarpädagogik, Bedeutung des Spielens für die kindliche Entwicklung, Entwicklungsimpuls „Spielzeugfreie Zeit“ (SFZ) im Kindergarten, Durchführung der SFZ nach der Methode von Anna Winner und Darstellung der Beobachtungsergebnisse.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit (Zusammenfassung)?
Die Zusammenfassung der Ergebnisse ist im Kapitel 6 ("Darstellung der Beobachtungsergebnisse während des Projektes und danach (Dokumentationen)") enthalten und umfasst die Auswertung von Fragebögen und Interviews sowie die gruppenspezifischen Ergebnisse. Die konkreten Ergebnisse werden in der vollständigen Facharbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im letzten Kapitel gezogen und geben Aufschluss darüber, ob die SFZ die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder positiv beeinflusst hat und welche Implikationen sich für die pädagogische Praxis ergeben.
Wer ist die Zielgruppe der Arbeit?
Die Zielgruppe der Arbeit sind Pädagogen, Erzieher, Studenten der Sozialpädagogik und alle Interessierten, die sich mit der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern und der Bedeutung des Spiels auseinandersetzen.
Welche Rolle spielt das Berliner Bildungsprogramm (BBP)?
Das Berliner Bildungsprogramm (BBP) wird im Kontext der Förderung der sechs Bildungsbereiche im Rahmen der Spielzeugfreien Zeit (SFZ) erwähnt und dient als Bezugspunkt für die pädagogische Einordnung der Methode.
Wie wird die Methode von Anna Winner beschrieben?
Die Methode der Spielzeugfreien Zeit nach Anna Winner wird in Kapitel 5 detailliert beschrieben, inklusive der praktischen Umsetzung in der untersuchten Kindertagesstätte, den Rahmenbedingungen und der Zusammenarbeit im Team.
Welche Rolle spielt die Partizipation von Kindern und Eltern?
Die Partizipation von Kindern und Eltern an der SFZ wird in Kapitel 4 thematisiert, wobei betont wird, dass die SFZ auch eine Gelegenheit zur gemeinsamen Gestaltung und Partizipation bietet.
- Quote paper
- Jan Schneppe (Author), 2016, Sozialkompetenzen bei drei- bis sechsjährigen Kindern entwickeln und fördern. Das Projekt "Spielzeugfreie Zeit" im Kindergarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351068