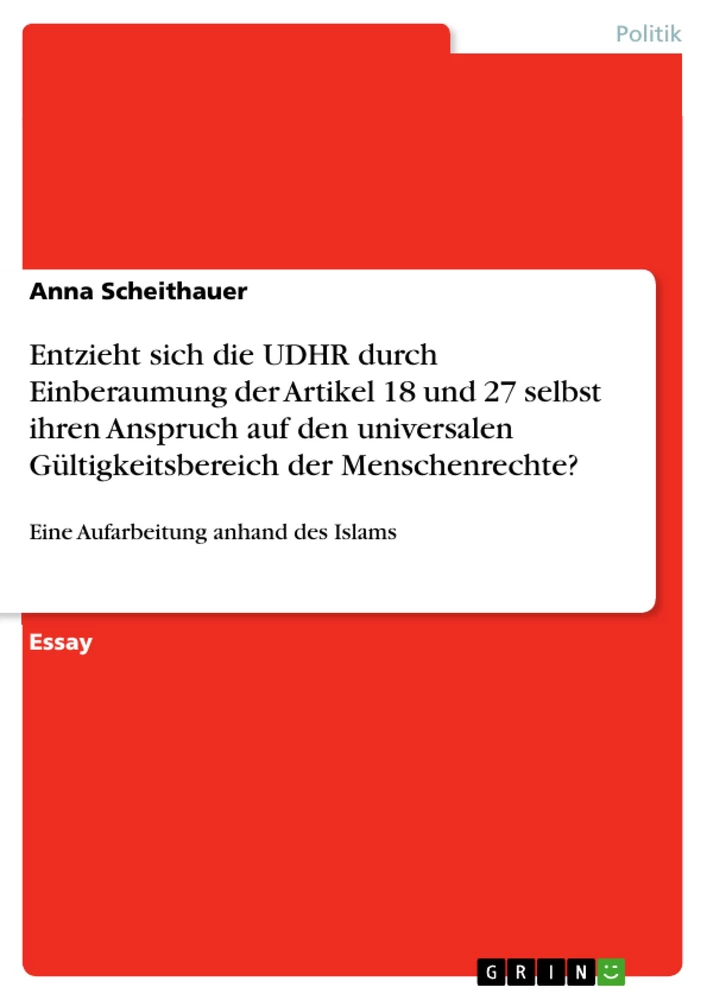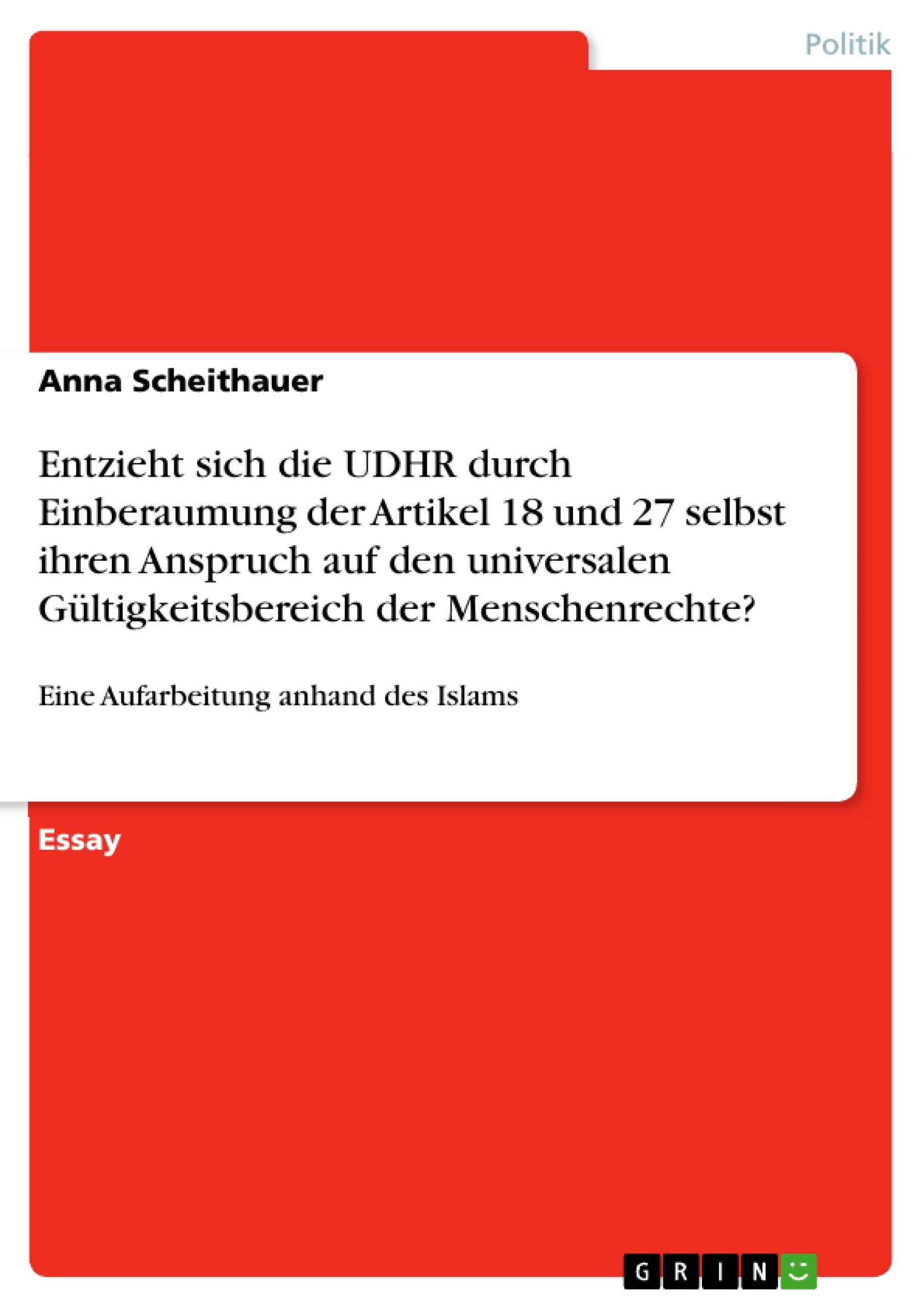Als Ausgangsbasis für den universalen im Kontrast zum religions- und kulturrelativistischen Menschrechtsdiskurs in der nachfolgenden Aufarbeitung dient das Globalisierungsphänomen mit seinen zunehmenden Migrationsströmen, die häufig zu einem Aufeinanderprallen vieler unterschiedlicher Kulturen führen. Speziell die Konfrontation der morgenländischen mit der abendländischen Kultur steht oft im Zeichen des Konflikts und ist gesellschaftspolitisch speziell in Westeuropa aufgrund der verstärkten Immigration muslimisch Gläubiger und daher auch des allmählichen Wachstums der Muslimen Gemeinschaft in Europa, relevant.
Der Focus darf hierbei aber nicht nur auf innerstaatliches eingeschränkt werden, sondern muss sich besonders auch auf die globale Reichweite interstaatlicher Interdependenz richten.
Unter Anbetracht der Relevanz zum globalen Menschrechtsverständnis verkörpert das Forschungsexposé in dieser Hinsicht eine Analyse zur jeweiligen Auffassung der universalistischen und der kulturrelativistischen Perspektive, wobei überprüft wird, ob sich diese beiden Auffassungen tatsächlich einer Exklusivität erfreuen, die ein gemeinsames einheitliches Bestreben ausschließt. Dabei wird das Spektrum der kulturrelativistischen Argumentation im Verlauf der Arbeit auf jene des Islams eingegrenzt, um auch ein spezifisches Beispiel etwas detailreicher dem Universalitätsprinzip gegenüberstellen zu können. Insbesondere dienen die Universal Declaration of Human Rights und die Cairo Declaration of Human Rights, welche Ausdruck der traditionellen oder auch fundamentalistischen Ausübung des Islams ist, als Basisliteratur zur Aufarbeitung des jeweiligen Menschrechtsverständnisses.
Die entscheidenste Frage, und daher auch zentrales Element des Forschungsexposés, die durch die Argumentation letztendlich aufgeklärt wirdl, ist jene, ob sich die UDHR selbst die Basis zur Universalität durch Einberaumung des Rechts auf Kultur und der Religionsfreiheit entzieht, oder ob diese als eigentliche Voraussetzung für Universalität zu betrachten sind. Die Beantwortung dieser Frage wird speziell in der Konklusion nachgegangen und ist somit Resultat der Aufarbeitung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Universalität und/oder kultureller Pluralismus
- Der Islam und die Menschenrechte
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Forschungsexposé analysiert den Konflikt zwischen dem universalistischen Anspruch der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR) und kulturrelativistischen Perspektiven, insbesondere im Kontext des Islam. Es untersucht, ob die Einbeziehung von Artikeln zur Religions- und Kulturfreiheit (Artikel 18 und 27) die Universalität der UDHR untergräbt oder vielmehr eine Voraussetzung dafür darstellt.
- Der Konflikt zwischen Universalität und kulturellem Relativismus im Menschenrechtsdiskurs
- Die Rolle der Religionsfreiheit (Artikel 18 der UDHR) im Kontext der Universalität
- Die Kompatibilität der UDHR mit kulturellen und religiösen Traditionen, insbesondere im Islam
- Kritik am kulturellen Relativismus und seine potenziellen Folgen
- Die Bedeutung des Schutzes der Schwachen und der Selbstbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung legt den Fokus auf die zunehmende Konfrontation verschiedener Kulturen im Zuge der Globalisierung, insbesondere den Konflikt zwischen westlichen und morgenländischen Kulturen, hervorgerufen durch verstärkte muslimische Immigration in Westeuropa. Sie unterstreicht die globale Reichweite interstaatlicher Interdependenz und die Bedeutung des globalen Menschrechtsverständnisses. Das Exposé analysiert die universalistische und kulturrelativistische Perspektive und untersucht, ob diese sich gegenseitig ausschließen. Der Fokus wird auf den Islam als spezifisches Beispiel eingegrenzt, wobei die UDHR und die Kairoer Erklärung der Menschenrechte als Basisliteratur dienen. Die zentrale Forschungsfrage ist, ob die UDHR durch die Einbeziehung des Rechts auf Kultur und Religionsfreiheit ihren Anspruch auf Universalität untergräbt oder diese sogar voraussetzt.
Universalität und/oder kultureller Pluralismus: Dieses Kapitel diskutiert den Konflikt zwischen Universalisten und Kulturalisten im Menschenrechtsdiskurs. Kulturalisten sehen Universalität als kulturellen Imperialismus, während Universalisten auf die Entstehungsgeschichte der UDHR und das Gleichheitsprinzip verweisen. Das Kapitel beleuchtet die Kritik am kulturellen Relativismus, der oft zur Benachteiligung Schwächerer und zum Schutz repressiver Eliten verwendet wird. Es wird argumentiert, dass die globale Gültigkeit der Menschenrechte unabdingbar für den Schutz der Schwachen und die uneingeschränkte Ausübung der eigenen Kultur ist. Artikel 27 der UDHR, der das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben garantiert, wird in diesem Kontext diskutiert. Schließlich wird die Problematik der religiösen Aspekte und deren potenzielle Inkompatibilität mit der UDHR angesprochen, insbesondere im Hinblick auf Artikel 18 (Religionsfreiheit).
Schlüsselwörter
Menschenrechte, Universalität, kultureller Relativismus, Islam, UDHR, Kairoer Erklärung der Menschenrechte, Religionsfreiheit, Kulturfreiheit, Globalisierung, Immigration, Gleichheit, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen zu: Forschungsexposé - Universalität und kultureller Pluralismus im Kontext des Islam
Was ist der Gegenstand dieses Forschungsexposés?
Das Exposé analysiert den Konflikt zwischen dem universalistischen Anspruch der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UDHR) und kulturrelativistischen Perspektiven, insbesondere im Kontext des Islam. Es untersucht, ob die Einbeigung von Artikeln zur Religions- und Kulturfreiheit die Universalität der UDHR untergräbt oder eine Voraussetzung dafür darstellt.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind der Konflikt zwischen Universalität und kulturellem Relativismus im Menschenrechtsdiskurs, die Rolle der Religionsfreiheit (Artikel 18 der UDHR), die Kompatibilität der UDHR mit kulturellen und religiösen Traditionen (insbesondere im Islam), Kritik am kulturellen Relativismus und seine Folgen, sowie die Bedeutung des Schutzes der Schwachen und der Selbstbestimmung.
Welche Kapitel umfasst das Exposé?
Das Exposé gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Universalität und/oder kulturellem Pluralismus, ein Kapitel zum Islam und den Menschenrechten und eine Konklusion. Die Einleitung betont die zunehmende Konfrontation verschiedener Kulturen durch Globalisierung und muslimische Immigration. Das Kapitel zu Universalität und Pluralismus diskutiert den Konflikt zwischen Universalisten und Kulturalisten. Das Kapitel zum Islam und den Menschenrechten befasst sich mit der Kompatibilität der UDHR mit islamischen Traditionen.
Welche Quellen werden verwendet?
Als Basisliteratur dienen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UDHR) und die Kairoer Erklärung der Menschenrechte.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Untergräbt die UDHR durch die Einbeziehung des Rechts auf Kultur und Religionsfreiheit ihren Anspruch auf Universalität, oder setzt sie diese sogar voraus?
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Exposé?
Schlüsselwörter sind: Menschenrechte, Universalität, kultureller Relativismus, Islam, UDHR, Kairoer Erklärung der Menschenrechte, Religionsfreiheit, Kulturfreiheit, Globalisierung, Immigration, Gleichheit, Selbstbestimmung.
Welche Kritikpunkte am kulturellen Relativismus werden angesprochen?
Das Exposé kritisiert den kulturellen Relativismus, da er oft zur Benachteiligung Schwächerer und zum Schutz repressiver Eliten genutzt wird. Es wird argumentiert, dass die globale Gültigkeit der Menschenrechte unabdingbar für den Schutz der Schwachen und die uneingeschränkte Ausübung der eigenen Kultur ist.
Wie wird Artikel 27 der UDHR im Kontext des Exposés behandelt?
Artikel 27 der UDHR, der das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben garantiert, wird im Kontext der Diskussion um die globale Gültigkeit der Menschenrechte und den Schutz der eigenen Kultur behandelt.
Wie wird die Rolle der Religionsfreiheit (Artikel 18 der UDHR) dargestellt?
Die Rolle der Religionsfreiheit wird im Kontext der Universalität der Menschenrechte und ihrer potenziellen Inkompatibilität mit bestimmten kulturellen und religiösen Traditionen diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Anna Scheithauer (Autor:in), 2009, Entzieht sich die UDHR durch Einberaumung der Artikel 18 und 27 selbst ihren Anspruch auf den universalen Gültigkeitsbereich der Menschenrechte?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350705