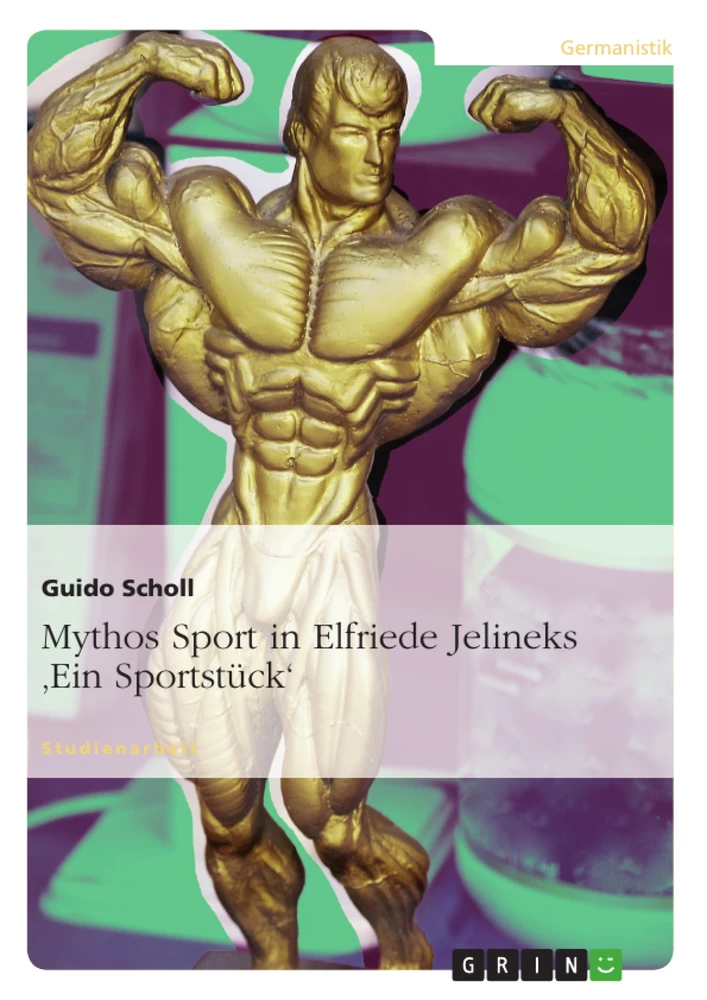Elfriede jelinek und der Sport – das ist eine ganz besondere Beziehung. Innig und voller Ablehnung. Und geprägt von einer distanzierten Faszination. Denn was Jelinek am Massenphänomen Sport kritisiert, das schreibt sie der Gesellschaft ins Buch. Ausgewählt hat Jelinek ein Motiv aus dem Sport, bei dem Masse das Grundprinzip ist. Der österreichische Bodybuilder Andreas Münzer starb Mitte der 90er Jahre an seinem Streben nach Muskelmasse. Von dieser individuellen Masse reflektiert Jelinek auf Zuschauermassen, dargestellt als Chöre. Damit vollzieht die Nobelpreisträgerin den Rückschluss auf den Ursprung des Sports – die Antike. Ist moderner Sport lediglich die per Chemie und Technologie pervertierte Zuspitzung des Grundgedankens von Wettkampf/Gewalt?
In dieser Arbeit wird nachgezeichnet, wie Jelinek das Thema Sport in der Moderne Stück für Stück seziert. Wortgewaltig und bildgewaltig. Bezüge auf Roland Barthes und Marieluise Fleißer zeigen unter anderem, dass Jelineks Kritik zwar nicht völlig neu, sehr wohl aber völlig neuartig formuliert ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mythendestruktion: Jelinek und Barthes
- Mythos Sport und Barthes' Verhältnis zur Tour de France
- „Ein Sportstück“ und der Mythos Sport
- „Ein Sportstück“ im kulturellen und literarischen Kontext
- „Ein Sportstück“ und das Thema Religion
- Sport als Religionsersatz
- „Info ohne Empfänger“
- Verfall und Nabelschau: Jelinek, Kirchhoff, von Dueffel
- Der Chemiebaukasten
- Eine Geschichte des Dopings: „War Achill gedopt?“
- Doping als Mythendestruktion
- Männlichkeit vs. Weiblichkeit?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Theaterstück „Ein Sportstück“ von Elfriede Jelinek untersucht den Sportfanatismus der heutigen Zeit und analysiert die Mythisierung des Sports, die in der modernen Gesellschaft eine zentrale Rolle spielt. Jelinek präsentiert eine kritische Analyse, die sich auf die österreichische Sportlandschaft fokussiert und dabei diverse Themenfelder beleuchtet, die im Zusammenhang mit dem Sport stehen.
- Mythisierung des Sports und ihre Dekonstruktion
- Verhältnis von Sport und Religion
- Körperlichkeit und Verfall in der Sportkultur
- Doping im Sport und seine gesellschaftliche Bedeutung
- Geschlechterrollen und ihre Repräsentation im Sport
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Ein Sportstück“ und die Bedeutung des Sports in der heutigen Gesellschaft ein. Sie beleuchtet den Sport als vermeintliche „Haupt- und nicht Nebensache“ und zeigt die vielfältigen Einflüsse, die er auf unsere Gesellschaft ausübt. Der Fokus liegt dabei auf der Dekonstruktion von Mythen, die sich um den Sport gebildet haben.
Das zweite Kapitel beleuchtet das Werk von Roland Barthes und seine Analyse der Mythisierung. Es zeigt auf, wie die Theorien von Barthes, insbesondere zum Thema „Mythen des Alltags“, sich auf die Analyse von Jelineks „Ein Sportstück“ übertragen lassen. Die Autoren werden hinsichtlich ihrer Dekonstruktionsstrategien verglichen und ihre Kritik an der Mythisierung der modernen Gesellschaft herausgestellt.
Das dritte Kapitel analysiert „Ein Sportstück“ im kulturellen und literarischen Kontext. Es beleuchtet die Verbindung von Sport und Religion und die Rezeption des Themas im Werk. Das Kapitel diskutiert außerdem die Themen des Verfalls und der Nabelschau, die Jelinek im Stück verarbeitet und setzt diese mit anderen zeitgenössischen Texten in Beziehung. Darüber hinaus befasst es sich mit dem Thema Doping und seiner Bedeutung für die Mythisierung des Sports.
Schlüsselwörter
Das Stück beleuchtet die Mythisierung des Sports und die Dekonstruktion dieser Mythen im Werk Elfriede Jelineks. Schlüsselbegriffe sind: Sport, Mythendestruktion, Religion, Körperverfall, Doping, Männlichkeit, Weiblichkeit, Gesellschaft, Kultur, Österreich.
- Quote paper
- Guido Scholl (Author), 2002, Mythos Sport in Elfriede Jelineks 'Ein Sportstück', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34934