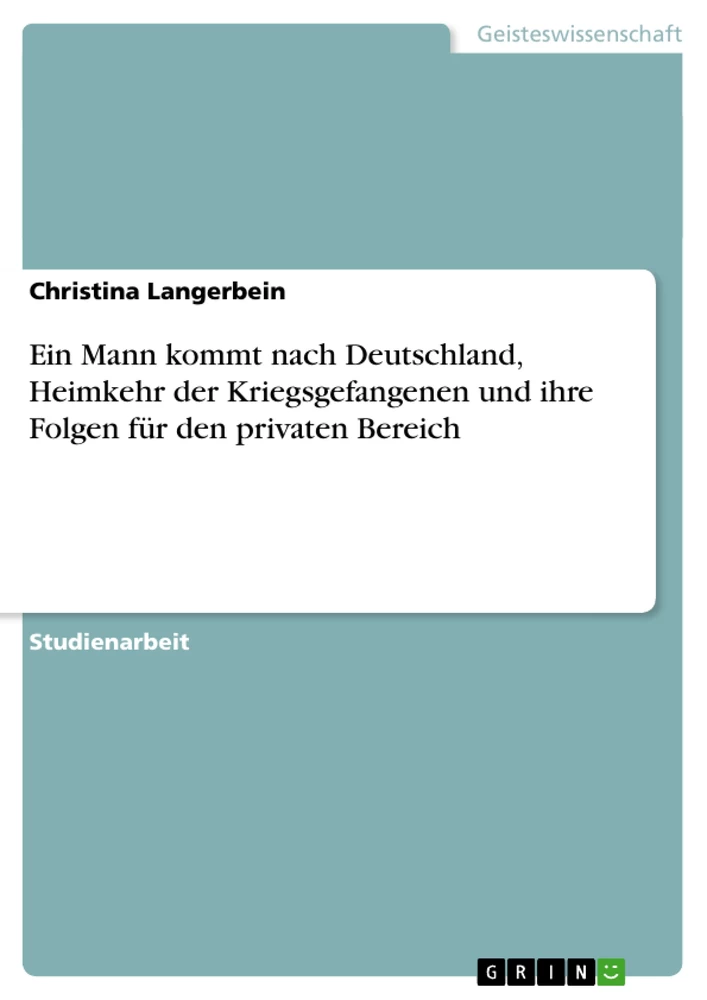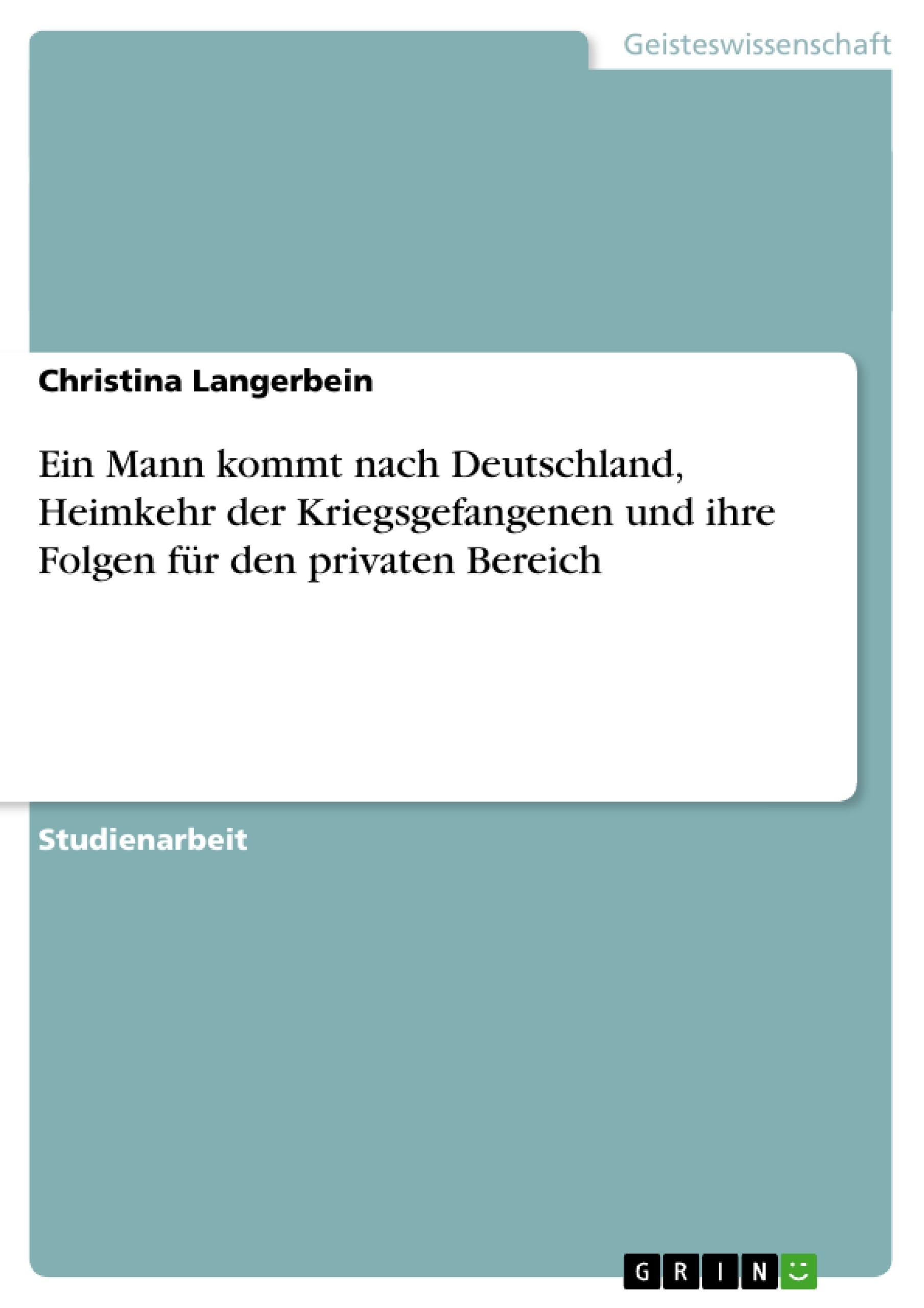Die Folgen des zweiten Weltkrieges werfen immer noch dunkle Schatten auf unsere Gegenwart. "Die Vergangenheit scheint nicht vergehen zu wollen." Doch ist es unzweifelhaft wichtig, gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem die letzte Generation, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, verstirbt, sich auf die vergangenen Ereignisse zu besinnen. Vergessen sollte man nicht, auch wenn man das Privileg "der späten Geburt" inne hat, dass die Kriegsfolgen nicht in den 50er Jahren getilgt wurden, sondern in vielen Familien in Verhaltens- und Reaktionsmustern tradiert wurden und somit auch heute noch präsent sind.
Unsere heutige Elterngeneration wuchs in den Nachkriegswirren auf , viele Kinder sahen ihren Vater erst viele Jahre nach ihrer Geburt zum ersten Mal, als er als Kriegsheimkehrer nach Hause kam- geprägt von den Erfahrungen des Kriegs und der Gefangenschaft. Für die Kinder war der Vater fremd, und auch die Eltern hatte sich durch die Jahre und die unterschiedlichen Erfahrungen entfremdet. Oft resultierten Entfremdung, Unverständnis für einander, Frustration über die "verlorenen" Jahre und deren psychische und physische Folgen in starke Konflikte, die für die gesamte Familien belastend waren. In vielen Fälle verschärften die herrschende Gesetzgebung und stagnierende Sozialpolitik noch die Konfliktsituationen, da sie sich an alten Gesellschaftsmustern orientierten, und "nur alte Antworten" auf neue Fragen geben konnten. Nichtsdestotrotz setzte der Staat alle Hoffnungen auf die gesellschaftliche Reintegration der Heimkehrer durch Integration in die Familien, die Kriegsfolgen wurden somit "privatisiert" ( Vera Neumann., 1999). Welche Auswirkungen diese Strategie für die Familien der Heimkehrer hatte, möchte ich in dieser Arbeit diskutieren.
Im ersten Teil soll ein Überblick gegeben werden über die offizielle Wahrnehmung der Heimkehrer und die Deutung ihrer Rückkehr. Inwieweit diese euphemistische Argumentation in der familiären Realität an ihre Grenzen stieß, soll im Hauptteil der Arbeit dargestellt werden. Dabei werden drei Konfliktfelder näher beleuchtet: die Bedeutung der Heimkehr für ( Ehe)Mann und ( Ehe)Frau, die Auswirkungen der Heimkehr auf die Kinder des Paares, und die Problematik, die sich für den Heimkehrer und seine Familie ergibt bei einer ( kriegsbedingten) psychischen Erkrankung des Heimkehrers.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aspekte der Heimkehr
- Heimat
- Öffentliche Deutung der Heimkehr
- Viktimisierung
- "Überlebende des Totalitarismus"
- Moralische Integration der Überlebenden
- Praktische, soziale Integration der Überlebenden
- Kriegsfolgen als Belastung für die Familie
- Konfliktfeld: Heimkehrer-Ehefrau
- Entfremdung
- Arbeitsunfähigkeit
- Konfliktfeld: Heimkehrer-Kinder
- Konfliktfeld: Heimkehrer-Ehefrau
- Der Gesundheitszustand der Heimkehrer
- Dystrophie
- Deutung von bleibenden psychischen Leiden
- Auswirkungen auf die Familien
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Heimkehr deutscher Kriegsgefangener nach dem Zweiten Weltkrieg auf den privaten Bereich, insbesondere auf die Familien. Sie beleuchtet die offizielle Wahrnehmung der Heimkehrer und analysiert die daraus resultierenden Konflikte innerhalb der Familienstrukturen.
- Die öffentliche Deutung der Heimkehr und die Viktimisierung der Heimkehrer
- Die Belastungen für Familien durch die Kriegsfolgen
- Konflikte zwischen Heimkehrern und ihren Ehefrauen/Kindern
- Der Gesundheitszustand der Heimkehrer und dessen Auswirkungen auf die Familien
- Die Rolle der staatlichen Politik in der Reintegration der Heimkehrer
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den anhaltenden Einfluss des Zweiten Weltkriegs auf die Nachkriegsgeneration und hebt die Bedeutung der Auseinandersetzung mit den Kriegsfolgen hervor. Sie fokussiert auf die Herausforderungen der Reintegration von Kriegsheimkehrern in ihre Familien und die daraus resultierenden Konflikte, die durch gesellschaftliche und staatliche Faktoren verstärkt wurden. Die Arbeit kündigt die Analyse der offiziellen Wahrnehmung der Heimkehrer und die Untersuchung der familiären Auswirkungen an.
1. Aspekte der Heimkehr: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Situation der elf Millionen deutschen Kriegsgefangenen, ihre Internierung in verschiedenen Ländern und den zeitlichen Verlauf ihrer Heimkehr. Es stellt die unterschiedlichen Erfahrungen der Gefangenen in den Lagern des Ostblocks und der westlichen Alliierten heraus und betont die schrittweise Freilassung, die erst mit dem Abbau der politischen Spannungen abgeschlossen war.
1.1 Heimat: Unter Bezugnahme auf Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür" wird die Kluft zwischen der erhofften und der tatsächlichen Heimkehr der Soldaten beleuchtet. Das Kapitel verdeutlicht die Enttäuschung und den Bruch der Erwartungen, die viele Heimkehrer erlebten, und stellt die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Reintegration und die Bemühungen des Staates um eine "Remaskulinisierung" der Heimkehrer in den Mittelpunkt.
2. Öffentliche Deutung der Heimkehr und die "Remaskulinisierung" Deutschlands: Dieses Kapitel analysiert die öffentliche Reaktion auf die Heimkehr der Soldaten, die zunächst als Opfer des Totalitarismus wahrgenommen wurden. Die Diskussion um die "Dystrophie" als Folgeerscheinung der Lagerhaft wird als Instrument der Viktimisierung und zur Relativierung des deutschen Leids im Kontext des Zweiten Weltkriegs dargestellt. Die Gleichsetzung der Heimkehrer mit den Opfern des Nationalsozialismus dient der Rechtfertigung und Festigung von Vorurteilen gegenüber dem sowjetischen Totalitarismus.
Schlüsselwörter
Kriegsheimkehrer, Zweiter Weltkrieg, Familiäre Konflikte, Nachkriegsgesellschaft, Integration, Viktimisierung, Dystrophie, Trauma, Remaskulinisierung, öffentliche Wahrnehmung, Ostblock, Sowjetunion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen der Heimkehr deutscher Kriegsgefangener nach dem Zweiten Weltkrieg auf den privaten Bereich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Heimkehr deutscher Kriegsgefangener nach dem Zweiten Weltkrieg auf den privaten Bereich, insbesondere auf die Familien. Sie beleuchtet die offizielle Wahrnehmung der Heimkehrer und analysiert die daraus resultierenden Konflikte innerhalb der Familienstrukturen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die öffentliche Deutung der Heimkehr und die Viktimisierung der Heimkehrer, die Belastungen für Familien durch die Kriegsfolgen, Konflikte zwischen Heimkehrern und ihren Ehefrauen/Kindern, den Gesundheitszustand der Heimkehrer und dessen Auswirkungen auf die Familien sowie die Rolle der staatlichen Politik in der Reintegration der Heimkehrer.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, mehrere Kapitel mit Unterkapiteln (z.B. Aspekte der Heimkehr, Öffentliche Deutung der Heimkehr, Kriegsfolgen als Belastung für die Familie, Der Gesundheitszustand der Heimkehrer) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Thematik.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den anhaltenden Einfluss des Zweiten Weltkriegs auf die Nachkriegsgeneration und hebt die Bedeutung der Auseinandersetzung mit den Kriegsfolgen hervor. Sie fokussiert auf die Herausforderungen der Reintegration von Kriegsheimkehrern in ihre Familien und die daraus resultierenden Konflikte, die durch gesellschaftliche und staatliche Faktoren verstärkt wurden. Die Arbeit kündigt die Analyse der offiziellen Wahrnehmung der Heimkehrer und die Untersuchung der familiären Auswirkungen an.
Was wird im Kapitel "Aspekte der Heimkehr" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Situation der elf Millionen deutschen Kriegsgefangenen, ihre Internierung in verschiedenen Ländern und den zeitlichen Verlauf ihrer Heimkehr. Es stellt die unterschiedlichen Erfahrungen der Gefangenen in den Lagern des Ostblocks und der westlichen Alliierten heraus und betont die schrittweise Freilassung.
Was wird im Unterkapitel "Heimat" behandelt?
Unter Bezugnahme auf Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür" wird die Kluft zwischen der erhofften und der tatsächlichen Heimkehr der Soldaten beleuchtet. Das Kapitel verdeutlicht die Enttäuschung und den Bruch der Erwartungen, die viele Heimkehrer erlebten, und stellt die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Reintegration und die Bemühungen des Staates um eine "Remaskulinisierung" der Heimkehrer in den Mittelpunkt.
Was wird im Kapitel "Öffentliche Deutung der Heimkehr" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die öffentliche Reaktion auf die Heimkehr der Soldaten, die zunächst als Opfer des Totalitarismus wahrgenommen wurden. Die Diskussion um die "Dystrophie" als Folgeerscheinung der Lagerhaft wird als Instrument der Viktimisierung und zur Relativierung des deutschen Leids im Kontext des Zweiten Weltkriegs dargestellt. Die Gleichsetzung der Heimkehrer mit den Opfern des Nationalsozialismus dient der Rechtfertigung und Festigung von Vorurteilen gegenüber dem sowjetischen Totalitarismus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kriegsheimkehrer, Zweiter Weltkrieg, Familiäre Konflikte, Nachkriegsgesellschaft, Integration, Viktimisierung, Dystrophie, Trauma, Remaskulinisierung, öffentliche Wahrnehmung, Ostblock, Sowjetunion.
Welche Konflikte innerhalb der Familien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Konflikte zwischen Heimkehrern und ihren Ehefrauen (Entfremdung, Arbeitsunfähigkeit) und Kindern, die durch die Traumata des Krieges und die Schwierigkeiten der Reintegration entstanden sind.
Wie wird die Rolle des Staates dargestellt?
Die Arbeit erwähnt die Rolle des Staates in der Reintegration der Heimkehrer und wie die staatliche Politik die Wahrnehmung und die Behandlung der Heimkehrer beeinflusst hat (z.B. durch die "Remaskulinisierung").
- Citar trabajo
- Christina Langerbein (Autor), 2004, Ein Mann kommt nach Deutschland, Heimkehr der Kriegsgefangenen und ihre Folgen für den privaten Bereich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34553