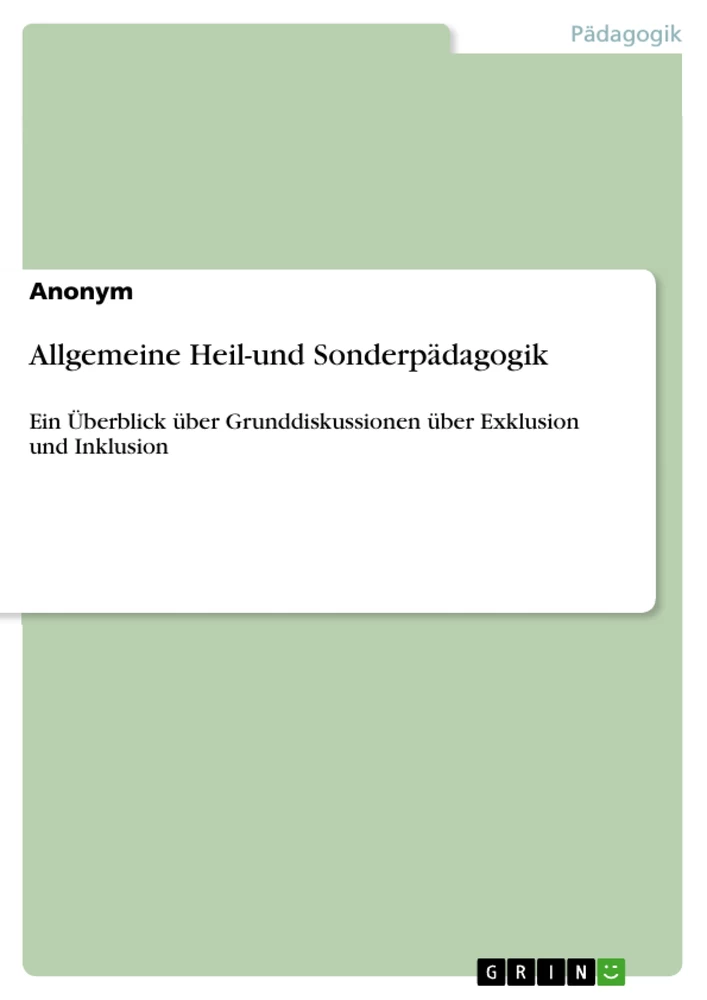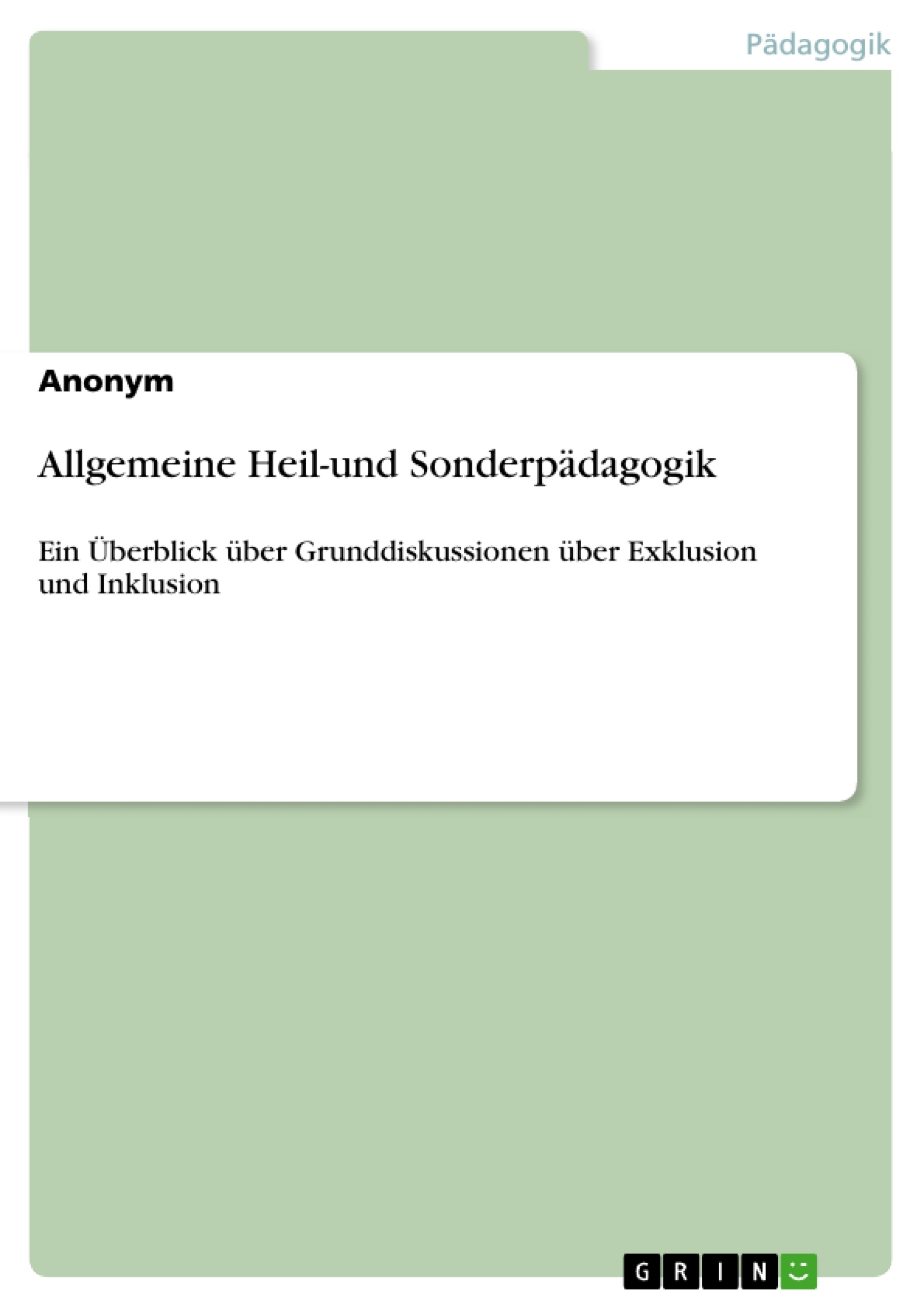Die historische und aktuelle Betrachtung vom Begriff und der Sinnvorstellung von Behinderung und dem Umgang von Menschen mit Behinderung machen mehrere Dinge deutlich: Durch die Negativbesetzung in unserem normalen Sprachgebrauch, in welchem Behinderung auf ein fehlendes Passungsverhältnis verweist, bei dem Menschen mit Behinderung anscheinend Normen und Anforderungen, die von der Gesellschaft gestellt werden nicht erfüllen können, stellt sich die Frage ob der Begriff den Gegenstand verändert.
Die historische Betrachtung zeigt, dass bestimmte Eigenschaften oft als Differenzen wahrgenommen und somit etwas konstruiert wurde, welches auf ein Negativphänomen verweist. Bestimmten körperlichen Merkmalen wurden historisch betrachtet bestimmte Bedeutungen zugemessen. Fehlende oder besonders ausgeprägte Körperteile bewertete und hierarchisierte man. Der kulturelle, historische und gesellschaftliche Kontext bildet durch bestimmte Darstellungen, die heutzutage hauptsächlich medial produziert werden, ein Prinzip von Normalität. Er bestimmt, welche Körper schön sind und welche Eigenschaften ein Körper haben muss, damit er als normal gilt. Dabei sind bestimmte Eigenschaften wichtiger als andere. Die Hierarchisierung bezieht sich dabei immer auf variable und veränderbare Ordnungsvorstellungen über 'Außerordentliche Körper'.
Einer bestimmten ambivalenten Resonanz mussten und müssen sich Menschen mit Beeinträchtigung entgegen sehen. Doch Besonderheit ist nicht gleich Besonderheit. Merkmale müssen nicht allgemein als negativ bewertet werden. Ob und inwiefern sie als Behinderung gelten lässt sich an kulturell und historisch variablen Deutungsmustern ablesen. Die auf der abstrakten Ebene vorhandenen fraglichen Vorstellungen über die Ordnung der Dinge, spiegeln sich in bestimmten Resonanzen von Entitäten wieder. Auf der Handlungsebene in bestimmten Reaktionen und Umgangsformen werden unsere emotionalen und gedanklichen Resonanzen gegenüber M.m.B deutlich. Obwohl Deutungsmuster veränderbar, vielfältig und nicht zeitlich stabil sind, zeigt sich durch eine historische Betrachtung, dass sich gewisse Denkansätze und Resonanzen solide gehalten haben.
Inhaltsverzeichnis
- Die historische und aktuelle Betrachtung vom Begriff und der Sinnvorstellung von Behinderung
- Die Negativbesetzung des Begriffs
- Die historische Betrachtung von Differenzen
- Der kulturelle und gesellschaftliche Kontext
- Ambivalente Resonanz
- Deutungsmuster und Resonanzen
- Das Außergewöhnliche und die Frage nach Zugehörigkeit
- Das Monströse und die anthropologische Frage
- Kulturelle Figuren des Außerordentlichen
- Institutionelle Separierung und die Frage nach sozialer Brauchbarkeit
- Der historische Kontext des Begriffs der Behinderung
- Das individuelle Modell von Behinderung
- Das soziale Modell von Behinderung
- Das kulturelle Modell von Behinderung
- Behinderung als ein nicht sinnfälliges Phänomen
- Kastls Beschreibung von Behinderung
- Der radikale Konstruktivismus
- Der Blick auf die Gegenwart
- Die Ambivalenz von Inklusion und Neo-Eugenik
- Pränatal Diagnostik und das Ideal eines „brauchbaren Menschen“
- Singer’s Präferenz Utilitarismus
- Bioethische Debatten und die Behindertenbewegung
- Eugenische Debatten in der neueren Medizin
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der historischen und aktuellen Betrachtung des Begriffs und der Sinnvorstellung von Behinderung sowie mit dem Umgang von Menschen mit Behinderung. Ziel ist es, die Entwicklung des Begriffs und die damit verbundenen gesellschaftlichen Konstruktionen zu analysieren und die aktuellen Herausforderungen im Kontext von Inklusion und Neo-Eugenik zu beleuchten.
- Die historische Entwicklung des Begriffs der Behinderung
- Gesellschaftliche Konstruktionen von Normalität und Abweichung
- Die Ambivalenz von Inklusion und Neo-Eugenik
- Bioethische Debatten und ethische Herausforderungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung
- Die Bedeutung von Menschenrechten und Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Analyse der historischen und aktuellen Betrachtung des Begriffs der Behinderung. Hierbei werden die Negativbesetzung des Begriffs, die historische Betrachtung von Differenzen und der kulturelle und gesellschaftliche Kontext beleuchtet. Anschließend wird das Außergewöhnliche und die Frage nach Zugehörigkeit in Bezug auf Menschen mit Behinderung diskutiert. Dazu werden kulturelle Figuren des Außerordentlichen sowie die institutionelle Separierung und die Frage nach sozialer Brauchbarkeit untersucht. Der dritte Abschnitt befasst sich mit dem historischen Kontext des Begriffs der Behinderung und analysiert verschiedene Modelle wie das individuelle, soziale und kulturelle Modell. Im vierten Abschnitt wird Behinderung als ein nicht sinnfälliges Phänomen betrachtet und Kastls Beschreibung von Behinderung sowie der radikale Konstruktivismus werden dargelegt. Der Text schließt mit einem Blick auf die Gegenwart und analysiert die Ambivalenz von Inklusion und Neo-Eugenik. Hierbei werden Themen wie Pränatal Diagnostik und das Ideal eines „brauchbaren Menschen“, Singer’s Präferenz Utilitarismus, bioethische Debatten und die Behindertenbewegung sowie eugenische Debatten in der neueren Medizin beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes umfassen Behinderung, Inklusion, Neo-Eugenik, Normalität, Abweichung, gesellschaftliche Konstruktionen, Menschenrechte, bioethische Debatten, Präimplantationsdiagnostik, Präferenz Utilitarismus, Individuum, Gesellschaft, Geschichte, Kultur, Medizin, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Behinderung gesellschaftlich konstruiert?
Behinderung wird oft als Negativphänomen konstruiert, wenn Menschen Normen und Anforderungen der Gesellschaft an "normale" Körper nicht erfüllen.
Was ist der Unterschied zwischen dem individuellen und sozialen Modell von Behinderung?
Das individuelle Modell sieht die Ursache in der körperlichen Beeinträchtigung, während das soziale Modell Behinderung als Ergebnis gesellschaftlicher Barrieren versteht.
Was bedeutet "Neo-Eugenik" im Kontext der Gegenwart?
Neo-Eugenik bezieht sich auf moderne Praktiken wie die Pränataldiagnostik, die das Ideal eines „brauchbaren“ Menschen fördern und Menschen mit Behinderung indirekt diskriminieren können.
Welche Rolle spielt Peter Singers Präferenz-Utilitarismus in der Debatte?
Singers Thesen werden kritisch diskutiert, da sie den Lebenswert von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen infrage stellen können.
Wie haben sich Deutungsmuster über "außerordentliche Körper" historisch gewandelt?
Früher wurden körperliche Differenzen oft religiös oder als "monströs" gedeutet; heute werden sie oft medizinisch hierarchisiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Allgemeine Heil-und Sonderpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344775