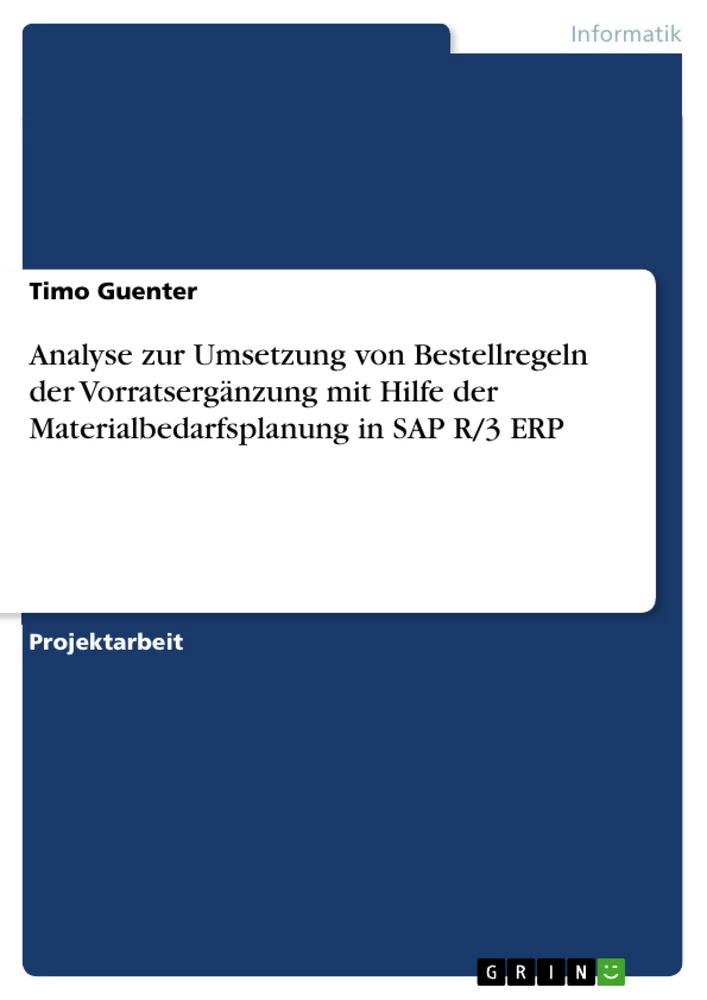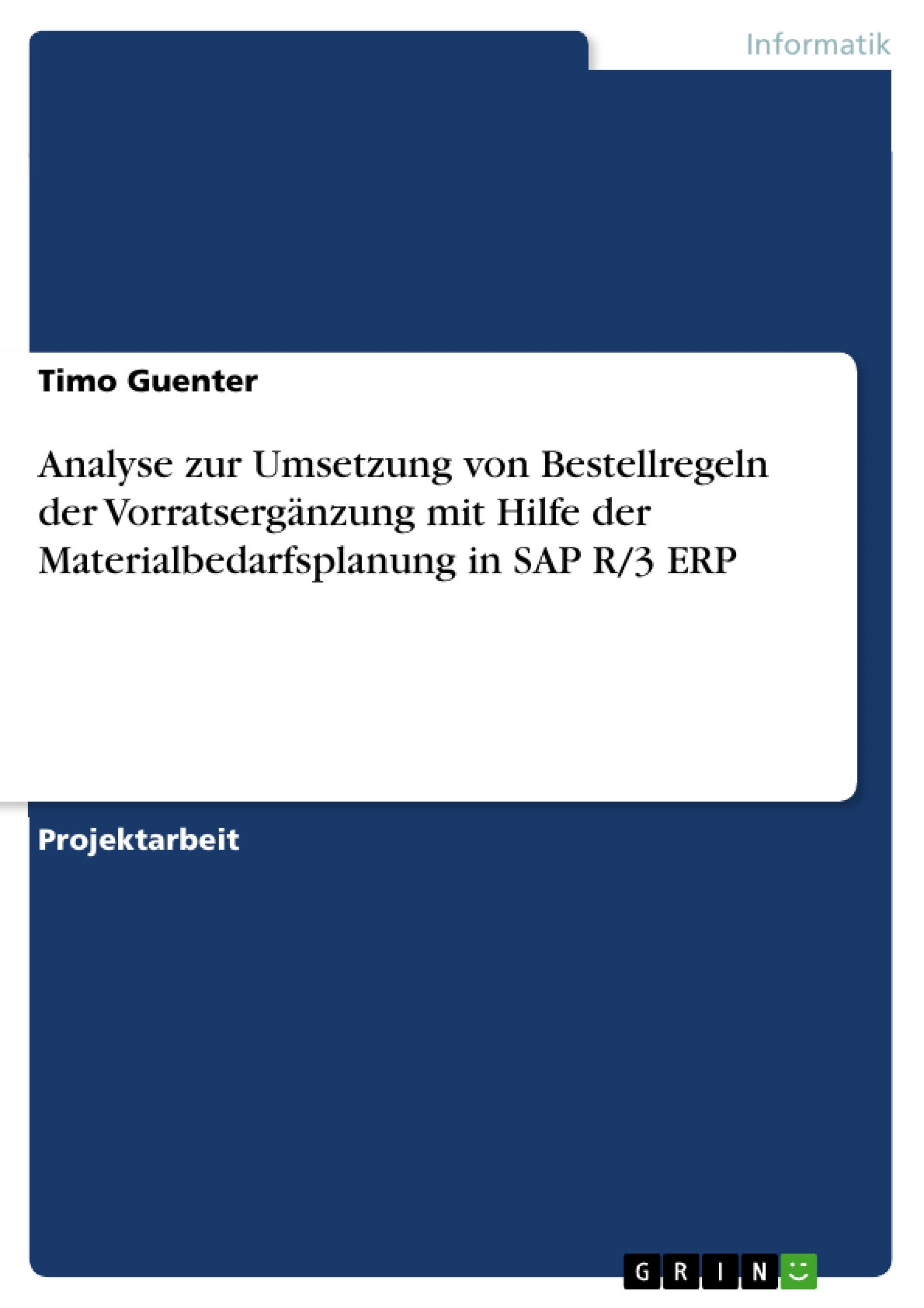Inwieweit treffen theoretische Modelle im Rahmen der Materialbedarfsplanung realitätsnahe Aussagen? Lassen sich diese Modelle zudem in der Praxis umsetzen? Um diese Fragen zu beantworten, werden verschiedene Bestellregeln im Rahmen der Materialbedarfsplanung zusammengetragen und auf ihre strukturellen Merkmale hin untersucht. Die vorliegende Arbeit soll somit einen Einblick dahingehend geben, in welcher Weise theoretische Modelle der Vorratsergänzung mit Hilfe von Bestellregeln die Realität beeinflussen.
Die Materialbedarfsplanung im Bereich der Logistik stellt einen kleinen und standardisierten Bereich der operativen Planung dar. Diese Form der Planung findet Anwendung in vielen verschiedenen Unternehmungen. Die Materialbedarfsplanung stellt eine wichtige Methode für die Realisierung einer kostenoptimalen Materialversorgung dar. So soll im Optimum stets nur so viel Material vorhanden sein, wie es kurzfristig benötigt wird.
In dieser soll daher Arbeit untersucht werden, inwiefern sich in der Theorie entwickelte Bestellregeln in Praxis realitätsnah umsetzen lassen. Weiter soll analysiert werden, ob die in der Theorie entwickeln Modelle tatsächlich auch in der Praxis ein Verhalten aufweisen, wie es theoretisch erwartet wird. Insbesondere soll es durch den Einsatz von SAP R/3 ermöglicht werden, das Verhalten eines Modells in einem Praxisbeispiels zu untersuchen. Diese Analyse soll die Lücke zwischen Theorie und Praxis bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundverständnis logistischer Systeme
- 3 Einführung in die Materialbedarfsplanung
- 3.1 Material Requirements Planning
- 3.2 Manufacturing Resource Planning
- 3.3 Enterprise Ressource Planning
- 4 Grundbegriffe im Rahmen der Materialbedarfsplanung
- 4.1 Materialbedarfsarten
- 4.2 Brutto- und Nettobedarf
- 4.3 Grundprinzipien des Materialbestands
- 4.3.1 Sicherheitsbestand
- 4.3.2 Meldebestand und Bestellpunkt
- 4.3.3 Höchstbestand - Maximalbestand
- 4.4 Materialbedarfsermittlung
- 4.5 Bestellmengenplanung
- 5 Klassifizierung von Bestellregeln
- 5.1 Vorratsergänzung
- 5.2 Verbrauchsbedingte Vorratsergänzung
- 5.2.1 Bestellpunktverfahren
- 5.2.2 Bestellrhythmus-Verfahren
- 5.3 Bedarfsbedingte Vorratsergänzung
- 6 Materialbedarfsplanung innerhalb von SAP R/3
- 6.1 Voraussetzungen
- 6.2 Bedarfsplanung in der logistischen Ketten
- 6.3 Dispositionsverfahren
- 6.3.1 Deterministische Disposition
- 6.3.2 Verbrauchgesteuerte Disposition
- 6.3.2.1 Analyse des verfügbaren Lagerbestands
- 6.3.2.2 Bestellpunktdisposition
- 6.4 Praxisbeispiel anhand des Bestellpunktverfahrens in SAP R/3
- 6.4.1 Ablauf der Bestellpunktdisposition
- 6.4.2 Anpassung innerhalb des Materialstamms
- 6.4.3 Durchführung der Materialbedarfsplanung
- 7 Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Umsetzung von Bestellregeln der Vorratsergänzung mithilfe der Materialbedarfsplanung in SAP R/3 ERP. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der relevanten Prozesse und deren Implementierung im SAP-System zu erlangen.
- Logistische Systeme und Materialbedarfsplanung
- Grundbegriffe und Prinzipien des Materialbestandsmanagements
- Klassifizierung und Anwendung verschiedener Bestellregeln
- Materialbedarfsplanung in SAP R/3 ERP
- Praxisbeispiel der Bestellpunktdisposition in SAP R/3
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Kontext der Analyse zur Umsetzung von Bestellregeln der Vorratsergänzung in SAP R/3 ERP. Sie umreißt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
2 Grundverständnis logistischer Systeme: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis logistischer Systeme und deren Bedeutung im Kontext der Materialbedarfsplanung. Es werden grundlegende Konzepte und Prinzipien der Logistik erläutert, die für das Verständnis der späteren Kapitel essentiell sind.
3 Einführung in die Materialbedarfsplanung: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Materialbedarfsplanung (MRP), Manufacturing Resource Planning (MRP II) und Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme. Es erklärt die Unterschiede und Zusammenhänge dieser Planungsansätze und legt die Basis für das Verständnis der verschiedenen Planungsmethoden im weiteren Verlauf der Arbeit. Die Konzepte werden umfassend dargestellt, um ein solides Fundament für die folgenden Kapitel zu schaffen.
4 Grundbegriffe im Rahmen der Materialbedarfsplanung: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit den Kernbegriffen der Materialbedarfsplanung. Es werden Materialbedarfsarten, Brutto- und Nettobedarf, Sicherheitsbestände, Meldebestände, Bestellpunkte und Höchstbestände erklärt und ihre Bedeutung im Kontext der Bestandsführung und -planung erläutert. Die Kapitelteile arbeiten die einzelnen Konzepte detailliert auf und illustrieren ihren Einfluss auf die effiziente Materialwirtschaft.
5 Klassifizierung von Bestellregeln: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Arten von Bestellregeln, insbesondere die Vorratsergänzung. Es unterscheidet zwischen verbrauchsbedingter und bedarfsbedingter Vorratsergänzung und erklärt die jeweiligen Verfahren wie Bestellpunkt- und Bestellrhythmusverfahren. Die verschiedenen Ansätze werden im Detail gegenübergestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert.
6 Materialbedarfsplanung innerhalb von SAP R/3: Dieses Kapitel fokussiert auf die Umsetzung der Materialbedarfsplanung im SAP R/3 System. Es beschreibt die notwendigen Voraussetzungen, die Bedarfsplanung in logistischen Ketten, verschiedene Dispositionsverfahren (deterministisch und verbrauchsgestuert) und ein detailliertes Praxisbeispiel zur Bestellpunktdisposition. Die praktische Anwendung der theoretischen Konzepte aus den vorherigen Kapiteln wird hier im Detail dargestellt, insbesondere der Ablauf der Bestellpunktdisposition und die notwendigen Anpassungen im Materialstamm.
Schlüsselwörter
Materialbedarfsplanung, SAP R/3 ERP, Bestellregeln, Vorratsergänzung, Bestellpunktverfahren, Bestellrhythmusverfahren, Logistik, Materialbestand, Disposition, Deterministische Disposition, Verbrauchgesteuerte Disposition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Materialbedarfsplanung in SAP R/3
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Materialbedarfsplanung (MBP) mit Fokus auf die Umsetzung von Bestellregeln in SAP R/3. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Anwendung der MBP in SAP R/3, inklusive eines detaillierten Praxisbeispiels zur Bestellpunktdisposition.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Logistische Systeme, Grundlagen der Materialbedarfsplanung (MRP, MRP II, ERP), Grundbegriffe der MBP (Materialbedarfsarten, Brutto-/Nettobedarf, Sicherheitsbestände, Meldebestand, Bestellpunkt, Höchstbestand), Klassifizierung von Bestellregeln (Vorratsergänzung, verbrauchs- und bedarfsbedingte Vorratsergänzung, Bestellpunkt- und Bestellrhythmusverfahren), Materialbedarfsplanung in SAP R/3 (Voraussetzungen, Bedarfsplanung in logistischen Ketten, Dispositionsverfahren – deterministisch und verbrauchsgereuert), und ein detailliertes Praxisbeispiel zur Bestellpunktdisposition in SAP R/3.
Welche Arten von Bestellregeln werden erklärt?
Das Dokument erläutert verschiedene Arten von Bestellregeln, insbesondere die Vorratsergänzung. Es unterscheidet zwischen verbrauchsbedingter und bedarfsbedingter Vorratsergänzung und beschreibt detailliert das Bestellpunktverfahren und das Bestellrhythmusverfahren. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden diskutiert.
Wie wird die Materialbedarfsplanung in SAP R/3 behandelt?
Das Dokument beschreibt die Umsetzung der Materialbedarfsplanung im SAP R/3 System. Es erklärt die notwendigen Voraussetzungen, die Bedarfsplanung in logistischen Ketten, verschiedene Dispositionsverfahren (deterministisch und verbrauchsgestützt) und bietet ein detailliertes Praxisbeispiel zur Bestellpunktdisposition. Der Ablauf der Bestellpunktdisposition und die notwendigen Anpassungen im Materialstamm werden Schritt für Schritt erläutert.
Was ist das Praxisbeispiel in SAP R/3?
Das Praxisbeispiel konzentriert sich auf die Bestellpunktdisposition in SAP R/3. Es zeigt den Ablauf dieser Disposition, die notwendigen Anpassungen im Materialstamm und die Durchführung der Materialbedarfsplanung anhand eines konkreten Beispiels. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der theoretischen Konzepte.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Materialbedarfsplanung, SAP R/3 ERP, Bestellregeln, Vorratsergänzung, Bestellpunktverfahren, Bestellrhythmusverfahren, Logistik, Materialbestand, Disposition, deterministische Disposition, verbrauchsgestützte Disposition.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit der Materialbedarfsplanung und deren Implementierung in SAP R/3 befassen. Es eignet sich als Lehrmaterial, Nachschlagewerk oder zur Vorbereitung auf praktische Anwendungen im Bereich Logistik und Materialwirtschaft.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Dokument enthält Zusammenfassungen für jedes Kapitel, welche die wichtigsten Inhalte und Schwerpunkte jedes Abschnitts detailliert beschreiben. Das Inhaltsverzeichnis ermöglicht es, die einzelnen Kapitel gezielt aufzusuchen.
- Arbeit zitieren
- Timo Guenter (Autor:in), 2015, Analyse zur Umsetzung von Bestellregeln der Vorratsergänzung mit Hilfe der Materialbedarfsplanung in SAP R/3 ERP, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343650