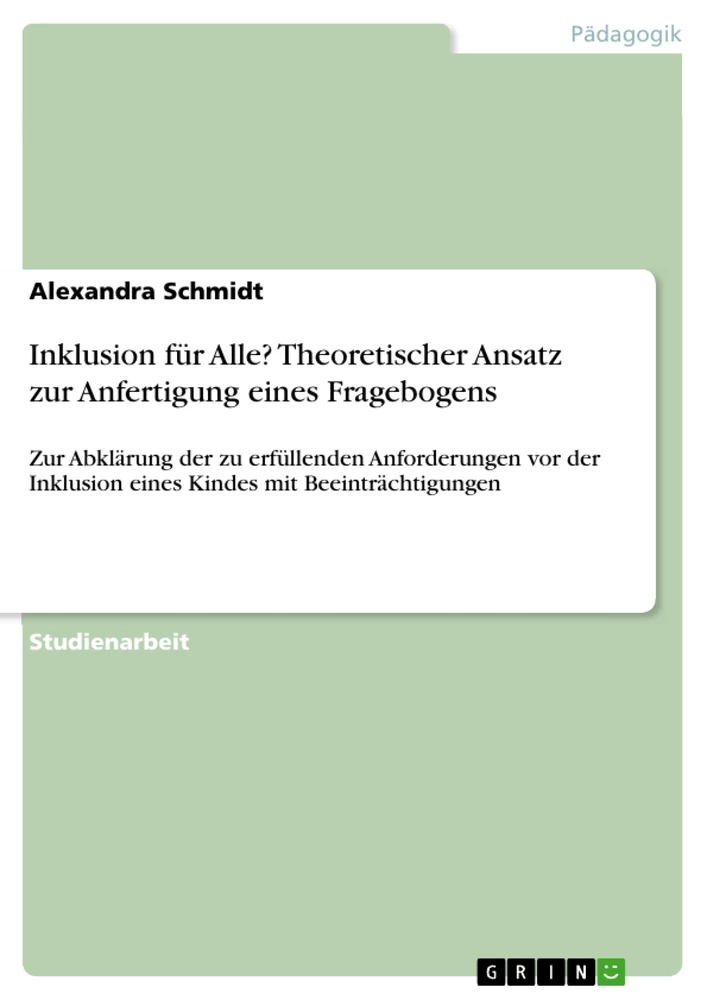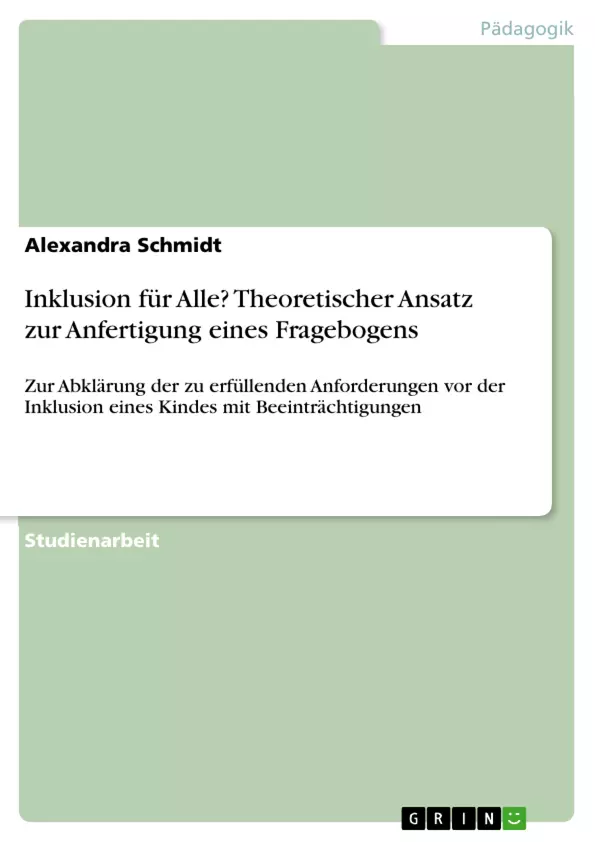Der Begriff der Inklusion hat in den vergangenen Jahren in Deutschland, begonnen mit der Verabschiedung des Gesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, und seiner in Kraft-Tretung ab
März 2009 in Deutschland, erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieses Gesetz stärkt explizit die Rechte von Menschen mit jeglicher Beeinträchtigung und fordert im Artikel 24 „Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen“ (Bundesgesetzblatt 2008). Für die Sozial- und Bildungspolitik in Deutschland hat dies weitreichende Folgen.
Denn Inklusion ist viel mehr als eine politische Vorgabe. Laut der Lebenshilfe Deutschland bedeutet es „Alle gehören dazu – immer“ (Lebenshilfe 2014, online). Das dies erhebliche Schwierigkeiten in der alltäglichen Umsetzung birgt, möchte ich exemplarisch an den Erfahrungen eines Erziehers in einer Kindertagesstätte im Bundesland Hamburg darlegen und an Hand eines qualitativen Interviews mit dieser pädagogischen Kraft erläutern.
Ich werde auf grundlegende Begrifflichkeiten eingehen und die derzeitige politische Lage und die Anforderungen an die pädagogischen Einrichtungen in Hamburg erläutern. Folgend kurz die Interviewmethode vorstellen und durch die Beschreibung des Falles einen Hintergrund zum Verständnis des Interviews geben. Im Interview versuche ich einige wichtige Problematiken hervorzuheben. Denn Inklusion wird kein temporäres Thema sein, sondern ist durch seine weltweite Bedeutung ein neuer Lebens- und Zusammenlebensaspekt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Integration zur Inklusion
- Was ist Integration
- Was ist Inklusion
- Der Index für Inklusion
- Kinderbetreuung in Hamburg
- Methodisches Vorgehen – exemplarisches Interview zur Problemstellung
- Die Methode
- Die Ausgangslage
- Das Interview mit der betreuenden Fachkraft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Inklusion im Kontext der Kinderbetreuung in Hamburg. Sie untersucht, welche Anforderungen an die pädagogischen Einrichtungen gestellt werden, um die Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen zu gewährleisten.
- Die Bedeutung von Inklusion in der Gesellschaft
- Der Unterschied zwischen Integration und Inklusion
- Die Herausforderungen der Inklusion in der Praxis
- Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte bei der Inklusion
- Der Index für Inklusion als Instrument zur Förderung inklusiven Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Begriff der Inklusion und seine Bedeutung in der heutigen Gesellschaft vor. Sie erläutert die rechtlichen Grundlagen der Inklusion und verweist auf die Notwendigkeit, die Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen in der Praxis zu fördern.
- Das Kapitel „Von der Integration zur Inklusion“ definiert die Begriffe Integration und Inklusion und hebt die Unterschiede zwischen beiden Konzepten hervor. Der Index für Inklusion wird als wichtiges Instrument zur Förderung inklusiven Lernens vorgestellt.
- Das Kapitel „Kinderbetreuung in Hamburg“ beleuchtet die aktuelle Situation der Kinderbetreuung in Hamburg und die Herausforderungen, die sich aus der Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen ergeben.
- Das Kapitel „Methodisches Vorgehen – exemplarisches Interview zur Problemstellung“ beschreibt die Methodik des Interviews mit einer pädagogischen Fachkraft, die sich mit der Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen auseinandersetzt. Das Interview soll Einblicke in die Praxis der Inklusion in einer Kindertagesstätte in Hamburg geben.
Schlüsselwörter
Inklusion, Integration, Kinderbetreuung, Hamburg, Beeinträchtigungen, Pädagogik, Index für Inklusion, Interview, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Während Integration oft bedeutet, Menschen mit Behinderung in ein bestehendes System einzugliedern, zielt Inklusion darauf ab, das System so zu gestalten, dass alle von vornherein dazugehören.
Welche rechtliche Basis hat die Inklusion in Deutschland?
Grundlage ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das 2009 in Deutschland in Kraft getreten ist und die volle Teilhabe fordert.
Wie wird Inklusion in Hamburger Kitas umgesetzt?
Die Arbeit untersucht dies beispielhaft an einem Interview mit einem Erzieher. Es zeigt sich, dass die alltägliche Umsetzung trotz politischer Vorgaben oft mit erheblichen praktischen Schwierigkeiten verbunden ist.
Was ist der „Index für Inklusion“?
Der Index für Inklusion ist ein Instrument und Leitfaden, der Einrichtungen dabei unterstützt, inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken in der Bildungsarbeit zu entwickeln.
Welche Herausforderungen haben pädagogische Fachkräfte bei der Inklusion?
Fachkräfte müssen individuelle Bedürfnisse koordinieren, Barrieren abbauen und oft unter begrenzten Ressourcen eine „Teilhabe für Alle“ ermöglichen, was hohe Anforderungen an die pädagogische Expertise stellt.
- Quote paper
- Bachelor of Arts (B. A.) Alexandra Schmidt (Author), 2014, Inklusion für Alle? Theoretischer Ansatz zur Anfertigung eines Fragebogens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342430