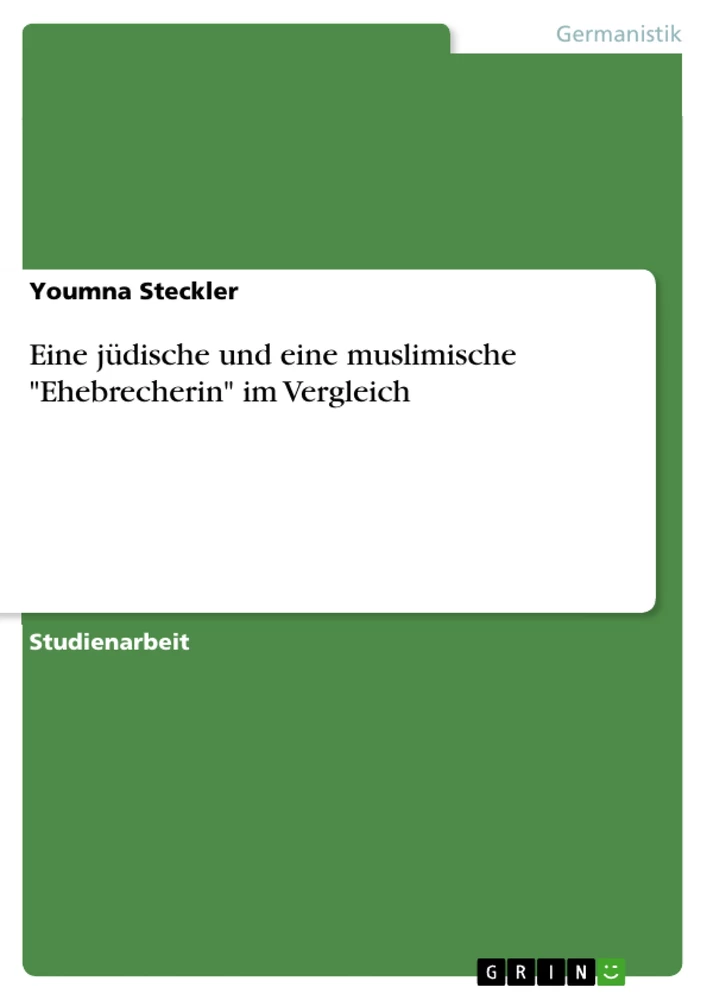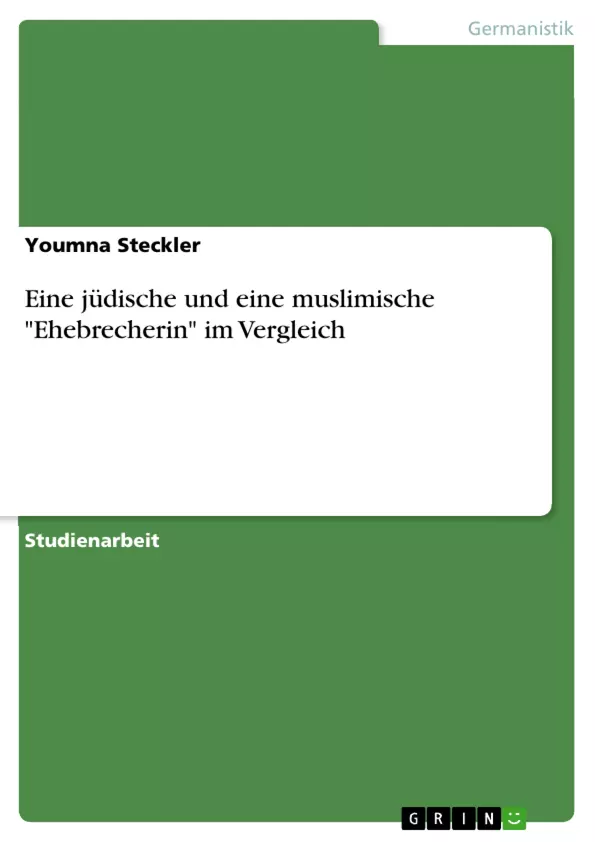Die vorliegende Arbeit vergleicht zwei bedeutende Frauengestalten der zwei monotheistischen Religionen Judentum und Islam. Konkret beschreibt und vergleicht diese Arbeit die Geschichten von Susanna, einer Jüdin und Aischa einer Muslimin. Die Geschichte von Susanna wird im Alten Testament erzählt und die Geschichte von Aischa ist aus islamischen Überlieferungen bekannt. In diesen Geschichten wurden beide Frauen des Ehebruchs beschuldigt.
Als Basis für den Vergleich geht diese Arbeit zunächst auf historische Hintergründe beider Frauengestalten ein, und nutzt dabei insbesondere ihre Biographien. Daran schließt sich eine kurze Zusammenfassung beider Verleumdungsgeschichten an. Hierbei stütze ich mich vor allem auf die Quellen, in denen beide Geschichten geschildert werden. Dies sind zum einen das Alte Testament für die Geschichte Susannas, und zum anderen für die Geschichte Aischas die Überlieferungen aus dem Leben des muslimischen Propheten Mohammed von Ibn Ishaq, sowie später verfasste Dramen. Anschließend werden einige alttestamentlichen Stellen der Geschichte sowie einige Koranstellen erläutert, um die Analyse der Arbeit zu unterstützen.
Als Primärliteratur für diese Arbeit dient das Drama „Susanna“ des Autors Paul Rebhuhn und der Roman „Aischa und Mohammed“ von Karman Pasha. In der Analyse betrachte ich zuerst die Eigenschaften beider Frauengestalt. Diese werden hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede verglichen. Als nächstes untersuche ich die sozialen und rechtlichen Stellungen Aischas und Susannas und wie diese ihre Situation beeinflusst haben.
Dabei geht die Arbeit auf die Folgen der Verleumdungsgeschichten in Bezug auf die moralische Ebene und die religiöse Lehre der jüdischen und muslimischen Gemeinschaften ein. Weiterhin schildere ich in dieser Arbeit die Strafen für Unzucht und Ehebruch in beiden Religionen und die Gründe für ihre Anwendung bzw. aufgeführt. Zum Schluss betrachtet die Arbeit auch die Reaktionen der Ehemänner hinsichtlich der Anschuldigungen an ihre Frauen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HISTORISCHE HINTERGRÜNDE
- Aischas Biographie
- Susannas Biographie
- ERPRESSUNG UND VERLEUMDUNG
- Susanna und die falschen Richter
- Aischa und der „die Halskettenaffäre“
- DIE SOZIALE UND RECHTLICHE STELLUNG DER FRAU IN BEIDEN GESCHICHTEN
- Im Judentum
- Im Islam
- Folgen der Verleumdungsgeschichten auf die jüdische und muslimische Gemeinschaft
- UNZUCHT- UND EHEBRUCHSSTRAFE IN BEIDEN GESCHICHTEN
- GOTT ODER EHEMANN?
- Gottesbild für Susanna und Aischa
- Die Rolle der Ehemänner in den Verleumdungsgeschichten
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Geschichten von Susanna, einer Jüdin, und Aischa, einer Muslimin, die beide des Ehebruchs beschuldigt wurden. Die Arbeit untersucht die historischen Hintergründe beider Frauengestalten, analysiert die Verleumdungsgeschichten und beleuchtet die sozialen und rechtlichen Stellungen der Frauen in beiden Religionen. Dabei werden die Folgen der Verleumdungsgeschichten für die jüdische und muslimische Gemeinschaft, die Strafen für Unzucht und Ehebruch sowie die Reaktionen der Ehemänner auf die Anschuldigungen betrachtet.
- Vergleich der Lebensgeschichten von Susanna und Aischa
- Analyse der Verleumdungsgeschichten und ihrer Folgen
- Untersuchung der sozialen und rechtlichen Stellung von Frauen im Judentum und Islam
- Bedeutung der Verleumdungsgeschichten für die moralische und religiöse Lehre beider Religionen
- Rolle der Ehemänner in den Verleumdungsgeschichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die beiden Frauengestalten Susanna und Aischa vor und beschreibt den Fokus der Arbeit. Das Kapitel „Historische Hintergründe“ gibt einen Einblick in das Leben von Aischa und Susanna und fokussiert auf ihre Erziehung und ihre Einbindung in die jeweiligen Gesellschaften. Das Kapitel „Erpressung und Verleumdung“ behandelt die Verleumdungsgeschichten von Susanna und Aischa, wobei die jeweiligen Anschuldigungen und die Rolle der beteiligten Personen im Detail betrachtet werden. Das Kapitel „Die soziale und rechtliche Stellung der Frau in beiden Geschichten“ untersucht die Rolle der Frau in der jüdischen und muslimischen Gesellschaft und analysiert, wie diese die Situation von Susanna und Aischa beeinflusst hat. Das Kapitel „Unzucht- und Ehebruchstrafe in beiden Geschichten“ betrachtet die Strafen für Unzucht und Ehebruch im Judentum und Islam und analysiert die Gründe für ihre Anwendung. Das Kapitel „Gott oder Ehemann?“ behandelt die Rolle von Gott und den Ehemännern in den Verleumdungsgeschichten, wobei das Gottesbild für Susanna und Aischa sowie die Reaktionen der Ehemänner auf die Anschuldigungen untersucht werden. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen aus dem Vergleich der beiden Frauengestalten.
Schlüsselwörter
Verleumdung, Ehebruch, Frauengestalten, Judentum, Islam, Susanna, Aischa, soziale und rechtliche Stellung, Strafen, Gottesbild, Ehemänner, Geschichte, Religion, Vergleich, Analyse, moralische und religiöse Lehre.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind Susanna und Aischa in diesem Vergleich?
Susanna ist eine biblische Gestalt aus dem Alten Testament (Judentum), während Aischa die Ehefrau des Propheten Mohammed ist (Islam). Beide wurden fälschlicherweise des Ehebruchs beschuldigt.
Was ist die "Halskettenaffäre" im Islam?
Dies ist die Geschichte der Verleumdung von Aischa, die nach einer Reise den Anschluss an die Karawane verlor und später mit einem Begleiter zurückkehrte, was zu falschen Anschuldigungen führte.
Wie unterscheiden sich die Strafen für Ehebruch in beiden Religionen?
Die Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen und Strafmaße für Unzucht und Ehebruch im historischen Kontext des Judentums und des Islams sowie die Bedingungen für deren Anwendung.
Welche Rolle spielen die Ehemänner in den Geschichten?
Analysiert wird, wie die Ehemänner auf die Vorwürfe gegen ihre Frauen reagierten und welchen Einfluss ihre soziale Stellung auf den Ausgang der Verleumdungsaffären hatte.
Welche rechtliche Stellung hatten Frauen in diesen Erzählungen?
Die Arbeit beleuchtet die soziale Unterordnung und die rechtliche Situation von Frauen in der jüdischen und muslimischen Gesellschaft der damaligen Zeit.
- Quote paper
- Youmna Steckler (Author), 2016, Eine jüdische und eine muslimische "Ehebrecherin" im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341928