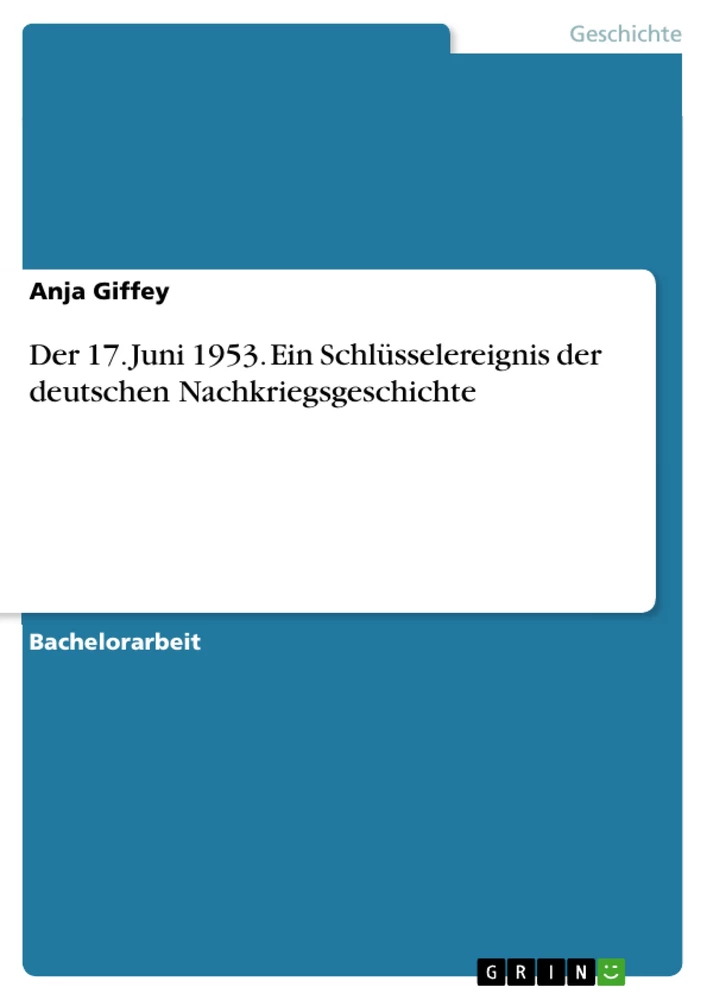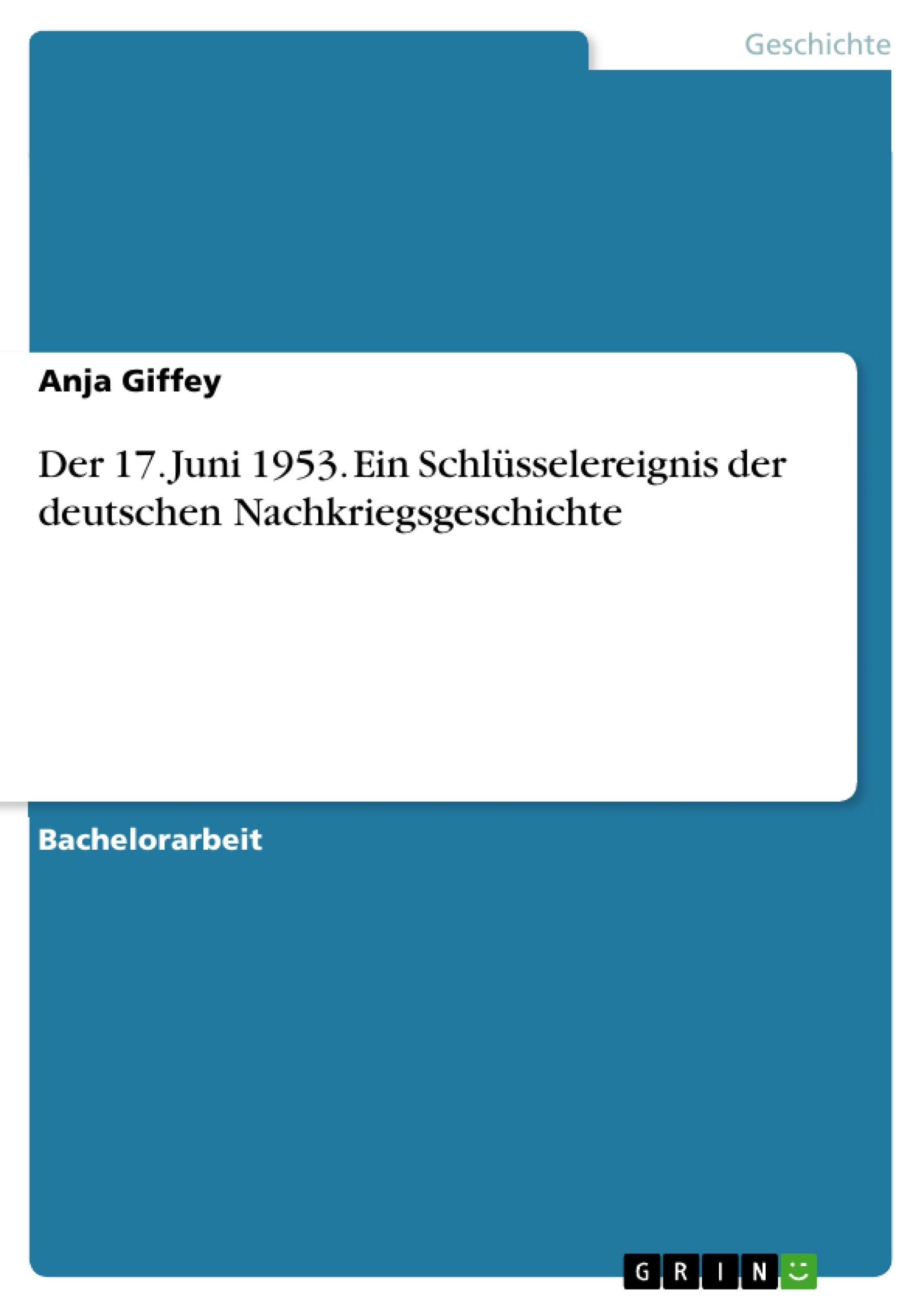Am 16. Juni 1953 legten die Bauarbeiter in der Berliner Stalinallee ihre Arbeit nieder und zogen in Demonstrationszügen mit der Losung: „Wir fordern Normsenkung!“ zum Sitz der SED. Dies war der Beginn einer unaufhaltsamen Protestbewegung, die sich wie ein Flächenbrand über die ganze DDR ausbreitete und ihren Höhepunkt am Folgetag erreichte. Hunderttausende Demonstranten erhoben sich für Freiheit und Demokratie. Mit Parolen wie: „Spitzbart, Bauch und Brille, sind nicht des Volkes Wille!“ entlud die Bevölkerung ihren Unmut über die Staatsführung. Neben dem Rücktritt der Regierung forderte die Masse die Abhaltung freier Wahlen, die Freilassung politischer Gefangener sowie die Zulassung freier Parteien und Gewerkschaften. Die Wucht der Proteste und das Versagen der Sicherheitskräfte führten dazu, dass die Diktatur der SED binnen Stunden wie ein Kartenhaus zusammenbrach. Nur durch das Eingreifen der Roten Armee konnten die Unruhen beendet werden. Gewaltsam drängte das sowjetische Militär die Demonstranten zurück, wobei zahlreiche Menschen getötet wurden. Indessen schauten die Westmächte tatenlos zu – zur Enttäuschung der Aufständischen. Gleichwohl wurde der 17. Juni in der Bundesrepublik zum Nationalgedenktag erklärt. Die SED reagierte auf die Volkserhebung mit einer großen Verfolgungswelle und sprach von einem „faschistischen Putschversuch“.
Ziel dieser Arbeit ist es, sich intensiv mit den Ereignissen des 17. Juni 1953 zu befassen. Zu Beginn wird auf die Ursachen des Aufstands eingegangen. Sowohl die Fehlentscheidungen seitens der sowjetischen Besatzungsmacht als auch der SED-Regierung, die die DDR nur wenige Jahre nach ihrer Gründung in eine tiefe innenpolitische Krise stürzten, sollen analysiert werden. Anschließend wird der Verlauf der Unruhen aufgezeigt. Eine Schlüsselstellung nimmt dabei der Berliner Bauarbeiterstreik ein, der das Fanal zum DDR-weiten Massenprotest gab. In über 560 Ortschaften protestierten die Menschen gegen die sozialen und politischen Verhältnisse in Ostdeutschland. Auch in Magdeburg kam es zu Streiks, Demonstrationen, Gefangenenbefreiungen und Gewalttätigkeiten. Dieser Stadt wird in der Ausarbeitung besondere Aufmerksamkeit zukommen. Im Anschluss geht es um das Scheitern der Volkserhebung. Verstärkt wird der Frage nachgegangen, warum die Polizisten und Soldaten die Demonstrationen nicht bereits im Keim erstickten. Konnten sie einen Einsatz gegen das Volk nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Ursachen
- 1.1. Besatzungspolitik der Sowjetunion und Aufbau der SED-Herrschaft
- 1.1.1 Gründung von Parteien und Massenorganisationen
- 1.1.2 Bodenreform und Verstaatlichung
- 1.1.3 Demontagepolitik der UdSSR
- 1.1.4 Gründung der SED
- 1.2. Aufbau des Sozialismus
- 1.2.1 Normenerhöhung
- 1.3. Der Neue Kurs
- 2. Der Aufstand
- 2.1. 16. Juni 1953 – die Initialzündung
- 2.2. Die Demonstration der Berliner Bauarbeiter
- 2.3. Aufstand in Berlin
- 2.3.1 Der Wendepunkt
- 2.4. Der unerwartete Flächenbrand
- 3. Der 17. Juni 1953 in Magdeburg
- 3.1. Vorgeschichte
- 3.2. Die Magdeburger Streikbewegung
- 3.3. Der 18. Juni 1953 – Ende eines Streiks
- 3.4. Justizterror der SED
- 3.5. Opfer
- 4. Die Niederschlagung
- 4.1. Die Machtlosigkeit der Volkspolizei
- 4.2. Die versagende Staatssicherheit
- 4.3. Das Eingreifen der Sowjets
- 4.4. Hat die KVP als Machtorgan der SED versagt?
- 5. Die Entwicklung nach dem 17. Juni 1953
- 5.1. Polemik gegen den Westen
- 5.2. Festnahmen und Verurteilungen
- 5.2.1 Der Fall Max Fechner
- 5.3. Der Machtkampf im Politbüro
- 6. Die Haltung des Westens
- 6.1. Churchill und das Foreign Office – Vorgeschichte und Reaktionen am 17. Juni 1953
- 6.2. Die Haltung der Bundesrepublik
- 6.3. USA
- 6.3.1 „Eisenhower-Pakete“
- 7. Der 17. Juni 1953 im Geschichtsunterricht
- 7.1. Zur didaktischen Konzeption und Zielsetzung
- 7.2. Methodische Analyse
- 7.3. Didaktische Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die intensive Auseinandersetzung mit den Ereignissen des 17. Juni 1953. Es werden die Ursachen des Aufstands, der Verlauf der Unruhen, die Niederschlagung des Aufstands und die darauffolgenden Entwicklungen analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle Magdeburgs gewidmet. Die Reaktion der Westmächte und die didaktische Aufarbeitung des Themas im Geschichtsunterricht werden ebenfalls betrachtet.
- Ursachen des Aufstands (sowjetische Besatzungspolitik, SED-Herrschaft, soziale und wirtschaftliche Missstände)
- Verlauf des Aufstands (Bauarbeiterstreik, Ausbreitung der Proteste, Rolle Magdeburgs)
- Niederschlagung des Aufstands (Versagen der Sicherheitskräfte, Eingreifen der Sowjetarmee)
- Folgen des Aufstands (Verfolgungswelle, Machtkampf im Politbüro)
- Reaktionen des Westens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Ursachen: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen des Aufstands vom 17. Juni 1953. Es untersucht die sowjetische Besatzungspolitik und den Aufbau der SED-Herrschaft, einschließlich der Gründung von Parteien und Massenorganisationen, der Bodenreform und Verstaatlichung, der Demontagepolitik und der Gründung der SED selbst. Weiterhin wird der Aufbau des Sozialismus mit der damit verbundenen Normenerhöhung und die Einführung des "Neuen Kurses" beleuchtet. Das Kapitel zeigt auf, wie die Politik der Sowjetunion und der SED zu weit verbreiteter Unzufriedenheit in der Bevölkerung führte, die durch soziale Einschränkungen und wirtschaftliche Not verstärkt wurde. Die schlechte Lebensqualität und der Mangel an Mitbestimmung sind zentrale Aspekte, die die Grundlage für den bevorstehenden Aufstand bildeten.
2. Der Aufstand: Dieses Kapitel beschreibt den Verlauf des Aufstands, beginnend mit dem Bauarbeiterstreik in der Berliner Stalinallee am 16. Juni 1953. Es zeigt die Ausbreitung der Proteste in ganz Ostdeutschland, die Beteiligung Hunderttausender Demonstranten und deren Forderungen nach Freiheit, Demokratie und sozialen Verbesserungen. Der Berliner Bauarbeiterstreik wird als Initialzündung für den flächendeckenden Aufstand dargestellt. Die Kapitel beleuchten die gewaltsamen Auseinandersetzungen und das Scheitern der Sicherheitskräfte, die die Unruhen nicht mehr unter Kontrolle bekommen konnten. Das Eingreifen der sowjetischen Armee zur Niederschlagung des Aufstands wird als entscheidender Wendepunkt beschrieben.
3. Der 17. Juni 1953 in Magdeburg: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Ereignisse des 17. Juni 1953 in Magdeburg. Es beschreibt die Vorgeschichte, die Streikbewegung in der Stadt, den Ablauf der Proteste und deren gewaltsames Ende am 18. Juni. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Magdeburger Streikbewegung im Kontext des gesamtdeutschen Aufstands und schildert die repressive Reaktion der SED-Behörden, einschließlich des Justizterrors und der Opfer. Die detaillierte Darstellung der Ereignisse in Magdeburg hebt die regionale Dimension des Aufstands hervor und unterstreicht die weitreichenden Folgen der Proteste auch in dieser Stadt.
4. Die Niederschlagung: Das Kapitel behandelt die Niederschlagung des Aufstands. Es analysiert die Machtlosigkeit der Volkspolizei und der Staatssicherheit und die entscheidende Rolle des sowjetischen Militärs bei der gewaltsamen Unterdrückung der Demonstrationen. Die Frage nach dem Versagen der KVP als Machtorgan der SED wird kritisch untersucht. Das Kapitel zeigt auf, wie die staatlichen Organe der DDR dem gewaltsamen Aufstand nicht gewachsen waren und wie die Sowjetarmee letztendlich die Proteste niederschlug.
5. Die Entwicklung nach dem 17. Juni 1953: Dieses Kapitel befasst sich mit den Folgen des Aufstands. Es beschreibt die Propagandakampagne der SED gegen den Westen, die Festnahmen und Verurteilungen von Demonstranten, den Fall Max Fechner als Beispiel für die Repressalien und den Machtkampf innerhalb des Politbüros. Die Darstellung zeigt, wie die SED versuchte, den Aufstand zu delegitimieren und die eigene Machtposition zu festigen.
6. Die Haltung des Westens: Dieses Kapitel analysiert die Reaktion der Westmächte auf den Aufstand. Es untersucht die Positionen Churchills und des britischen Foreign Office, die Haltung der Bundesrepublik Deutschland und die Rolle der USA, inklusive der „Eisenhower-Pakete“. Das Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Reaktionen und das Ausmaß der Unterstützung, beziehungsweise Nicht-Unterstützung, die die Ostdeutschen von den westlichen Mächten erhielten.
7. Der 17. Juni 1953 im Geschichtsunterricht: Das Kapitel befasst sich mit der didaktischen und methodischen Aufarbeitung des 17. Juni 1953 im Geschichtsunterricht. Es untersucht die didaktische Konzeption und Zielsetzung, die methodische Analyse und die didaktische Analyse des Themas im schulischen Kontext. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Auseinandersetzung mit diesem geschichtlichen Ereignis für die politische Bildung junger Menschen.
Schlüsselwörter
17. Juni 1953, DDR, Arbeiteraufstand, Volksaufstand, SED, Sowjetunion, Besatzungspolitik, Sozialismus, Repression, Westmächte, Geschichtsunterricht, Magdeburg, Bauarbeiterstreik, Normenerhöhung, Politischer Widerstand.
Häufig gestellte Fragen zum 17. Juni 1953
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über den Arbeiteraufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Er behandelt die Ursachen, den Verlauf, die Niederschlagung und die Folgen des Aufstands, inklusive der Rolle Magdeburgs und der Reaktion des Westens. Zusätzlich wird die didaktische Aufarbeitung des Themas im Geschichtsunterricht analysiert.
Welche Ursachen werden für den Aufstand vom 17. Juni 1953 genannt?
Der Text nennt als Ursachen die sowjetische Besatzungspolitik, den Aufbau der SED-Herrschaft mit der Gründung von Parteien und Massenorganisationen, Bodenreform und Verstaatlichung, Demontagepolitik, die Einführung des Sozialismus mit Normerhöhungen und den "Neuen Kurs". Soziale und wirtschaftliche Missstände, die schlechte Lebensqualität und der Mangel an Mitbestimmung werden als zentrale Faktoren hervorgehoben, die zur Unzufriedenheit der Bevölkerung führten und den Aufstand auslösten.
Wie verlief der Aufstand am 17. Juni 1953?
Der Aufstand begann mit einem Bauarbeiterstreik in Berlin. Die Proteste breiteten sich schnell in ganz Ostdeutschland aus. Hunderttausende demonstrierten für Freiheit, Demokratie und soziale Verbesserungen. Die Sicherheitskräfte konnten die Unruhen nicht kontrollieren, und das Eingreifen der sowjetischen Armee markierte einen entscheidenden Wendepunkt zur Niederschlagung des Aufstands.
Welche Rolle spielte Magdeburg am 17. Juni 1953?
Der Text widmet ein eigenes Kapitel den Ereignissen in Magdeburg. Er beschreibt die Vorgeschichte, die Streikbewegung in der Stadt, den Verlauf der Proteste und deren gewaltsames Ende. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Magdeburger Streikbewegung im Kontext des gesamtdeutschen Aufstands und der repressiven Reaktion der SED-Behörden, inklusive Justizterror und Opfer.
Wie wurde der Aufstand vom 17. Juni 1953 niedergeschlagen?
Die Niederschlagung des Aufstands wird durch die Machtlosigkeit der Volkspolizei und der Staatssicherheit sowie das entscheidende Eingreifen der sowjetischen Armee beschrieben. Die Frage nach dem Versagen der KVP als Machtorgan der SED wird kritisch beleuchtet.
Welche Folgen hatte der Aufstand vom 17. Juni 1953?
Der Aufstand hatte weitreichende Folgen: Die SED startete eine Propagandakampagne gegen den Westen, es kam zu Festnahmen und Verurteilungen von Demonstranten (z.B. der Fall Max Fechner), und es gab einen Machtkampf innerhalb des Politbüros. Die SED versuchte, den Aufstand zu delegitimieren und die eigene Macht zu festigen.
Wie reagierten die Westmächte auf den Aufstand vom 17. Juni 1953?
Der Text analysiert die Reaktionen der Westmächte, insbesondere die Positionen Churchills und des britischen Foreign Office, die Haltung der Bundesrepublik Deutschland und die Rolle der USA (inklusive der "Eisenhower-Pakete"). Die unterschiedlichen Reaktionen und das Ausmaß der Unterstützung (oder Nicht-Unterstützung) der Ostdeutschen durch die Westmächte werden beleuchtet.
Wie wird der 17. Juni 1953 im Geschichtsunterricht behandelt?
Der Text untersucht die didaktische und methodische Aufarbeitung des 17. Juni 1953 im Geschichtsunterricht. Er analysiert die didaktische Konzeption und Zielsetzung, die methodische und didaktische Analyse des Themas im schulischen Kontext und betont die Bedeutung der Auseinandersetzung mit diesem geschichtlichen Ereignis für die politische Bildung junger Menschen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Textes?
Schlüsselwörter sind: 17. Juni 1953, DDR, Arbeiteraufstand, Volksaufstand, SED, Sowjetunion, Besatzungspolitik, Sozialismus, Repression, Westmächte, Geschichtsunterricht, Magdeburg, Bauarbeiterstreik, Normenerhöhung, Politischer Widerstand.
- Quote paper
- Anja Giffey (Author), 2009, Der 17. Juni 1953. Ein Schlüsselereignis der deutschen Nachkriegsgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340948