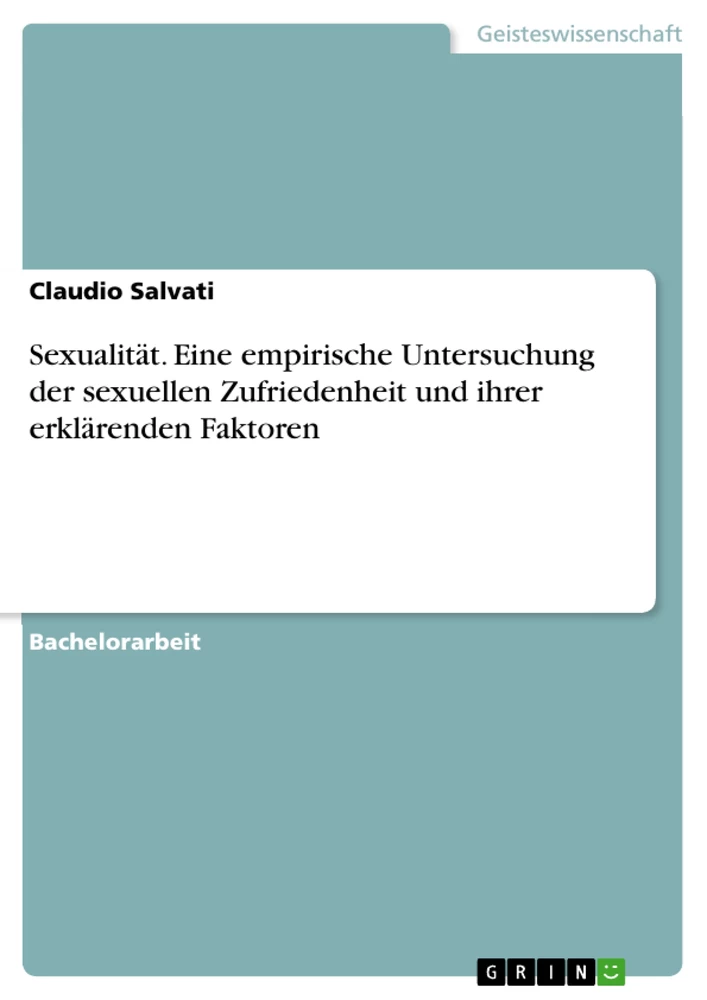Diese Arbeit schließt an die aktuelle Forschung an und untersucht anhand von Paneldaten einige Determinanten sexueller Zufriedenheit, so dass ein kausaler Zusammenhang zwischen ihnen und der Zufriedenheit sichtbar gemacht werden kann.
Eine der in Deutschland führenden Partnervermittlungsplattformen wirbt mit Aussagen, dass alle elf Minuten ein Single sich über die Partnerbörse verliebt und über ein Drittel ihrer Mitglieder bei der Partnersuche erfolgreich sind. Datingportale gründen ihren Erfolg auf das Bedürfnis, das Menschen verspüren, wenn sie nach einem Sexualpartner Ausschau halten: Nach jemandem, der ihnen mit seinem Äußeren oder mit seiner Art, sich zu präsentieren und zu verhalten, so gut gefällt, dass sie ihn für sich gewinnen und mit ihm intim werden möchten.
Die Lust auf die intime Begegnung sorgt dafür, dass die Betroffenen nicht eher zufrieden sind, als bis das Objekt ihrer Zuneigung diese Begierde erwidert. Erst, wenn ihnen das gelingt, sind sie glücklich. Dabei muss man ihnen nicht groß erklären, wie das Verlieben geht, denn schon in frühen Jahren verspüren und entwickeln sie amouröse Gefühle und sehnen sich nach Zweisamkeit.
Das Bedürfnis einer intimen Vereinigung ist jedoch, wie man es von vernunftbegabten Wesen nicht anders erwarten würde, nie das Ergebnis eines rein triebgesteuerten Verhaltens. Zwar wurde ein positiver Zusammenhang zwischen dem Spiegel bestimmter Hormone und der sexuellen Erregung sowie Leistungsfähigkeit festgestellt, allerdings sind Menschen an keine Brunftzeit und keinen biologischen Determinismus gebunden, sondern das umgesetzte Verhalten ist ihrer Reflexion unterworfen, so dass die Kopulation immer und überall stattfinden oder aber auch unter dafür besten Umständen ausbleiben kann.
Die zum Ausdruck gebrachten Gefühle und die angewandten Praktiken sind keine Folge des genetischen Erbguts oder eines im Unterbewusstsein der Menschen verankerten Instinktes, sondern sie spiegeln die sozialstrukturellen Bedingungen wieder, die bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher machen als andere.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie und Hypothesen
- Theory of Happiness
- Sexualität als Konstruktion
- Rational Choice-Theorie
- Forschungsstand
- Money, Sex and Happiness (Blanchflower & Oswald 2004)
- Sex and the Pursuit of Happiness (Wadsworth 2014)
- Methoden
- Daten
- Variablen
- Abhängige Variablen
- Unabhängige Variablen
- Drittvariablen
- Analyseverfahren
- Deskriptive Datenanalyse
- Regressionsanalyse
- Theoretischer Hintergrund
- Regressionsanalyse der Daten
- Regressionsanalyse nach Geschlecht
- Diagnostik
- Ergebnisse
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der empirischen Untersuchung der sexuellen Zufriedenheit und ihren erklärenden Faktoren. Sie setzt sich zum Ziel, einen kausalen Zusammenhang zwischen verschiedenen Determinanten und der Zufriedenheit mit dem eigenen Sexualleben aufzuzeigen. Die Arbeit integriert verschiedene Theorien und Forschungsansätze, um ein umfassendes Bild der Thematik zu zeichnen.
- Theorie der Zufriedenheit
- Soziale Konstruktion von Sexualität
- Rational Choice-Theorie
- Einflussfaktoren auf die sexuelle Zufriedenheit
- Kausale Zusammenhänge zwischen Determinanten und sexueller Zufriedenheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sexuellen Zufriedenheit ein und stellt die Relevanz der Forschung im Kontext der modernen Gesellschaft dar. Sie diskutiert die Herausforderungen der Einbeziehung von Sexualität in die Zufriedenheitsforschung und erläutert die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit.
- Theorie und Hypothesen: Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen der Untersuchung dar, indem es verschiedene Theorien zur Erklärung von Zufriedenheit und Sexualität beleuchtet. Aus diesen Theorien werden Hypothesen abgeleitet, die im Verlauf der Arbeit empirisch geprüft werden.
- Forschungsstand: In diesem Kapitel wird die bisherige Forschung zum Thema sexuelle Zufriedenheit zusammengefasst und die relevanten Studien von Blanchflower & Oswald (2004) und Wadsworth (2014) näher betrachtet.
- Methoden: Dieses Kapitel beschreibt die Methoden der Untersuchung, einschließlich der verwendeten Daten, Variablen (abhängige, unabhängige und Drittvariablen) sowie der Datenerhebung und -aufbereitung.
- Analyseverfahren: Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen Analyseverfahren, die in der Arbeit eingesetzt werden, darunter die deskriptive Datenanalyse und die Regressionsanalyse. Es wird auch auf den theoretischen Hintergrund der Regressionsanalyse sowie auf die Anwendung des Verfahrens auf die Daten eingegangen.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Analysen, ohne jedoch die konkreten Schlussfolgerungen oder die Interpretation der Ergebnisse vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen Sexualität, Zufriedenheit, empirische Forschung, Soziologie der Sexualität, Determinanten der sexuellen Zufriedenheit, Theorie der Zufriedenheit, soziale Konstruktion von Sexualität, Rational Choice-Theorie, Regressionsanalyse, Paneldaten, Pan European Survey (European Social Survey).
Häufig gestellte Fragen
Welche Faktoren beeinflussen die sexuelle Zufriedenheit?
Die Arbeit untersucht Determinanten wie Hormone, soziale Konstruktionen und sozialstrukturelle Bedingungen, die das Sexualverhalten prägen.
Ist menschliche Sexualität rein instinktgesteuert?
Nein, die Untersuchung zeigt, dass Sexualität beim Menschen der Reflexion unterliegt und stark von sozialen Bedingungen und rationalen Entscheidungen abhängt.
Welche Rolle spielt die Rational Choice-Theorie in der Sexualforschung?
Sie wird genutzt, um zu erklären, wie Menschen Entscheidungen über Intimität auf Basis von Erwartungen und sozialen Kosten-Nutzen-Abwägungen treffen.
Was sind Paneldaten in dieser Studie?
Es handelt sich um Daten aus wiederholten Befragungen (z. B. European Social Survey), die es erlauben, kausale Zusammenhänge über die Zeit hinweg sichtbar zu machen.
Gibt es Unterschiede in der sexuellen Zufriedenheit zwischen den Geschlechtern?
Die Arbeit führt eine Regressionsanalyse nach Geschlecht durch, um spezifische Unterschiede in den Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit zu identifizieren.
- Citar trabajo
- Claudio Salvati (Autor), 2015, Sexualität. Eine empirische Untersuchung der sexuellen Zufriedenheit und ihrer erklärenden Faktoren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340121